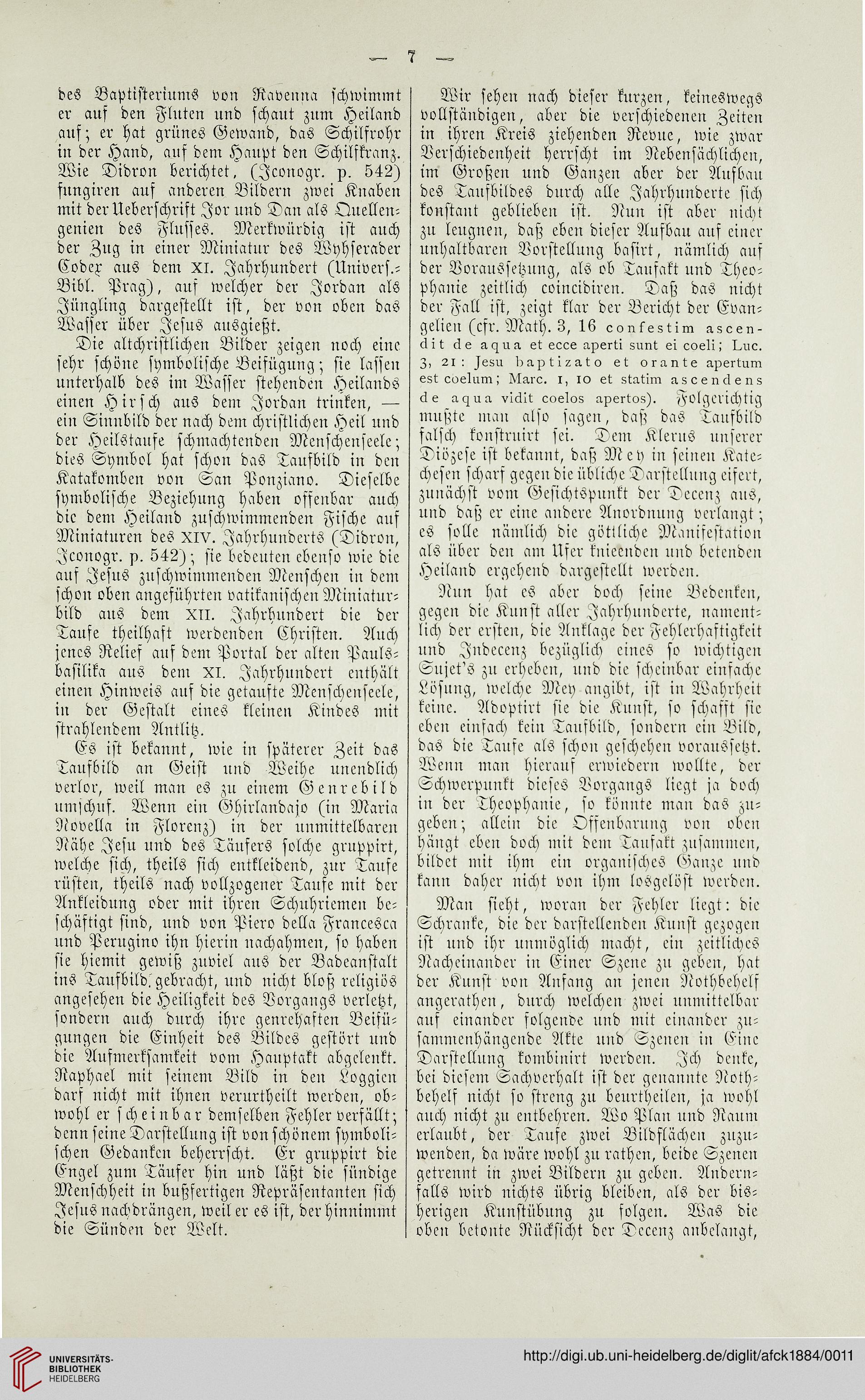7
deS Baptisteriums von Ravenna schwimmt
er auf den Fluten und schaut zum Heiland
auf; er hat grünes Gewand, das Schilfrohr
in der Hand, auf den: Haupt den Schilfkranz.
Wie Didron berichtet. (Jconogr. p. 542)
fungiren auf anderen Bildern zwei Knaben
mit der Ueberschrift Jor und Dan als Duellen-
genien des Flusses. Merkwürdig ist auch
der Zug in einer Miniatur des Wyhserader
Codex aus dem XI. Jahrhundert (Univers.-
Bibl. Prag), auf welcher der Jordan als
Jüngling dargestellt ist, der von oben das
Wasser über Jesus ausgießt.
Die altchristlichen Bilder zeigen noch eine
sehr schöne symbolische Beifügung; sie lassen
unterhalb des im Wasser stehenden Heilands
einen Hirsch aus dem Jordan trinken, —
ein Sinnbild der nach dem christlichen Heil und
der Heilstaufe schmachtenden Menfchenseele;
dies Synlbol hat schon das Taufbild in den
Katakomben von San Ponziano. Dieselbe
symbolische Beziehung haben offenbar auch
die den: Heiland zuschwimmenden Fische auf
Miniaturen des XIV. Jahrhunderts (Didron,
Jcouogr. p. 542); sie bedeuten ebenso wie die
auf Jesus zuschwimmenden Menschei: in den:
schon oben angeführten vatikanischen Miniatur-
bild aus dem XII. Jahrhundert die der
Taufe theilhaft werdenden Christen. Auch
jenes Relief auf dem Portal der alten Pauls-
basilika aus den: XI. Jahrhundert enthalt
einen Hinweis auf die getaufte Meuschenseele,
in der Gestalt eines kleine,: Kindes mit
strahlenden: Antlitz.
Es ist bekannt, wie in späterer Zeit das
Taufbild au Geist und Weihe unendlich
verlor, weil man es zu eiuem Genrebild
umschuf. Wenn ein Ghirlandajo (in Maria
Novella in Florenz) in der unmittelbaren
Nähe Jesu und des Täufers solche gruppirt,
welche sich, theils sich entkleidend, zur Taufe
rüsten, theils nach vollzogener Taufe mit der
Ankleidung oder mit ihren Schuhriemen be-
schäftigt sind, und von Piero della Francesca
und Perugino ihn hierin nachahmen, so haben
sie hiemit gewiß zuviel aus der Badeanstalt
ins Taufbild, gebracht, und nicht bloß religiös
angesehen die Heiligkeit des Vorgangs verletzt,
sondern auch durch ihre genrehaften Beifü-
gungen die Einheit des Bildes gestört und
die Aufmerksamkeit von: Hauptakt abgeleukt.
Raphael mit seinem Bild in den Loggien
darf nicht mit ihnen verurtheilt werden, ob-
wohl er s ch e i n b a r demselben Fehler verfällt;
denn seine Darstellung ist von schönem symboli-
schen Gedanken beherrscht. Er gruppirt die
Engel zun: Täufer hin und läßt die sündige
Menschheit in bußfertigen Repräsentanten sich
Jesus uachdrängen, weil er es ist, der hinnimmt
die Sünden der Welt.
Wir sehen nach dieser kurzen, keineswegs
vollständigen, aber die verschiedenen Zeiten
in ihren Kreis ziehenden Revue, wie zwar
Verschiedenheit herrscht in: Nebensächlichen,
in: Großen und Ganzen aber der Aufbau
des Taufbildes durch alle Jahrhunderte sich
konstant geblieben ist. Nun ist aber nicht
zu leugnen, daß eben dieser Aufbau auf einer
unhaltbaren Vorstellung basirt, nämlich auf
der Voraussetzung, als ob Taufakt und Theo-
phanie zeitlich coincidiren. Daß das nicht
der Fall ist, zeigt klar der Bericht der Evan-
geliei: (efr. Math. 3, 16 confestim ascen-
dit de aqua et ecce aperti sunt ei coeli; Luc.
3, 21 : Jesu baptizato et orante apertum
est coelum; Marc, i, io et statim ascendens
de aqua vldit coelos apertos). Folgerichtig
mußte man also sagen, daß das Taufbild
falsch konstruirt sei. Dem Klerus unserer
Diözese ist bekannt, daß Mey in seinen Kate-
chesen scharf gegen die übliche Darstellung eifert,
zunächst vom Gesichtspunkt der Decenz aus,
und daß er eine andere Anordnung verlangt;
es solle nämlich die göttliche Manifestation
als über den an: User kniecndeu und betenden
Heiland ergehend dargestellt werden.
Nun hat es aber doch seine Bedenken,
gegen die Kunst aller Jahrhunderte, nament-
lich der ersten, die Anklage der Fehlerhaftigkeit
und Jndecenz bezüglich eines so wichtigen
Sujet's zu erheben, und die scheinbar einfache
Lösung, welche Mey angibt, ist in Wahrheit
keine. Adoptirt sie die Kunst, so schafft sie
eben einfach kein Taufbild, sondern ein Bild,
das die Taufe als schon geschehen voraussetzt.
Wenn man hierauf erwiedern tvollte, der
Schwerpunkt dieses Vorgangs liegt ja doch
in der Theophanie, so könnte man das zu-
geben; allein die Offenbarung von oben
hängt eben doch mit dem Taufakt zusammen,
bildet mit ihn: ein organisches Ganze und
kann daher nicht von ihn: losgelöst werden.
Man sieht, woran der Fehler liegt: die
Schranke, die der darstellenden Kunst gezogen
ist und ihr unmöglich macht, ein zeitliches
Nacheinander in Einer Szene zu geben, hat
der Kunst von Anfang an jenen Nothbehelf
angerathen, durch welchen zwei unmittelbar
auf einander folgende und mit einander zu-
sammenhängende Akte und Szenen in Eine
Darstellung kombiuirt werden. Ich denke,
bei diesem Sachverhalt ist der genannte Noth-
behelf nicht so streng zu beurtheilen, ja wohl
auch nicht zu entbehren. Wo Plan und Raun:
erlaubt, der Taufe zwei Bildstächen zuzu-
wenden, da wäre wohl zu ratheu, beide Szenen
getrennt in zwei Bildern zu geben. Andern-
falls wird nichts übrig bleiben, als der bis-
herigen Kunstübung zu folgen. Was die
oben betonte Rücksicht der Decenz anbelangt,
deS Baptisteriums von Ravenna schwimmt
er auf den Fluten und schaut zum Heiland
auf; er hat grünes Gewand, das Schilfrohr
in der Hand, auf den: Haupt den Schilfkranz.
Wie Didron berichtet. (Jconogr. p. 542)
fungiren auf anderen Bildern zwei Knaben
mit der Ueberschrift Jor und Dan als Duellen-
genien des Flusses. Merkwürdig ist auch
der Zug in einer Miniatur des Wyhserader
Codex aus dem XI. Jahrhundert (Univers.-
Bibl. Prag), auf welcher der Jordan als
Jüngling dargestellt ist, der von oben das
Wasser über Jesus ausgießt.
Die altchristlichen Bilder zeigen noch eine
sehr schöne symbolische Beifügung; sie lassen
unterhalb des im Wasser stehenden Heilands
einen Hirsch aus dem Jordan trinken, —
ein Sinnbild der nach dem christlichen Heil und
der Heilstaufe schmachtenden Menfchenseele;
dies Synlbol hat schon das Taufbild in den
Katakomben von San Ponziano. Dieselbe
symbolische Beziehung haben offenbar auch
die den: Heiland zuschwimmenden Fische auf
Miniaturen des XIV. Jahrhunderts (Didron,
Jcouogr. p. 542); sie bedeuten ebenso wie die
auf Jesus zuschwimmenden Menschei: in den:
schon oben angeführten vatikanischen Miniatur-
bild aus dem XII. Jahrhundert die der
Taufe theilhaft werdenden Christen. Auch
jenes Relief auf dem Portal der alten Pauls-
basilika aus den: XI. Jahrhundert enthalt
einen Hinweis auf die getaufte Meuschenseele,
in der Gestalt eines kleine,: Kindes mit
strahlenden: Antlitz.
Es ist bekannt, wie in späterer Zeit das
Taufbild au Geist und Weihe unendlich
verlor, weil man es zu eiuem Genrebild
umschuf. Wenn ein Ghirlandajo (in Maria
Novella in Florenz) in der unmittelbaren
Nähe Jesu und des Täufers solche gruppirt,
welche sich, theils sich entkleidend, zur Taufe
rüsten, theils nach vollzogener Taufe mit der
Ankleidung oder mit ihren Schuhriemen be-
schäftigt sind, und von Piero della Francesca
und Perugino ihn hierin nachahmen, so haben
sie hiemit gewiß zuviel aus der Badeanstalt
ins Taufbild, gebracht, und nicht bloß religiös
angesehen die Heiligkeit des Vorgangs verletzt,
sondern auch durch ihre genrehaften Beifü-
gungen die Einheit des Bildes gestört und
die Aufmerksamkeit von: Hauptakt abgeleukt.
Raphael mit seinem Bild in den Loggien
darf nicht mit ihnen verurtheilt werden, ob-
wohl er s ch e i n b a r demselben Fehler verfällt;
denn seine Darstellung ist von schönem symboli-
schen Gedanken beherrscht. Er gruppirt die
Engel zun: Täufer hin und läßt die sündige
Menschheit in bußfertigen Repräsentanten sich
Jesus uachdrängen, weil er es ist, der hinnimmt
die Sünden der Welt.
Wir sehen nach dieser kurzen, keineswegs
vollständigen, aber die verschiedenen Zeiten
in ihren Kreis ziehenden Revue, wie zwar
Verschiedenheit herrscht in: Nebensächlichen,
in: Großen und Ganzen aber der Aufbau
des Taufbildes durch alle Jahrhunderte sich
konstant geblieben ist. Nun ist aber nicht
zu leugnen, daß eben dieser Aufbau auf einer
unhaltbaren Vorstellung basirt, nämlich auf
der Voraussetzung, als ob Taufakt und Theo-
phanie zeitlich coincidiren. Daß das nicht
der Fall ist, zeigt klar der Bericht der Evan-
geliei: (efr. Math. 3, 16 confestim ascen-
dit de aqua et ecce aperti sunt ei coeli; Luc.
3, 21 : Jesu baptizato et orante apertum
est coelum; Marc, i, io et statim ascendens
de aqua vldit coelos apertos). Folgerichtig
mußte man also sagen, daß das Taufbild
falsch konstruirt sei. Dem Klerus unserer
Diözese ist bekannt, daß Mey in seinen Kate-
chesen scharf gegen die übliche Darstellung eifert,
zunächst vom Gesichtspunkt der Decenz aus,
und daß er eine andere Anordnung verlangt;
es solle nämlich die göttliche Manifestation
als über den an: User kniecndeu und betenden
Heiland ergehend dargestellt werden.
Nun hat es aber doch seine Bedenken,
gegen die Kunst aller Jahrhunderte, nament-
lich der ersten, die Anklage der Fehlerhaftigkeit
und Jndecenz bezüglich eines so wichtigen
Sujet's zu erheben, und die scheinbar einfache
Lösung, welche Mey angibt, ist in Wahrheit
keine. Adoptirt sie die Kunst, so schafft sie
eben einfach kein Taufbild, sondern ein Bild,
das die Taufe als schon geschehen voraussetzt.
Wenn man hierauf erwiedern tvollte, der
Schwerpunkt dieses Vorgangs liegt ja doch
in der Theophanie, so könnte man das zu-
geben; allein die Offenbarung von oben
hängt eben doch mit dem Taufakt zusammen,
bildet mit ihn: ein organisches Ganze und
kann daher nicht von ihn: losgelöst werden.
Man sieht, woran der Fehler liegt: die
Schranke, die der darstellenden Kunst gezogen
ist und ihr unmöglich macht, ein zeitliches
Nacheinander in Einer Szene zu geben, hat
der Kunst von Anfang an jenen Nothbehelf
angerathen, durch welchen zwei unmittelbar
auf einander folgende und mit einander zu-
sammenhängende Akte und Szenen in Eine
Darstellung kombiuirt werden. Ich denke,
bei diesem Sachverhalt ist der genannte Noth-
behelf nicht so streng zu beurtheilen, ja wohl
auch nicht zu entbehren. Wo Plan und Raun:
erlaubt, der Taufe zwei Bildstächen zuzu-
wenden, da wäre wohl zu ratheu, beide Szenen
getrennt in zwei Bildern zu geben. Andern-
falls wird nichts übrig bleiben, als der bis-
herigen Kunstübung zu folgen. Was die
oben betonte Rücksicht der Decenz anbelangt,