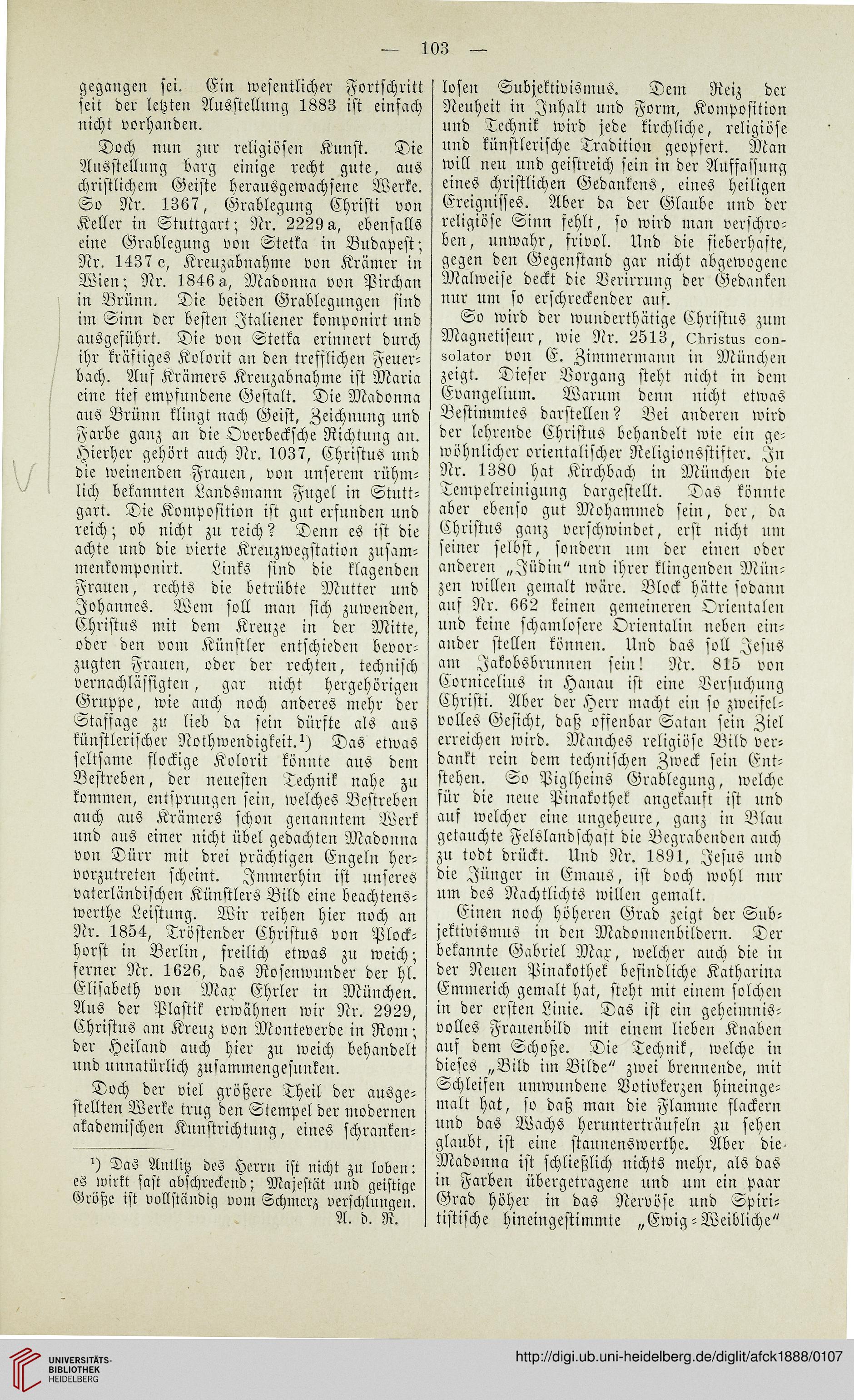— 103
gegangen sei. Ein wesentlicher Fortschritt
seit der letzten Ausstellung 1883 ist einfach
nicht vorhanden.
Doch nun zur religiösen Kunst. Die
Ausstellung barg einige recht gute, aus
christlichem Geiste herausgewachsene Werke.
So Nr. 1367, Grablegung Christi von
Keller in Stuttgart; Nr. 2229 a, ebenfalls
eine Grablegung von Stetka in Budapest;
Nr. 1437 e, Kreuzabnahme von Krämer in
Wien; Nr. 1846 a, Madonna von Pirchan
in Brünn. Die beiden Grablegungen sind
im Sinn der besten Italiener komponirt und
ausgeführt. Die von Stetka erinnert durch
ihr kräftiges Kolorit an den trefflichen Feuer-
bach. Ans Krämers Kreuzabnahme ist Maria
eine tief empfundene Gestalt. Die Madonna
aus Brünn klingt nach Geist, Zeichnung und
Farbe ganz an die Overbecksche Richtung an.
Hierher gehört auch Nr. 1037, Christus und
die weinenden Frauen, von unserem rühm-
lich bekannten Landsmann Füget in Stutt-
gart. Die Koinposition ist gut erfunden und
reich; ob nicht zu reich? Denn es ist die
achte und die vierte Kreuzwegstation zusam-
menkomponirt. Links sind die klagenden
Frauen, rechts die betrübte Mutter und
Johannes. Wem soll man sich zuwenden,
Christus mit dem Kreuze in der Mitte,
oder den vom Künstler entschieden bevor-
zugten Frauen, oder der rechten, technisch
vernachlässigten, gar nicht hergehörigen
Gruppe, wie auch noch anderes mehr der
Staffage zu lieb da sein dürfte als ans
künstlerischer Notwendigkeit. H Das etwas
seltsame flockige Kolorit könnte aus dem
Bestreben, der neuesten Technik nahe zu
kommen, entsprungen sein, welches Bestreben
auch aus Krämers schon genanntem Werk
und ans einer nicht übel gedachten Madonna
von Dürr mit drei prächtigen Engeln her-
vorzutreten scheint. Immerhin ist unseres
vaterländischen Künstlers Bild eine beachtens-
werthe Leistung. Wir reihen hier noch an
Nr. 1854, Tröstender Christus von Plock-
horst in Berlin, freilich etwas zu weich;
ferner Nr. 1626, das Rosenwunder der hl.
Elisabeth von Mar Ehrler in München.
Aus der Plastik erwähnen wir Nr. 2929,
Christus ani Kreuz von Monteverde in Rom;
der Heiland auch hier zu weich behandelt
und unnatürlich zusammengesunkeu.
Doch der viel größere Theil der ausge-
stellten Werke trug den Stempel der modernen
akademischen Kunstrichtung, eines schranken-
C Das Antlitz des Herrn ist nicht zu loben:
es wirkt fast abschreckend; Majestät und geistige
Größe ist vollständig voni Schmerz verschlungen.
A. d. R.
losen Subjektivismus. Dem Reiz der
Neuheit in Inhalt und Form, Komposition
und Technik wird jede kirchliche, religiöse
und künstlerische Tradition geopfert. Man
will neu und geistreich sein in der Auffassung
eines christlichen Gedankens, eines heiligen
Ereignisses. Aber da der Glaube und der
religiöse Sinn fehlt, so wird man verschro-
ben, unwahr, frivol. Und die fieberhafte,
gegen den Gegenstand gar nicht abgewogene
Malweise deckt die Verirrung der Gedanken
nur um so erschreckender aus.
So wird der wunderthätige Christus zum
Magnetiseur, wie Nr. 2513, Christus con-
solator von E. Zimmermann in München
zeigt. Dieser Vorgang steht nicht in dem
Evangelium. Warum denn nicht etwas
Bestimmtes darstellen? Bei anderen wird
der lehrende Christus behandelt wie ein ge-
wöhnlicher orientalischer Religionsstister. In
Nr. 1380 hat Kirchbach in München die
Tempelreinigung dargestellt. Das könnte
aber ebenso gilt Mohamnted sein, der, da
Christus ganz verschwindet, erst nicht um
seiner selbst, sondern um der einen oder-
anderen „Jüdin" ltnb ihrer klingenden Mün-
zen willen gemalt wäre. Block hätte sodann
ans Nr. 662 keinen gemeineren Orientalen
und keine schamlosere Orientalin neben ein-
ander stellen können. Uird das soll Jesus
am Jakobsbrunnen sein! Nr. 815 von
Cornicelins in Hanau ist eine Versuchung
Christi. Aber der Herr nracht ein so zweifel-
volles Gesicht, daß offenbar Satan sein Ziel
erreichen wird. Manches religiöse Bild ver-
dankt rein dem techirischen Zweck sein Ent-
stehen. So Piglheins Grablegung, welche
für die neue Pinakothek angekauft ist und
auf welcher eine ungehettre, ganz in Blau
getauchte Felslandschaft die Begrabenden auch
zu todt drückt. Und Nr. 1891, Jesus und
die Jünger in Emaus, ist doch wohl nur
um des Nachtlichts willen gemalt.
Einen noch höheren Grad zeigt der Sub-
jektivismus in den Madonnenbildern. Der
bekannte Gabriel Max, welcher auch die in
der Netten Pinakothek befindliche Katharina
Emmerich gemalt hat, steht mit einem solchen
in der ersten Linie. Das ist ein geheimnis-
volles Frauenbild mit einem lieben Knaben
auf dem Schoße. Die Technik, welche in
dieses „Bild tm Bilde" zwei brennende, mit
Schleifen umwundene Votivkerzen hineinge-
malt hat, so daß man die Flamme flackern
und das Wachs herunterträufeln zu sehen
glaubt, ist eine stannenswerthe. Aber feie-
Madonna ist schließlich nichts mehr, als das
itt Farben übergetragene und um ein paar
Grad höher in das Nervöse und Spiri-
tistische hineingestimmte „Ewig-Weibliche"
gegangen sei. Ein wesentlicher Fortschritt
seit der letzten Ausstellung 1883 ist einfach
nicht vorhanden.
Doch nun zur religiösen Kunst. Die
Ausstellung barg einige recht gute, aus
christlichem Geiste herausgewachsene Werke.
So Nr. 1367, Grablegung Christi von
Keller in Stuttgart; Nr. 2229 a, ebenfalls
eine Grablegung von Stetka in Budapest;
Nr. 1437 e, Kreuzabnahme von Krämer in
Wien; Nr. 1846 a, Madonna von Pirchan
in Brünn. Die beiden Grablegungen sind
im Sinn der besten Italiener komponirt und
ausgeführt. Die von Stetka erinnert durch
ihr kräftiges Kolorit an den trefflichen Feuer-
bach. Ans Krämers Kreuzabnahme ist Maria
eine tief empfundene Gestalt. Die Madonna
aus Brünn klingt nach Geist, Zeichnung und
Farbe ganz an die Overbecksche Richtung an.
Hierher gehört auch Nr. 1037, Christus und
die weinenden Frauen, von unserem rühm-
lich bekannten Landsmann Füget in Stutt-
gart. Die Koinposition ist gut erfunden und
reich; ob nicht zu reich? Denn es ist die
achte und die vierte Kreuzwegstation zusam-
menkomponirt. Links sind die klagenden
Frauen, rechts die betrübte Mutter und
Johannes. Wem soll man sich zuwenden,
Christus mit dem Kreuze in der Mitte,
oder den vom Künstler entschieden bevor-
zugten Frauen, oder der rechten, technisch
vernachlässigten, gar nicht hergehörigen
Gruppe, wie auch noch anderes mehr der
Staffage zu lieb da sein dürfte als ans
künstlerischer Notwendigkeit. H Das etwas
seltsame flockige Kolorit könnte aus dem
Bestreben, der neuesten Technik nahe zu
kommen, entsprungen sein, welches Bestreben
auch aus Krämers schon genanntem Werk
und ans einer nicht übel gedachten Madonna
von Dürr mit drei prächtigen Engeln her-
vorzutreten scheint. Immerhin ist unseres
vaterländischen Künstlers Bild eine beachtens-
werthe Leistung. Wir reihen hier noch an
Nr. 1854, Tröstender Christus von Plock-
horst in Berlin, freilich etwas zu weich;
ferner Nr. 1626, das Rosenwunder der hl.
Elisabeth von Mar Ehrler in München.
Aus der Plastik erwähnen wir Nr. 2929,
Christus ani Kreuz von Monteverde in Rom;
der Heiland auch hier zu weich behandelt
und unnatürlich zusammengesunkeu.
Doch der viel größere Theil der ausge-
stellten Werke trug den Stempel der modernen
akademischen Kunstrichtung, eines schranken-
C Das Antlitz des Herrn ist nicht zu loben:
es wirkt fast abschreckend; Majestät und geistige
Größe ist vollständig voni Schmerz verschlungen.
A. d. R.
losen Subjektivismus. Dem Reiz der
Neuheit in Inhalt und Form, Komposition
und Technik wird jede kirchliche, religiöse
und künstlerische Tradition geopfert. Man
will neu und geistreich sein in der Auffassung
eines christlichen Gedankens, eines heiligen
Ereignisses. Aber da der Glaube und der
religiöse Sinn fehlt, so wird man verschro-
ben, unwahr, frivol. Und die fieberhafte,
gegen den Gegenstand gar nicht abgewogene
Malweise deckt die Verirrung der Gedanken
nur um so erschreckender aus.
So wird der wunderthätige Christus zum
Magnetiseur, wie Nr. 2513, Christus con-
solator von E. Zimmermann in München
zeigt. Dieser Vorgang steht nicht in dem
Evangelium. Warum denn nicht etwas
Bestimmtes darstellen? Bei anderen wird
der lehrende Christus behandelt wie ein ge-
wöhnlicher orientalischer Religionsstister. In
Nr. 1380 hat Kirchbach in München die
Tempelreinigung dargestellt. Das könnte
aber ebenso gilt Mohamnted sein, der, da
Christus ganz verschwindet, erst nicht um
seiner selbst, sondern um der einen oder-
anderen „Jüdin" ltnb ihrer klingenden Mün-
zen willen gemalt wäre. Block hätte sodann
ans Nr. 662 keinen gemeineren Orientalen
und keine schamlosere Orientalin neben ein-
ander stellen können. Uird das soll Jesus
am Jakobsbrunnen sein! Nr. 815 von
Cornicelins in Hanau ist eine Versuchung
Christi. Aber der Herr nracht ein so zweifel-
volles Gesicht, daß offenbar Satan sein Ziel
erreichen wird. Manches religiöse Bild ver-
dankt rein dem techirischen Zweck sein Ent-
stehen. So Piglheins Grablegung, welche
für die neue Pinakothek angekauft ist und
auf welcher eine ungehettre, ganz in Blau
getauchte Felslandschaft die Begrabenden auch
zu todt drückt. Und Nr. 1891, Jesus und
die Jünger in Emaus, ist doch wohl nur
um des Nachtlichts willen gemalt.
Einen noch höheren Grad zeigt der Sub-
jektivismus in den Madonnenbildern. Der
bekannte Gabriel Max, welcher auch die in
der Netten Pinakothek befindliche Katharina
Emmerich gemalt hat, steht mit einem solchen
in der ersten Linie. Das ist ein geheimnis-
volles Frauenbild mit einem lieben Knaben
auf dem Schoße. Die Technik, welche in
dieses „Bild tm Bilde" zwei brennende, mit
Schleifen umwundene Votivkerzen hineinge-
malt hat, so daß man die Flamme flackern
und das Wachs herunterträufeln zu sehen
glaubt, ist eine stannenswerthe. Aber feie-
Madonna ist schließlich nichts mehr, als das
itt Farben übergetragene und um ein paar
Grad höher in das Nervöse und Spiri-
tistische hineingestimmte „Ewig-Weibliche"