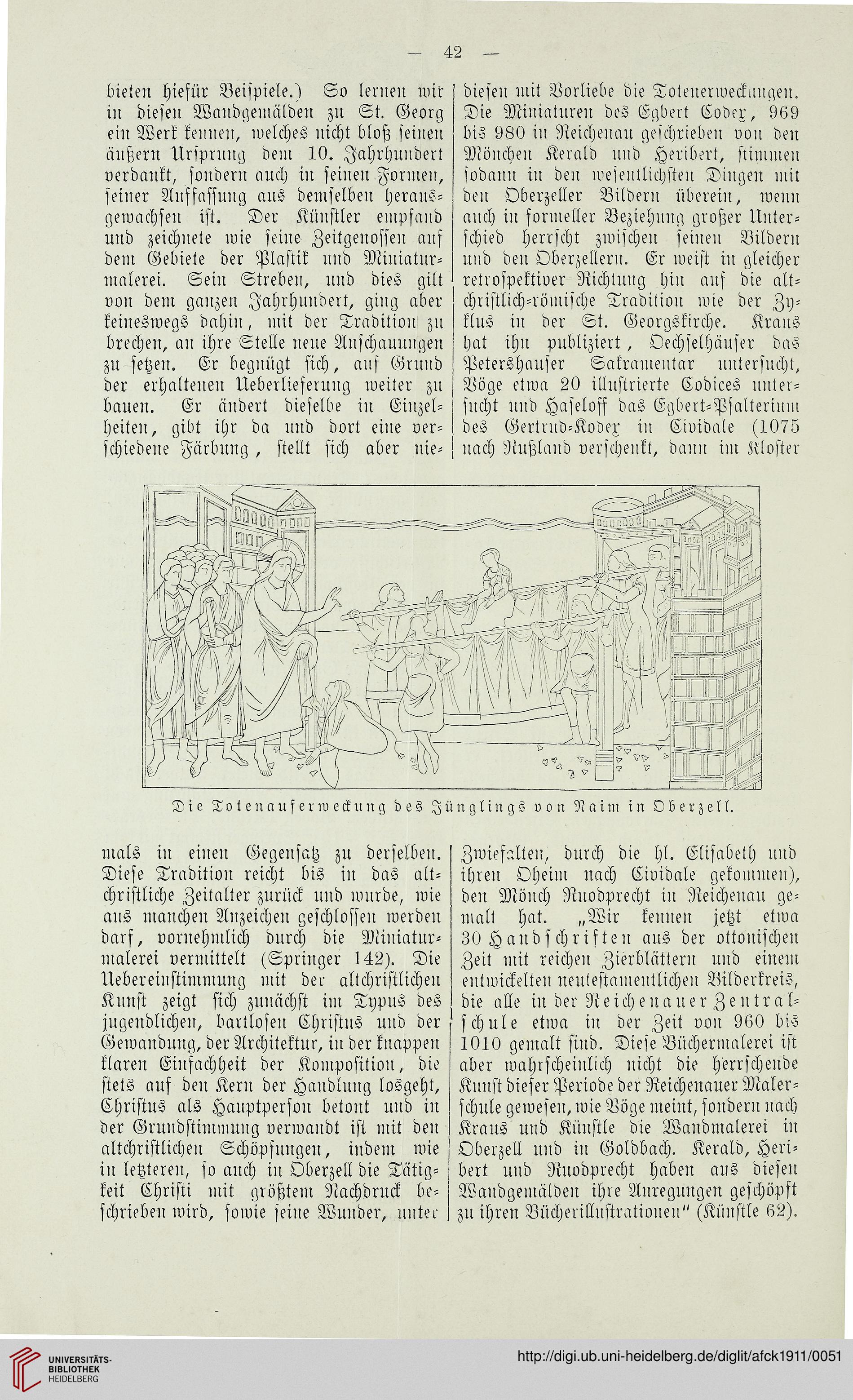42
bieten hiesür Beispiele.) So lernen wir
in diesen Wandgemälden zu St. Georg
ein Werk kennen, welches nicht bloß seinen
äußern Ursprung dem 10. Jahrhundert
verdankt, sondern auch in seinen Formen,
seiner Auffassung aus demselben heraus-
gewachsen ist. Der Künstler empfand
und zeichnete wie seine Zeitgenossen auf
dem Gebiete der Plastik und Miniatur-
malerei. Sein Streben, und dies gilt
von denl ganzen Jahrhundert, ging aber
keineswegs dahin, mit der Tradition §u
brechen, an ihre Stelle neue Anschauungen
zu setzen. Er begnügt sich, ans Grund
der erhaltenen Ueberlieferung weiter zu
bauen. Er ändert dieselbe in Einzel-
heiten, gibt ihr da und dort eine ver-
schiedene Färbung, stellt sich aber nie- j
diesen mit Vorliebe die Totenerweckangen.
Die Miniaturen des Egbert Codex, 969
bis 980 in Reichenau geschrieben von den
Mönchen Kerald und Heribert, stimmen
sodann in den wesentlichsten Dingen mit
den Oberzeller Bildern überein, wenn
auch in formeller Beziehung großer Unter-
schied herrscht zwischen seinen Bildern
uub den Oberzellern. Er weist in gleicher
retrospektiver Richtung hin auf die alt-
christlich-römische Tradition wie der Zy-
klus in der St. Georgskirche. Kraus
hat U)u publiziert, Oechselhäuser das
Petershauser Sakramenlar untersucht,
Vöge etwa 20 illustrierte Codices unter-
sucht und Haseloff das Egbert-Psalterium
des Gertrud-Kodex in Cividale (1075
j nach Rußland verschenkt, bann im Kloster
Die T o 1 e n a u f e r Iv e ck u n g des Jünglings von Naim in Oberzell.
nials in einen Gegensatz zu derselben.
Diese Tradition reicht bis in das alt-
christliche Zeitalter zurück und nuirbe, wie
ans manchen Anzeichen geschlossen werden
darf, vornehmlich durch die Miniatur-
malerei vermittelt (Springer l42). Die
Uebereinstimmung mit der altchristlichen
Kunst zeigt sich zunächst im Typus des
jugendlichen, bartlosen Christus uub der
Gewandung, der Architektur, in der knappen
klaren Einfachheit der Komposition, die
stets auf den Kern der Handlung losgeht,
Christus als Hauptperfoll betont und in
der Grundstinlmuug verwandt ist mit den
altchristlichen Schöpfungen, indem wie
in letzteren, fo auch in Oberzell die Tätig-
keit Christi mit größtem Nachdruck be-
schrieben wird, sowie seine Wunder, unter
Zwiefalten, durch die hl. Elisabeth und
ihren Oheim nach Cividale gekommen),
den Mönch Ruodprecht in Reichenau ge-
malt hat. „Wir kennen jetzt etwa
30 Handschriften aus der ottonischen
Zeit mit reichen Zierblättern und einem
entwickelten neutestamentlichen Bilderkreis,
die alle in der Reichenauer Zentra l-
1 schule etwa in der Zeit von 960 bis
1010 gemalt sind. Diese Büchermalerei ist
aber wahrscheinlich nicht die herrschende
Kunst dieser Periode der Reichenauer Maler-
schule gewesen, wie Vöge meint, sondern nach
Kraus und Künstle die Wandmalerei in
Oberzell und in Goldbach. Kerald, Heri-
bert und Ruodprecht haben aus biefeu
Wandgemälden ihre Anregungen geschöpft
zu ihren Bücherillustrationen" (Künstle 62).
bieten hiesür Beispiele.) So lernen wir
in diesen Wandgemälden zu St. Georg
ein Werk kennen, welches nicht bloß seinen
äußern Ursprung dem 10. Jahrhundert
verdankt, sondern auch in seinen Formen,
seiner Auffassung aus demselben heraus-
gewachsen ist. Der Künstler empfand
und zeichnete wie seine Zeitgenossen auf
dem Gebiete der Plastik und Miniatur-
malerei. Sein Streben, und dies gilt
von denl ganzen Jahrhundert, ging aber
keineswegs dahin, mit der Tradition §u
brechen, an ihre Stelle neue Anschauungen
zu setzen. Er begnügt sich, ans Grund
der erhaltenen Ueberlieferung weiter zu
bauen. Er ändert dieselbe in Einzel-
heiten, gibt ihr da und dort eine ver-
schiedene Färbung, stellt sich aber nie- j
diesen mit Vorliebe die Totenerweckangen.
Die Miniaturen des Egbert Codex, 969
bis 980 in Reichenau geschrieben von den
Mönchen Kerald und Heribert, stimmen
sodann in den wesentlichsten Dingen mit
den Oberzeller Bildern überein, wenn
auch in formeller Beziehung großer Unter-
schied herrscht zwischen seinen Bildern
uub den Oberzellern. Er weist in gleicher
retrospektiver Richtung hin auf die alt-
christlich-römische Tradition wie der Zy-
klus in der St. Georgskirche. Kraus
hat U)u publiziert, Oechselhäuser das
Petershauser Sakramenlar untersucht,
Vöge etwa 20 illustrierte Codices unter-
sucht und Haseloff das Egbert-Psalterium
des Gertrud-Kodex in Cividale (1075
j nach Rußland verschenkt, bann im Kloster
Die T o 1 e n a u f e r Iv e ck u n g des Jünglings von Naim in Oberzell.
nials in einen Gegensatz zu derselben.
Diese Tradition reicht bis in das alt-
christliche Zeitalter zurück und nuirbe, wie
ans manchen Anzeichen geschlossen werden
darf, vornehmlich durch die Miniatur-
malerei vermittelt (Springer l42). Die
Uebereinstimmung mit der altchristlichen
Kunst zeigt sich zunächst im Typus des
jugendlichen, bartlosen Christus uub der
Gewandung, der Architektur, in der knappen
klaren Einfachheit der Komposition, die
stets auf den Kern der Handlung losgeht,
Christus als Hauptperfoll betont und in
der Grundstinlmuug verwandt ist mit den
altchristlichen Schöpfungen, indem wie
in letzteren, fo auch in Oberzell die Tätig-
keit Christi mit größtem Nachdruck be-
schrieben wird, sowie seine Wunder, unter
Zwiefalten, durch die hl. Elisabeth und
ihren Oheim nach Cividale gekommen),
den Mönch Ruodprecht in Reichenau ge-
malt hat. „Wir kennen jetzt etwa
30 Handschriften aus der ottonischen
Zeit mit reichen Zierblättern und einem
entwickelten neutestamentlichen Bilderkreis,
die alle in der Reichenauer Zentra l-
1 schule etwa in der Zeit von 960 bis
1010 gemalt sind. Diese Büchermalerei ist
aber wahrscheinlich nicht die herrschende
Kunst dieser Periode der Reichenauer Maler-
schule gewesen, wie Vöge meint, sondern nach
Kraus und Künstle die Wandmalerei in
Oberzell und in Goldbach. Kerald, Heri-
bert und Ruodprecht haben aus biefeu
Wandgemälden ihre Anregungen geschöpft
zu ihren Bücherillustrationen" (Künstle 62).