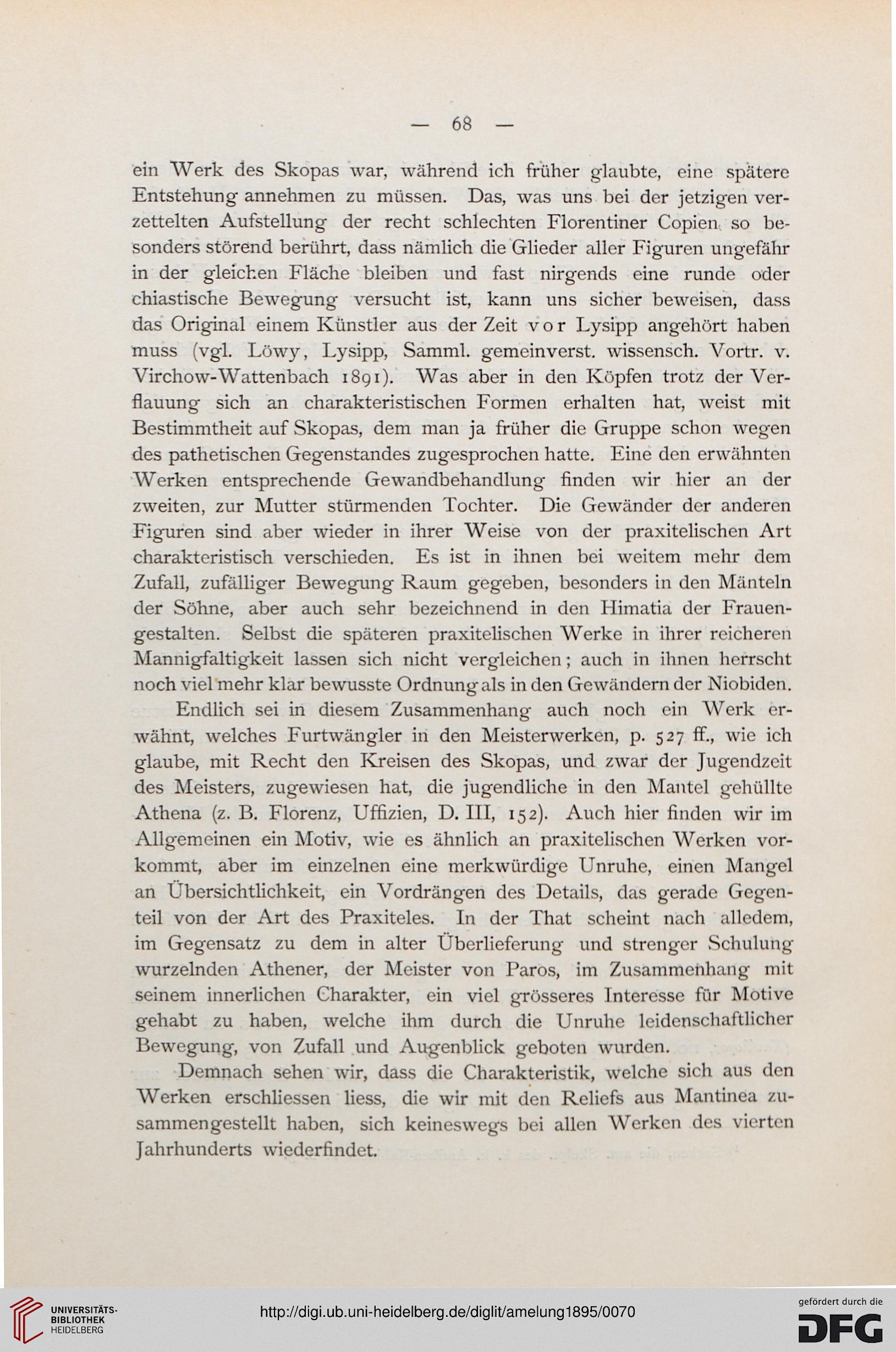— 68 —
ein Werk des Skopas war, während ich früher glaubte, eine spätere
Entstehung annehmen zu müssen. Das, was uns bei der jetzigen ver-
zettelten Aufstellung der recht schlechten Florentiner Copien so be-
sonders störend berührt, dass nämlich die Glieder aller Figuren ungefähr
in der gleichen Fläche bleiben und fast nirgends eine runde oder
chiastische Bewegung versucht ist, kann uns sicher beweisen, dass
das Original einem Künstler aus der Zeit vor Lysipp angehört haben
muss (vgl. Löwy, Lysipp, Samml. gemeinverst. wissensch. Vortr. v.
Virchow-Wattenbach 1891). Was aber in den Köpfen trotz der Ver-
flauung sich an charakteristischen Formen erhalten hat, weist mit
Bestimmtheit auf Skopas, dem man ja früher die Gruppe schon wegen
des pathetischen Gegenstandes zugesprochen hatte. Eine den erwähnten
Werken entsprechende Gewandbehandlung finden wir hier an der
zweiten, zur Mutter stürmenden Tochter. Die Gewänder der anderen
Figuren sind aber wieder in ihrer Weise von der praxitelischen Art
charakteristisch verschieden. Es ist in ihnen bei weitem mehr dem
Zufall, zufälliger Bewegung Raum gegeben, besonders in den Mänteln
der Söhne, aber auch sehr bezeichnend in den Himatia der Frauen-
gestalten. Selbst die späteren praxitelischen Werke in ihrer reicheren
Mannigfaltigkeit lassen sich nicht vergleichen; auch in ihnen herrscht
noch viel mehr klar bewusste Ordnung als in den Gewändern der Niobiden.
Endlich sei in diesem Zusammenhang auch noch ein Werk er-
wähnt, welches Furtwängler in den Meisterwerken, p. 527 ff., wie ich
glaube, mit Recht den Kreisen des Skopas, und zwar der Jugendzeit
des Meisters, zugewiesen hat, die jugendliche in den Mantel gehüllte
Athena (z. B. Florenz, Uffizien, D. III, 152). Auch hier finden wir im
Allgemeinen ein Motiv, wie es ähnlich an praxitelischen Werken vor-
kommt, aber im einzelnen eine merkwürdige Unruhe, einen Mangel
an Übersichtlichkeit, ein Vordrängen des Details, das gerade Gegen-
teil von der Art des Praxiteles. In der That scheint nach alledem,
im Gegensatz zu dem in alter Überlieferung und strenger Schulung
wurzelnden Athener, der Meister von Faros, im Zusammenhang mit
seinem innerlichen Charakter, ein viel grösseres Interesse für Motive
gehabt zu haben, welche ihm durch die Unruhe leidenschaftlicher
Bewegung, von Zufall und Augenblick geboten wurden.
Demnach sehen wir, dass die Charakteristik, welche sich aus den
Werken erschliessen Hess, die wir mit den Reliefs aus Mantinea zu-
sammen gestellt haben, sich keineswegs bei allen Werken des vierten
Jahrhunderts wiederfindet.
ein Werk des Skopas war, während ich früher glaubte, eine spätere
Entstehung annehmen zu müssen. Das, was uns bei der jetzigen ver-
zettelten Aufstellung der recht schlechten Florentiner Copien so be-
sonders störend berührt, dass nämlich die Glieder aller Figuren ungefähr
in der gleichen Fläche bleiben und fast nirgends eine runde oder
chiastische Bewegung versucht ist, kann uns sicher beweisen, dass
das Original einem Künstler aus der Zeit vor Lysipp angehört haben
muss (vgl. Löwy, Lysipp, Samml. gemeinverst. wissensch. Vortr. v.
Virchow-Wattenbach 1891). Was aber in den Köpfen trotz der Ver-
flauung sich an charakteristischen Formen erhalten hat, weist mit
Bestimmtheit auf Skopas, dem man ja früher die Gruppe schon wegen
des pathetischen Gegenstandes zugesprochen hatte. Eine den erwähnten
Werken entsprechende Gewandbehandlung finden wir hier an der
zweiten, zur Mutter stürmenden Tochter. Die Gewänder der anderen
Figuren sind aber wieder in ihrer Weise von der praxitelischen Art
charakteristisch verschieden. Es ist in ihnen bei weitem mehr dem
Zufall, zufälliger Bewegung Raum gegeben, besonders in den Mänteln
der Söhne, aber auch sehr bezeichnend in den Himatia der Frauen-
gestalten. Selbst die späteren praxitelischen Werke in ihrer reicheren
Mannigfaltigkeit lassen sich nicht vergleichen; auch in ihnen herrscht
noch viel mehr klar bewusste Ordnung als in den Gewändern der Niobiden.
Endlich sei in diesem Zusammenhang auch noch ein Werk er-
wähnt, welches Furtwängler in den Meisterwerken, p. 527 ff., wie ich
glaube, mit Recht den Kreisen des Skopas, und zwar der Jugendzeit
des Meisters, zugewiesen hat, die jugendliche in den Mantel gehüllte
Athena (z. B. Florenz, Uffizien, D. III, 152). Auch hier finden wir im
Allgemeinen ein Motiv, wie es ähnlich an praxitelischen Werken vor-
kommt, aber im einzelnen eine merkwürdige Unruhe, einen Mangel
an Übersichtlichkeit, ein Vordrängen des Details, das gerade Gegen-
teil von der Art des Praxiteles. In der That scheint nach alledem,
im Gegensatz zu dem in alter Überlieferung und strenger Schulung
wurzelnden Athener, der Meister von Faros, im Zusammenhang mit
seinem innerlichen Charakter, ein viel grösseres Interesse für Motive
gehabt zu haben, welche ihm durch die Unruhe leidenschaftlicher
Bewegung, von Zufall und Augenblick geboten wurden.
Demnach sehen wir, dass die Charakteristik, welche sich aus den
Werken erschliessen Hess, die wir mit den Reliefs aus Mantinea zu-
sammen gestellt haben, sich keineswegs bei allen Werken des vierten
Jahrhunderts wiederfindet.