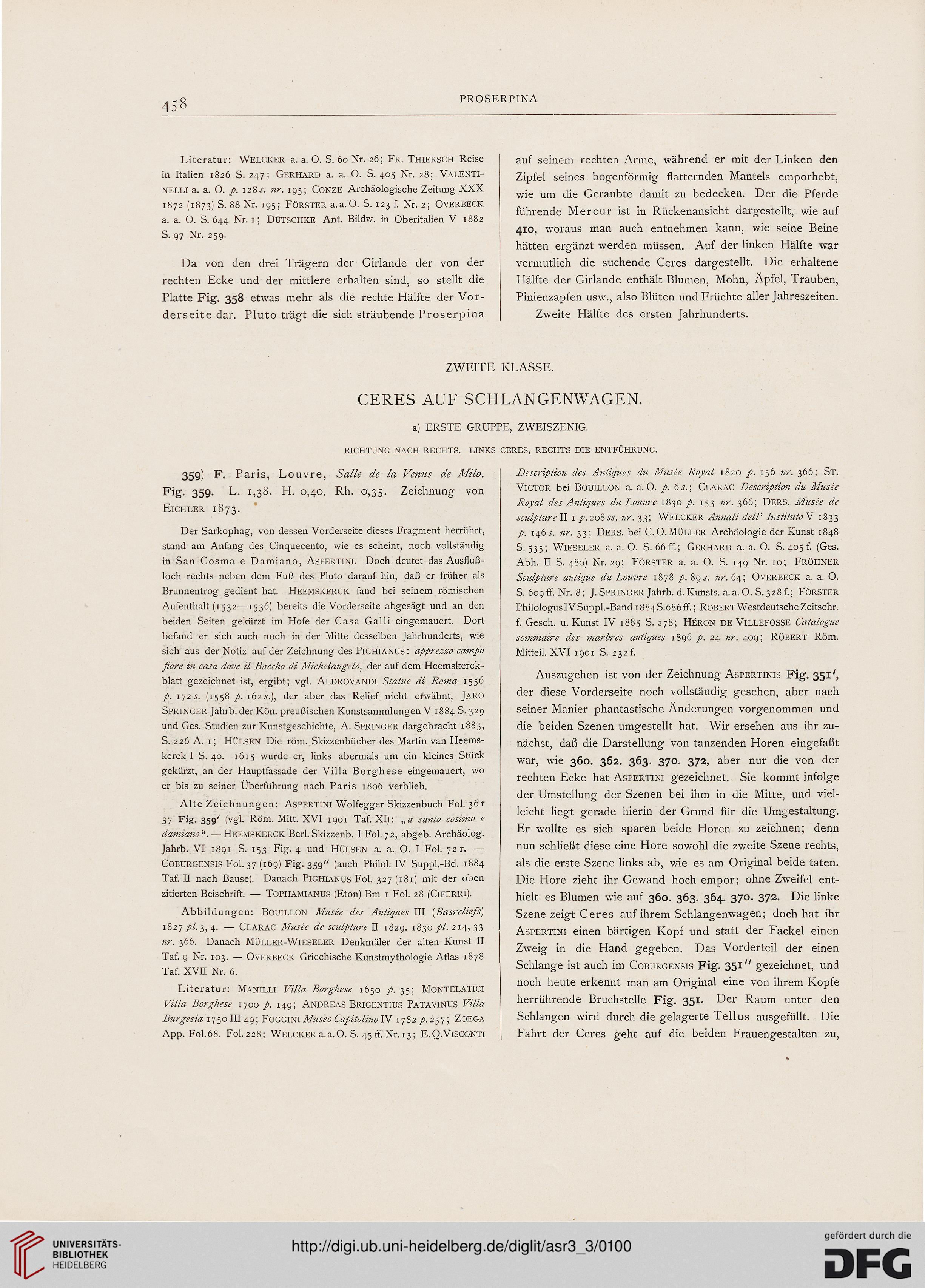458
PROSERPINA
Literatur: Welcker a. a. O. S. 60 Nr. 26; Fr. Thiersch Reise
in Italien 1826 S. 247; Gerhard a. a. O. S. 405 Nr. 28; Valenti-
nelli a. a. O. p. 128j. nr. 195; conze Archäologische Zeitung XXX
1872 (1873) S. 88 Nr. 195; Förster a.a.O. S. 123 f. Nr. 2; Overbeck
a. a. O. S. 644 Nr. 1; Dütschke Ant. Bildw. in Oberitalien V 1882
S. 97 Nr. 259.
Da von den drei Trägern der Girlande der von der
rechten Ecke und der mittlere erhalten sind, so stellt die
Platte Fig. 358 etwas mehr als die rechte Hälfte der Vor-
derseite dar. Pluto trägt die sich sträubende Proserpina
auf seinem rechten Arme, während er mit der Linken den
Zipfel seines bogenförmig flatternden Mantels emporhebt,
wie um die Geraubte damit zu bedecken. Der die Pferde
führende M er cur ist in Rückenansicht dargestellt, wie auf
410, woraus man auch entnehmen kann, wie seine Beine
hätten ergänzt werden müssen. Auf der linken Hälfte war
vermutlich die suchende Ceres dargestellt. Die erhaltene
Hälfte der Girlande enthält Blumen, Mohn, Äpfel, Trauben,
Pinienzapfen usw., also Blüten und Früchte aller Jahreszeiten.
Zweite Hälfte des ersten Jahrhunderts.
ZWEITE KLASSE.
CERES AUF SCHLANGENWAGEN.
a) ERSTE GRUPPE, ZWEISZENIG.
richtung nach rechts. links ceres, rechts die entführung.
359) F» Paris, Louvre, Salle de la Venus de Milo.
Fig. 359. L. 1,38. H. 0,40. Rh. 0,35. Zeichnung von
Eichler 1873.
Der Sarkophag, von dessen Vorderseite dieses Fragment herrührt,
stand am Anfang des Cinquecento, wie es scheint, noch vollständig
in San Cosma e Damiano, Aspertini. Doch deutet das Ausfluß-
loch rechts neben dem Fuß des Pluto darauf hin, daß er früher als
Brunnentrog gedient hat. Heemskerck fand bei seinem römischen
Aufenthalt (1532—1536) bereits die Vorderseite abgesägt und an den
beiden Seiten gekürzt im Hofe der Casa Galli eingemauert. Dort
befand er sich auch noch in der Mitte desselben Jahrhunderts, wie
sich aus der Notiz auf der Zeichnung des PiGHiANUS: apprezzo campo
fiore in casa dove il Baccho di Michelangelo, der auf dem Heemskerck-
blatt gezeichnet ist, ergibt; vgl. Aldrovandi Statue di Roma 1556
p. 172 j. (1558 p. 162 s.), der aber das Relief nicht erwähnt, JARO
Springer Jahrb. der Kön. preußischen Kunstsammlungen V 1884 S. 329
und Ges. Studien zur Kunstgeschichte, A. Springer dargebracht 1885,
S. 226 A. i; hülsen Die röm. Skizzenbücher des Martin van Heems-
kerck I S. 40. 1615 wurde er, links abermals um ein kleines Stück
gekürzt, an der Hauptfassade der Villa Borghese eingemauert, wo
er bis zu seiner Überführung nach Paris 1806 verblieb.
Alte Zeichnungen: Aspertini Wolfegger Skizzenbuch Fol. 36r
37 Fig- 359' (vgl- Röm. Mitt. XVI 1901 Taf. XI): „a Santo cosimo e
damiano ". — HEEMSKERCK Berl. Skizzenb. I Fol. 72, abgeb. Archäolog.
Jahrb. VI 1891 S. 153 Fig. 4 und HÜLSEN a. a. O. I Fol. 72 r. —
COBURGENSIS Fol. 37 (169) Fig. 359" (auch Philol. IV Suppl.-Bd. 1884
Taf. II nach Bause). Danach PiGHiANUS Fol. 327 (181) mit der oben
zitierten Beischrift. — TOPHAMIANUS (Eton) Bm 1 Fol. 28 (ClFERRl).
Abbildungen: Bouillon MüSee des Antiques III [Basreliefs]
1827 pl.3, 4. — CLARAC Musee de sculpture II 1829. 1830//. 214, 33
nr. 366. Danach Müller-Wieseler Denkmäler der alten Kunst II
Taf. 9 Nr. 103. — Overbeck Griechische Kunstmythologie Atlas 1878
Taf. XVII Nr. 6.
Literatur: Manilli Villa Borghese 1650 p. 35; montelatici
Villa Borghese 1700/. 149; Andreas Brigentius Patavinus Villa
Bürgesia 17 50 III 49; foggini Museo Capitolino IV 1782 25 7; zoega
App. Fol.68. Fol. 228; Welcker a.a.O. S. 45 ff. Nr. 13; E.Q.Visconti
Description des Antiques du Musee Royal 1820 p. 156 nr. 366; St.
Victor bei Bouillon a. a. O. p. 6 s.; Clarac Description du Musee
Royal des Antiques du Louvre 1830 p. 153 nr. 366; ders. Musee de
sculpture II 1 /. 208 jj. nr. 33; welcker Annali delP Instituto V 1833
146j. nr. 33; Ders. bei C.O.Müller Archäologie der Kunst 1848
S. 535; Wieseler a. a. O. S. 66 ff; Gerhard a. a. O. S. 405 f. (Ges.
Abh. II S. 480) Nr. 29; förster a. a. O. S. 149 Nr. 10; Fröhner
Sculpture antique du Louvre 1878 p. 89 s. nr. 64; overbeck a. a. O.
S. 609 ff. Nr. 8; J. Springer Jahrb. d. Kunsts. a. a. O. S. 328 f.; Förster
Philologus IV Suppl.-Band 1884 S.686 ff.; Robert Westdeutsche Zeitschr.
f. Gesch. u. Kunst IV 1885 S. 278; H£ron de VlLLEFOSSE Catalogue
sommaire des marbres autiques 1896 p. 24 nr. 409; Robert Röm.
Mitteil. XVI 1901 S. 232 f.
Auszugehen ist von der Zeichnung Aspertinis Fig. 351',
der diese Vorderseite noch vollständig gesehen, aber nach
seiner Manier phantastische Änderungen vorgenommen und
die beiden Szenen umgestellt hat. Wir ersehen aus ihr zu-
nächst, daß die Darstellung von tanzenden Hören eingefaßt
war, wie 360. 362. 363. 370. 372, aber nur die von der
rechten Ecke hat Aspertini gezeichnet. Sie kommt infolge
der Umstellung der Szenen bei ihm in die Mitte, und viel-
leicht liegt gerade hierin der Grund für die Umgestaltung.
Er wollte es sich sparen beide Hören zu zeichnen; denn
nun schließt diese eine Höre sowohl die zweite Szene rechts,
als die erste Szene links ab, wie es am Original beide taten.
Die Höre zieht ihr Gewand hoch empor; ohne Zweifel ent-
hielt es Blumen wie auf 360. 363. 364. 370. 372. Die linke
Szene zeigt Ceres auf ihrem Schlangenwagen; doch hat ihr
Aspertini einen bärtigen Kopf und statt der Fackel einen
Zweig in die Hand gegeben. Das Vorderteil der einen
Schlange ist auch im Coburgensis Fig. 351" gezeichnet, und
noch heute erkennt man am Original eine von ihrem Kopfe
herrührende Bruchstelle Fig. 351. Der Raum unter den
Schlangen wird durch die gelagerte Tellus ausgefüllt. Die
Fahrt der Ceres geht auf die beiden Frauengestalten zu,
PROSERPINA
Literatur: Welcker a. a. O. S. 60 Nr. 26; Fr. Thiersch Reise
in Italien 1826 S. 247; Gerhard a. a. O. S. 405 Nr. 28; Valenti-
nelli a. a. O. p. 128j. nr. 195; conze Archäologische Zeitung XXX
1872 (1873) S. 88 Nr. 195; Förster a.a.O. S. 123 f. Nr. 2; Overbeck
a. a. O. S. 644 Nr. 1; Dütschke Ant. Bildw. in Oberitalien V 1882
S. 97 Nr. 259.
Da von den drei Trägern der Girlande der von der
rechten Ecke und der mittlere erhalten sind, so stellt die
Platte Fig. 358 etwas mehr als die rechte Hälfte der Vor-
derseite dar. Pluto trägt die sich sträubende Proserpina
auf seinem rechten Arme, während er mit der Linken den
Zipfel seines bogenförmig flatternden Mantels emporhebt,
wie um die Geraubte damit zu bedecken. Der die Pferde
führende M er cur ist in Rückenansicht dargestellt, wie auf
410, woraus man auch entnehmen kann, wie seine Beine
hätten ergänzt werden müssen. Auf der linken Hälfte war
vermutlich die suchende Ceres dargestellt. Die erhaltene
Hälfte der Girlande enthält Blumen, Mohn, Äpfel, Trauben,
Pinienzapfen usw., also Blüten und Früchte aller Jahreszeiten.
Zweite Hälfte des ersten Jahrhunderts.
ZWEITE KLASSE.
CERES AUF SCHLANGENWAGEN.
a) ERSTE GRUPPE, ZWEISZENIG.
richtung nach rechts. links ceres, rechts die entführung.
359) F» Paris, Louvre, Salle de la Venus de Milo.
Fig. 359. L. 1,38. H. 0,40. Rh. 0,35. Zeichnung von
Eichler 1873.
Der Sarkophag, von dessen Vorderseite dieses Fragment herrührt,
stand am Anfang des Cinquecento, wie es scheint, noch vollständig
in San Cosma e Damiano, Aspertini. Doch deutet das Ausfluß-
loch rechts neben dem Fuß des Pluto darauf hin, daß er früher als
Brunnentrog gedient hat. Heemskerck fand bei seinem römischen
Aufenthalt (1532—1536) bereits die Vorderseite abgesägt und an den
beiden Seiten gekürzt im Hofe der Casa Galli eingemauert. Dort
befand er sich auch noch in der Mitte desselben Jahrhunderts, wie
sich aus der Notiz auf der Zeichnung des PiGHiANUS: apprezzo campo
fiore in casa dove il Baccho di Michelangelo, der auf dem Heemskerck-
blatt gezeichnet ist, ergibt; vgl. Aldrovandi Statue di Roma 1556
p. 172 j. (1558 p. 162 s.), der aber das Relief nicht erwähnt, JARO
Springer Jahrb. der Kön. preußischen Kunstsammlungen V 1884 S. 329
und Ges. Studien zur Kunstgeschichte, A. Springer dargebracht 1885,
S. 226 A. i; hülsen Die röm. Skizzenbücher des Martin van Heems-
kerck I S. 40. 1615 wurde er, links abermals um ein kleines Stück
gekürzt, an der Hauptfassade der Villa Borghese eingemauert, wo
er bis zu seiner Überführung nach Paris 1806 verblieb.
Alte Zeichnungen: Aspertini Wolfegger Skizzenbuch Fol. 36r
37 Fig- 359' (vgl- Röm. Mitt. XVI 1901 Taf. XI): „a Santo cosimo e
damiano ". — HEEMSKERCK Berl. Skizzenb. I Fol. 72, abgeb. Archäolog.
Jahrb. VI 1891 S. 153 Fig. 4 und HÜLSEN a. a. O. I Fol. 72 r. —
COBURGENSIS Fol. 37 (169) Fig. 359" (auch Philol. IV Suppl.-Bd. 1884
Taf. II nach Bause). Danach PiGHiANUS Fol. 327 (181) mit der oben
zitierten Beischrift. — TOPHAMIANUS (Eton) Bm 1 Fol. 28 (ClFERRl).
Abbildungen: Bouillon MüSee des Antiques III [Basreliefs]
1827 pl.3, 4. — CLARAC Musee de sculpture II 1829. 1830//. 214, 33
nr. 366. Danach Müller-Wieseler Denkmäler der alten Kunst II
Taf. 9 Nr. 103. — Overbeck Griechische Kunstmythologie Atlas 1878
Taf. XVII Nr. 6.
Literatur: Manilli Villa Borghese 1650 p. 35; montelatici
Villa Borghese 1700/. 149; Andreas Brigentius Patavinus Villa
Bürgesia 17 50 III 49; foggini Museo Capitolino IV 1782 25 7; zoega
App. Fol.68. Fol. 228; Welcker a.a.O. S. 45 ff. Nr. 13; E.Q.Visconti
Description des Antiques du Musee Royal 1820 p. 156 nr. 366; St.
Victor bei Bouillon a. a. O. p. 6 s.; Clarac Description du Musee
Royal des Antiques du Louvre 1830 p. 153 nr. 366; ders. Musee de
sculpture II 1 /. 208 jj. nr. 33; welcker Annali delP Instituto V 1833
146j. nr. 33; Ders. bei C.O.Müller Archäologie der Kunst 1848
S. 535; Wieseler a. a. O. S. 66 ff; Gerhard a. a. O. S. 405 f. (Ges.
Abh. II S. 480) Nr. 29; förster a. a. O. S. 149 Nr. 10; Fröhner
Sculpture antique du Louvre 1878 p. 89 s. nr. 64; overbeck a. a. O.
S. 609 ff. Nr. 8; J. Springer Jahrb. d. Kunsts. a. a. O. S. 328 f.; Förster
Philologus IV Suppl.-Band 1884 S.686 ff.; Robert Westdeutsche Zeitschr.
f. Gesch. u. Kunst IV 1885 S. 278; H£ron de VlLLEFOSSE Catalogue
sommaire des marbres autiques 1896 p. 24 nr. 409; Robert Röm.
Mitteil. XVI 1901 S. 232 f.
Auszugehen ist von der Zeichnung Aspertinis Fig. 351',
der diese Vorderseite noch vollständig gesehen, aber nach
seiner Manier phantastische Änderungen vorgenommen und
die beiden Szenen umgestellt hat. Wir ersehen aus ihr zu-
nächst, daß die Darstellung von tanzenden Hören eingefaßt
war, wie 360. 362. 363. 370. 372, aber nur die von der
rechten Ecke hat Aspertini gezeichnet. Sie kommt infolge
der Umstellung der Szenen bei ihm in die Mitte, und viel-
leicht liegt gerade hierin der Grund für die Umgestaltung.
Er wollte es sich sparen beide Hören zu zeichnen; denn
nun schließt diese eine Höre sowohl die zweite Szene rechts,
als die erste Szene links ab, wie es am Original beide taten.
Die Höre zieht ihr Gewand hoch empor; ohne Zweifel ent-
hielt es Blumen wie auf 360. 363. 364. 370. 372. Die linke
Szene zeigt Ceres auf ihrem Schlangenwagen; doch hat ihr
Aspertini einen bärtigen Kopf und statt der Fackel einen
Zweig in die Hand gegeben. Das Vorderteil der einen
Schlange ist auch im Coburgensis Fig. 351" gezeichnet, und
noch heute erkennt man am Original eine von ihrem Kopfe
herrührende Bruchstelle Fig. 351. Der Raum unter den
Schlangen wird durch die gelagerte Tellus ausgefüllt. Die
Fahrt der Ceres geht auf die beiden Frauengestalten zu,