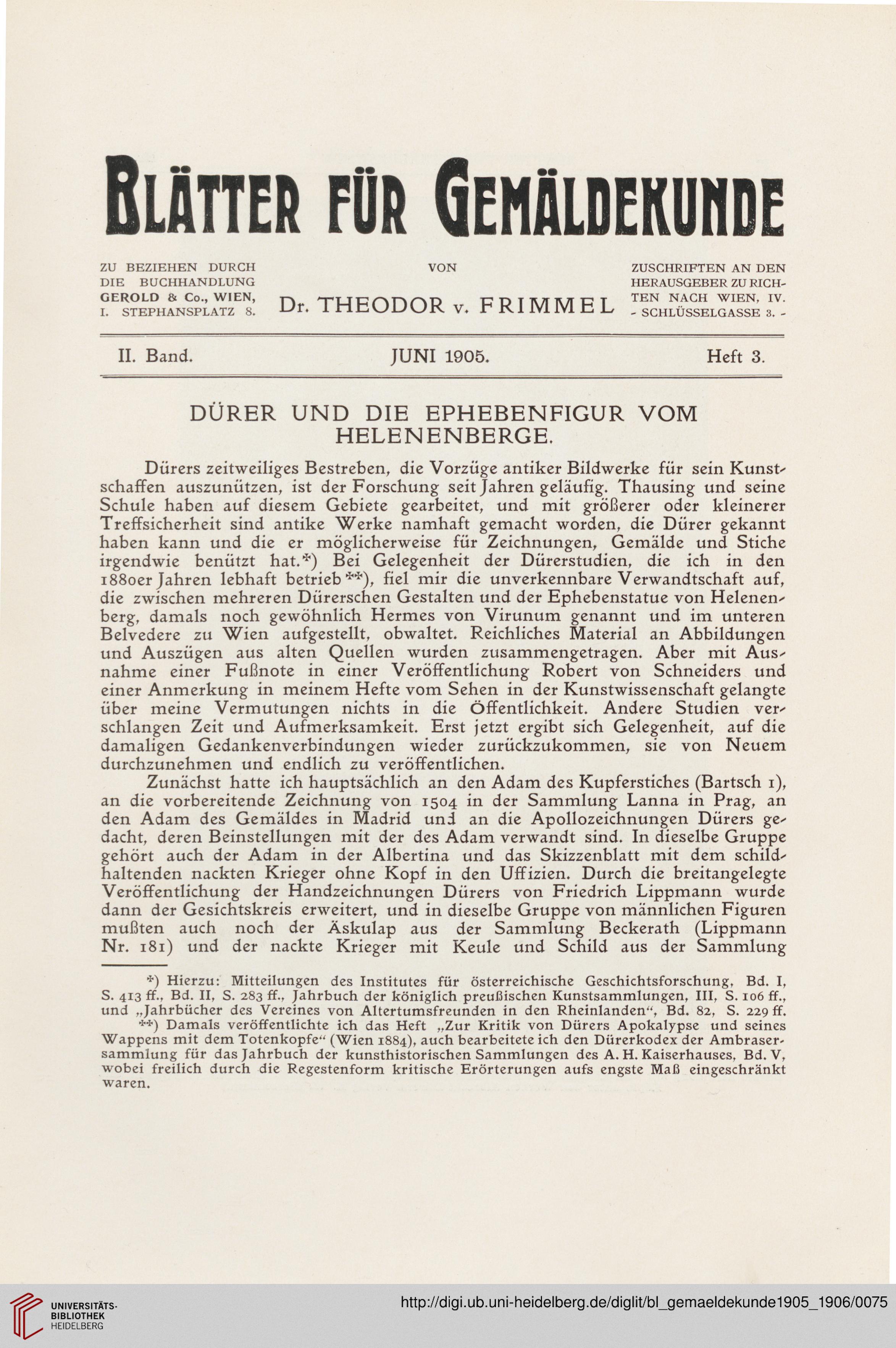Blatter für Gemäldekuhde
VON ZUSCHRIFTEN AN DEN
HERAUSGEBER ZU RICH-
Dr. THEODOR v.FRIMMEL U:
ZU BEZIEHEN DURCH
DIE BUCHHANDLUNG
GEROLD & Co., WIEN,
I. STEPHANSPLATZ 8.
II. Band.
JUNI 1905.
Heft 3.
DÜRER UND DIE EPHEBENFIGUR VOM
HELENENBERGE.
Dürers zeitweiliges Bestreben, die Vorzüge antiker Bildwerke für sein Kunst-
schaffen auszunützen, ist der Forschung seit Jahren geläufig. Thausing und seine
Schule haben auf diesem Gebiete gearbeitet, und mit größerer oder kleinerer
Treffsicherheit sind antike Werke namhaft gemacht worden, die Dürer gekannt
haben kann und die er möglicherweise für Zeichnungen, Gemälde und Stiche
irgendwie benützt hat.*) Bei Gelegenheit der Dürerstudien, die ich in den
1880er Jahren lebhaft betrieb**), fiel mir die unverkennbare Verwandtschaft auf,
die zwischen mehreren Dürerschen Gestalten und der Ephebenstatue von Helenen-
berg, damals noch gewöhnlich Hermes von Virunum genannt und im unteren
Belvedere zu Wien aufgestellt, obwaltet. Reichliches Material an Abbildungen
und Auszügen aus alten Quellen wurden zusammengetragen. Aber mit Aus-
nähme einer Fußnote in einer Veröffentlichung Robert von Schneiders und
einer Anmerkung in meinem Hefte vom Sehen in der Kunstwissenschaft gelangte
über meine Vermutungen nichts in die Öffentlichkeit. Andere Studien ver-
schlangen Zeit und Aufmerksamkeit. Erst jetzt ergibt sich Gelegenheit, auf die
damaligen Gedankenverbindungen wieder zurückzukommen, sie von Neuem
durchzunehmen und endlich zu veröffentlichen.
Zunächst hatte ich hauptsächlich an den Adam des Kupferstiches (Bartsch i),
an die vorbereitende Zeichnung von 1504 in der Sammlung Lanna in Prag, an
den Adam des Gemäldes in Madrid und an die Apollozeichnungen Dürers ge-
dacht, deren Beinstellungen mit der des Adam verwandt sind. In dieselbe Gruppe
gehört auch der Adam in der Albertina und das Skizzenblatt mit dem schild-
haltenden nackten Krieger ohne Kopf in den Uffizien. Durch die breitangelegte
Veröffentlichung der Handzeichnungen Dürers von Friedrich Lippmann wurde
dann der Gesichtskreis erweitert, und in dieselbe Gruppe von männlichen Figuren
mußten auch noch der Äskulap aus der Sammlung Beckerath (Lippmann
Nr. 181) und der nackte Krieger mit Keule und Schild aus der Sammlung
*) Hierzu: Mitteilungen des Institutes für österreichische Geschichtsforschung, Bd. I,
S. 413 ff.. Bd. II, S. 283 ff., Jahrbuch der königlich preußischen Kunstsammlungen, III, S. 106 ff.,
und „Jahrbücher des Vereines von Altertumsfreunden in den Rheinlanden“, Bd. 82, S. 229 ff.
**) Damals veröffentlichte ich das Heft „Zur Kritik von Dürers Apokalypse und seines
Wappens mit dem Totenkopfe“ (Wien 1884), auch bearbeiteteich den Dürerkodex der Ambraser-
sammlung für das Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen des A. H. Kaiserhauses, Bd. V,
wobei freilich durch die Regestenform kritische Erörterungen aufs engste Maß eingeschränkt
waren.
VON ZUSCHRIFTEN AN DEN
HERAUSGEBER ZU RICH-
Dr. THEODOR v.FRIMMEL U:
ZU BEZIEHEN DURCH
DIE BUCHHANDLUNG
GEROLD & Co., WIEN,
I. STEPHANSPLATZ 8.
II. Band.
JUNI 1905.
Heft 3.
DÜRER UND DIE EPHEBENFIGUR VOM
HELENENBERGE.
Dürers zeitweiliges Bestreben, die Vorzüge antiker Bildwerke für sein Kunst-
schaffen auszunützen, ist der Forschung seit Jahren geläufig. Thausing und seine
Schule haben auf diesem Gebiete gearbeitet, und mit größerer oder kleinerer
Treffsicherheit sind antike Werke namhaft gemacht worden, die Dürer gekannt
haben kann und die er möglicherweise für Zeichnungen, Gemälde und Stiche
irgendwie benützt hat.*) Bei Gelegenheit der Dürerstudien, die ich in den
1880er Jahren lebhaft betrieb**), fiel mir die unverkennbare Verwandtschaft auf,
die zwischen mehreren Dürerschen Gestalten und der Ephebenstatue von Helenen-
berg, damals noch gewöhnlich Hermes von Virunum genannt und im unteren
Belvedere zu Wien aufgestellt, obwaltet. Reichliches Material an Abbildungen
und Auszügen aus alten Quellen wurden zusammengetragen. Aber mit Aus-
nähme einer Fußnote in einer Veröffentlichung Robert von Schneiders und
einer Anmerkung in meinem Hefte vom Sehen in der Kunstwissenschaft gelangte
über meine Vermutungen nichts in die Öffentlichkeit. Andere Studien ver-
schlangen Zeit und Aufmerksamkeit. Erst jetzt ergibt sich Gelegenheit, auf die
damaligen Gedankenverbindungen wieder zurückzukommen, sie von Neuem
durchzunehmen und endlich zu veröffentlichen.
Zunächst hatte ich hauptsächlich an den Adam des Kupferstiches (Bartsch i),
an die vorbereitende Zeichnung von 1504 in der Sammlung Lanna in Prag, an
den Adam des Gemäldes in Madrid und an die Apollozeichnungen Dürers ge-
dacht, deren Beinstellungen mit der des Adam verwandt sind. In dieselbe Gruppe
gehört auch der Adam in der Albertina und das Skizzenblatt mit dem schild-
haltenden nackten Krieger ohne Kopf in den Uffizien. Durch die breitangelegte
Veröffentlichung der Handzeichnungen Dürers von Friedrich Lippmann wurde
dann der Gesichtskreis erweitert, und in dieselbe Gruppe von männlichen Figuren
mußten auch noch der Äskulap aus der Sammlung Beckerath (Lippmann
Nr. 181) und der nackte Krieger mit Keule und Schild aus der Sammlung
*) Hierzu: Mitteilungen des Institutes für österreichische Geschichtsforschung, Bd. I,
S. 413 ff.. Bd. II, S. 283 ff., Jahrbuch der königlich preußischen Kunstsammlungen, III, S. 106 ff.,
und „Jahrbücher des Vereines von Altertumsfreunden in den Rheinlanden“, Bd. 82, S. 229 ff.
**) Damals veröffentlichte ich das Heft „Zur Kritik von Dürers Apokalypse und seines
Wappens mit dem Totenkopfe“ (Wien 1884), auch bearbeiteteich den Dürerkodex der Ambraser-
sammlung für das Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen des A. H. Kaiserhauses, Bd. V,
wobei freilich durch die Regestenform kritische Erörterungen aufs engste Maß eingeschränkt
waren.