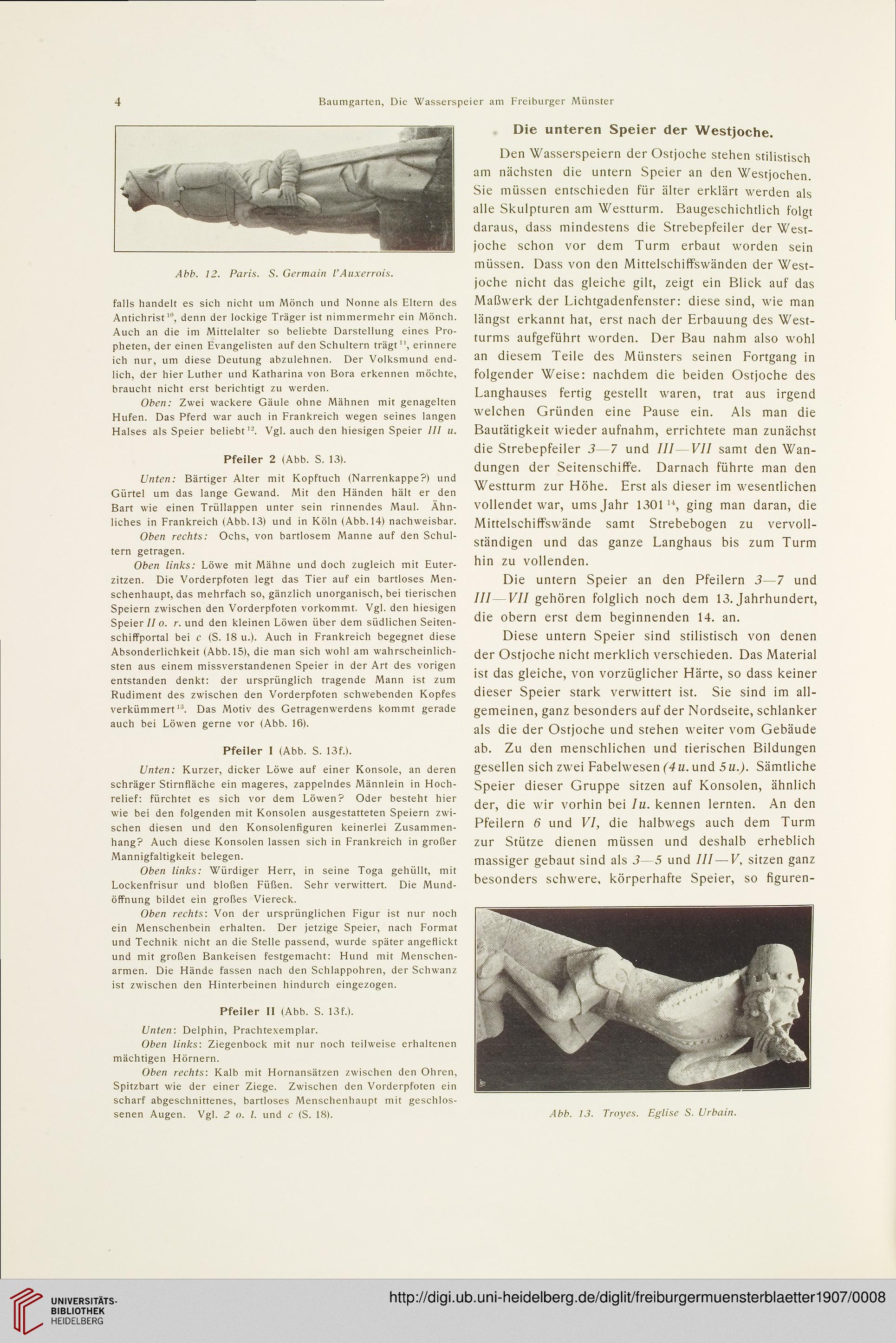Baumgarten, Die Wasserspeier am Freiburger Münster
Abb. 12. Paris. S. Germain l'Auxerrois.
falls handelt es sich nicht um Mönch und Nonne als Eltern des
Antichrist10, denn der lockige Träger ist nimmermehr ein Mönch.
Auch an die im Mittelalter so beliebte Darstellung eines Pro-
pheten, der einen Evangelisten auf den Schultern trägt", erinnere
ich nur, um diese Deutung abzulehnen. Der Volksmund end-
lich, der hier Luther und Katharina von Bora erkennen möchte,
braucht nicht erst berichtigt zu werden.
Oben: Zwei wackere Gäule ohne Mähnen mit genagelten
Hufen. Das Pferd war auch in Frankreich wegen seines langen
Halses als Speier beliebt12. Vgl. auch den hiesigen Speier /// u.
Pfeiler 2 (Abb. S. 13).
Unten: Bärtiger Alter mit Kopftuch (Narrenkappe?) und
Gürtel um das lange Gewand. Mit den Händen hält er den
Bart wie einen Trüllappen unter sein rinnendes Maul. Ähn-
liches in Frankreich (Abb. 13) und in Köln (Abb. 14) nachweisbar.
Oben rechts: Ochs, von bartlosem Manne auf den Schul-
tern getragen.
Oben links: Löwe mit Mähne und doch zugleich mit Euter-
zitzen. Die Vorderpfoten legt das Tier auf ein bartloses Men-
schenhaupt, das mehrfach so, gänzlich unorganisch, bei tierischen
Speiern zwischen den Vorderpfoten vorkommt. Vgl. den hiesigen
Speier II o. r. und den kleinen Löwen über dem südlichen Seiten-
schiffportal bei c (S. 18 u.). Auch in Frankreich begegnet diese
Absonderlichkeit (Abb. 15), die man sich wohl am wahrscheinlich-
sten aus einem missverstandenen Speier in der Art des vorigen
entstanden denkt: der ursprünglich tragende Mann ist zum
Rudiment des zwischen den Vorderpfoten schwebenden Kopfes
verkümmert13. Das Motiv des Getragenwerdens kommt gerade
auch bei Löwen gerne vor (Abb. 16).
Pfeiler I (Abb. S. 13f.).
Unten: Kurzer, dicker Löwe auf einer Konsole, an deren
schräger Stirnfläche ein mageres, zappelndes Männlein in Hoch-
relief: fürchtet es sich vor dem Löwen? Oder besteht hier
wie bei den folgenden mit Konsolen ausgestatteten Speiern zwi-
schen diesen und den Konsolenfiguren keinerlei Zusammen-
hang? Auch diese Konsolen lassen sich in Frankreich in großer
Mannigfaltigkeit belegen.
Oben links: Würdiger Herr, in seine Toga gehüllt, mit
Lockenfrisur und bloßen Füßen. Sehr verwittert. Die Mund-
öffnung bildet ein großes Viereck.
Oben rechts: Von der ursprünglichen Figur ist nur noch
ein Menschenbein erhalten. Der jetzige Speier, nach Format
und Technik nicht an die Stelle passend, wurde später angeflickt
und mit großen Bankeisen festgemacht: Hund mit Menschen-
armen. Die Hände fassen nach den Schlappohren, der Schwanz
ist zwischen den Hinterbeinen hindurch eingezogen.
Pfeiler II (Abb. S. 13f.).
Unten: Delphin, Prachtexemplar.
Oben links: Ziegenbock mit nur noch teilweise erhaltenen
mächtigen Hörnern.
Oben rechts: Kalb mit Hornansätzen zwischen den Ohren,
Spitzbart wie der einer Ziege. Zwischen den Vorderpfoten ein
scharf abgeschnittenes, bartloses Menschenhaupt mit geschlos-
senen Augen. Vgl. 2 o. I. und c (S. 18).
Die unteren Speier der Westjoche.
Den Wasserspeiern der Ostjoche stehen stilistisch
am nächsten die untern Speier an den Westjochen
Sie müssen entschieden für älter erklärt werden als
alle Skulpturen am Westturm. Baugeschichtlich folgt
daraus, dass mindestens die Strebepfeiler der West-
joche schon vor dem Turm erbaut worden sein
müssen. Dass von den Mittelschiffswänden der West-
joche nicht das gleiche gilt, zeigt ein Blick auf das
Maßwerk der Lichtgadenfenster: diese sind, wie man
längst erkannt hat, erst nach der Erbauung des West-
turms aufgeführt worden. Der Bau nahm also wohl
an diesem Teile des Münsters seinen Fortgang in
folgender Weise: nachdem die beiden Ostjoche des
Langhauses fertig gestellt waren, trat aus irgend
welchen Gründen eine Pause ein. Als man die
Bautätigkeit wieder aufnahm, errichtete man zunächst
die Strebepfeiler 3—7 und III—VII samt den Wan-
dungen der Seitenschiffe. Darnach führte man den
Westturm zur Höhe. Erst als dieser im wesentlichen
vollendet war, ums Jahr 130114, ging man daran, die
Mittelschiffswände samt Strebebogen zu vervoll-
ständigen und das ganze Langhaus bis zum Turm
hin zu vollenden.
Die untern Speier an den Pfeilern 3—7 und
///—VII gehören folglich noch dem 13. Jahrhundert,
die obern erst dem beginnenden 14. an.
Diese untern Speier sind stilistisch von denen
der Ostjoche nicht merklich verschieden. Das Material
ist das gleiche, von vorzüglicher Härte, so dass keiner
dieser Speier stark verwittert ist. Sie sind im all-
gemeinen, ganz besonders auf der Nordseite, schlanker
als die der Ostjoche und stehen weiter vom Gebäude
ab. Zu den menschlichen und tierischen Bildungen
gesellen sich zwei Fabelwesen (4 u. und 5 u.). Sämtliche
Speier dieser Gruppe sitzen auf Konsolen, ähnlich
der, die wir vorhin bei Iu. kennen lernten. An den
Pfeilern 6 und VI, die halbwegs auch dem Turm
zur Stütze dienen müssen und deshalb erheblich
massiger gebaut sind als 3—5 und ///—V, sitzen ganz
besonders schwere, körperhafte Speier, so figuren-
Abb. 13. Troves. Eglise S. Urbain.
Abb. 12. Paris. S. Germain l'Auxerrois.
falls handelt es sich nicht um Mönch und Nonne als Eltern des
Antichrist10, denn der lockige Träger ist nimmermehr ein Mönch.
Auch an die im Mittelalter so beliebte Darstellung eines Pro-
pheten, der einen Evangelisten auf den Schultern trägt", erinnere
ich nur, um diese Deutung abzulehnen. Der Volksmund end-
lich, der hier Luther und Katharina von Bora erkennen möchte,
braucht nicht erst berichtigt zu werden.
Oben: Zwei wackere Gäule ohne Mähnen mit genagelten
Hufen. Das Pferd war auch in Frankreich wegen seines langen
Halses als Speier beliebt12. Vgl. auch den hiesigen Speier /// u.
Pfeiler 2 (Abb. S. 13).
Unten: Bärtiger Alter mit Kopftuch (Narrenkappe?) und
Gürtel um das lange Gewand. Mit den Händen hält er den
Bart wie einen Trüllappen unter sein rinnendes Maul. Ähn-
liches in Frankreich (Abb. 13) und in Köln (Abb. 14) nachweisbar.
Oben rechts: Ochs, von bartlosem Manne auf den Schul-
tern getragen.
Oben links: Löwe mit Mähne und doch zugleich mit Euter-
zitzen. Die Vorderpfoten legt das Tier auf ein bartloses Men-
schenhaupt, das mehrfach so, gänzlich unorganisch, bei tierischen
Speiern zwischen den Vorderpfoten vorkommt. Vgl. den hiesigen
Speier II o. r. und den kleinen Löwen über dem südlichen Seiten-
schiffportal bei c (S. 18 u.). Auch in Frankreich begegnet diese
Absonderlichkeit (Abb. 15), die man sich wohl am wahrscheinlich-
sten aus einem missverstandenen Speier in der Art des vorigen
entstanden denkt: der ursprünglich tragende Mann ist zum
Rudiment des zwischen den Vorderpfoten schwebenden Kopfes
verkümmert13. Das Motiv des Getragenwerdens kommt gerade
auch bei Löwen gerne vor (Abb. 16).
Pfeiler I (Abb. S. 13f.).
Unten: Kurzer, dicker Löwe auf einer Konsole, an deren
schräger Stirnfläche ein mageres, zappelndes Männlein in Hoch-
relief: fürchtet es sich vor dem Löwen? Oder besteht hier
wie bei den folgenden mit Konsolen ausgestatteten Speiern zwi-
schen diesen und den Konsolenfiguren keinerlei Zusammen-
hang? Auch diese Konsolen lassen sich in Frankreich in großer
Mannigfaltigkeit belegen.
Oben links: Würdiger Herr, in seine Toga gehüllt, mit
Lockenfrisur und bloßen Füßen. Sehr verwittert. Die Mund-
öffnung bildet ein großes Viereck.
Oben rechts: Von der ursprünglichen Figur ist nur noch
ein Menschenbein erhalten. Der jetzige Speier, nach Format
und Technik nicht an die Stelle passend, wurde später angeflickt
und mit großen Bankeisen festgemacht: Hund mit Menschen-
armen. Die Hände fassen nach den Schlappohren, der Schwanz
ist zwischen den Hinterbeinen hindurch eingezogen.
Pfeiler II (Abb. S. 13f.).
Unten: Delphin, Prachtexemplar.
Oben links: Ziegenbock mit nur noch teilweise erhaltenen
mächtigen Hörnern.
Oben rechts: Kalb mit Hornansätzen zwischen den Ohren,
Spitzbart wie der einer Ziege. Zwischen den Vorderpfoten ein
scharf abgeschnittenes, bartloses Menschenhaupt mit geschlos-
senen Augen. Vgl. 2 o. I. und c (S. 18).
Die unteren Speier der Westjoche.
Den Wasserspeiern der Ostjoche stehen stilistisch
am nächsten die untern Speier an den Westjochen
Sie müssen entschieden für älter erklärt werden als
alle Skulpturen am Westturm. Baugeschichtlich folgt
daraus, dass mindestens die Strebepfeiler der West-
joche schon vor dem Turm erbaut worden sein
müssen. Dass von den Mittelschiffswänden der West-
joche nicht das gleiche gilt, zeigt ein Blick auf das
Maßwerk der Lichtgadenfenster: diese sind, wie man
längst erkannt hat, erst nach der Erbauung des West-
turms aufgeführt worden. Der Bau nahm also wohl
an diesem Teile des Münsters seinen Fortgang in
folgender Weise: nachdem die beiden Ostjoche des
Langhauses fertig gestellt waren, trat aus irgend
welchen Gründen eine Pause ein. Als man die
Bautätigkeit wieder aufnahm, errichtete man zunächst
die Strebepfeiler 3—7 und III—VII samt den Wan-
dungen der Seitenschiffe. Darnach führte man den
Westturm zur Höhe. Erst als dieser im wesentlichen
vollendet war, ums Jahr 130114, ging man daran, die
Mittelschiffswände samt Strebebogen zu vervoll-
ständigen und das ganze Langhaus bis zum Turm
hin zu vollenden.
Die untern Speier an den Pfeilern 3—7 und
///—VII gehören folglich noch dem 13. Jahrhundert,
die obern erst dem beginnenden 14. an.
Diese untern Speier sind stilistisch von denen
der Ostjoche nicht merklich verschieden. Das Material
ist das gleiche, von vorzüglicher Härte, so dass keiner
dieser Speier stark verwittert ist. Sie sind im all-
gemeinen, ganz besonders auf der Nordseite, schlanker
als die der Ostjoche und stehen weiter vom Gebäude
ab. Zu den menschlichen und tierischen Bildungen
gesellen sich zwei Fabelwesen (4 u. und 5 u.). Sämtliche
Speier dieser Gruppe sitzen auf Konsolen, ähnlich
der, die wir vorhin bei Iu. kennen lernten. An den
Pfeilern 6 und VI, die halbwegs auch dem Turm
zur Stütze dienen müssen und deshalb erheblich
massiger gebaut sind als 3—5 und ///—V, sitzen ganz
besonders schwere, körperhafte Speier, so figuren-
Abb. 13. Troves. Eglise S. Urbain.