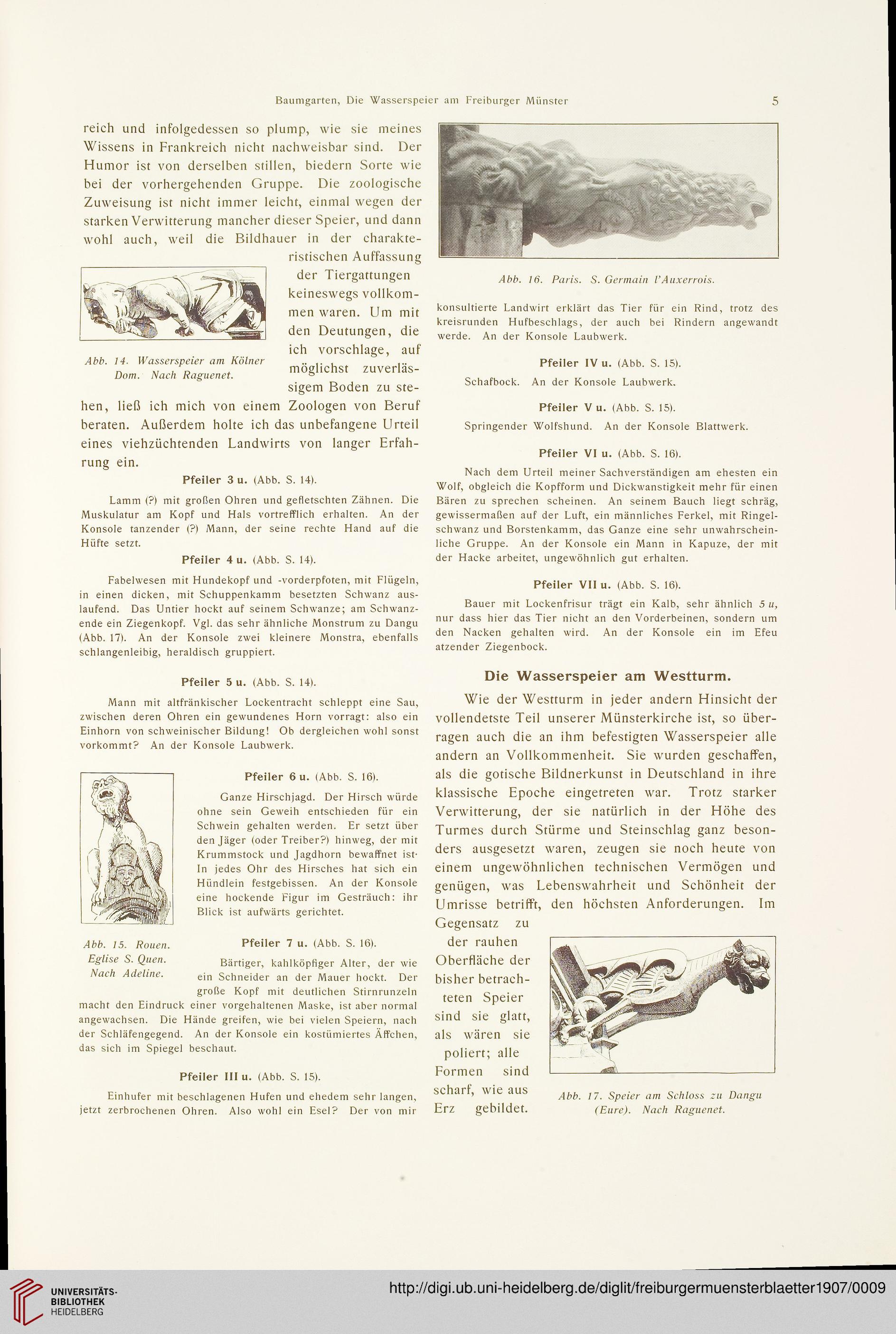Baumgarten, Die Wasserspeier am Freiburger Münster
Abb. 14. Wasserspeier am Kölner
Dom. Nach Raguenet.
reich und infolgedessen so plump, wie sie meines
Wissens in Frankreich nicht nachweisbar sind. Der
Humor ist von derselben stillen, biedern Sorte wie
bei der vorhergehenden Gruppe. Die zoologische
Zuweisung ist nicht immer leicht, einmal wegen der
starken Verwitterung mancher dieser Speier, und dann
wohl auch, weil die Bildhauer in der charakte-
ristischen Auffassung
der Tiergattungen
keineswegs vollkom-
men waren. Um mit
den Deutungen, die
ich vorschlage, auf
möglichst zuverläs-
sigem Boden zu ste-
hen, ließ ich mich von einem Zoologen von Beruf
beraten. Außerdem holte ich das unbefangene Urteil
eines viehzüchtenden Landwirts von langer Erfah-
rung ein.
Pfeiler 3 u. (Abb. S. 14).
Lamm (?) mit großen Ohren und gefletschten Zähnen. Die
Muskulatur am Kopf und Hals vortrefflich erhalten. An der
Konsole tanzender (?) Mann, der seine rechte Hand auf die
Hüfte setzt.
Pfeiler 4 u. (Abb. S. 14).
Fabelwesen mit Hundekopf und -Vorderpfoten, mit Flügeln,
in einen dicken, mit Sehuppenkamm besetzten Schwanz aus-
laufend. Das Untier hockt auf seinem Schwänze; am Schwanz-
ende ein Ziegenkopf. Vgl. das sehr ähnliche Monstrum zu Dangu
(Abb. 17). An der Konsole zwei kleinere Monstra, ebenfalls
schlangenleibig, heraldisch gruppiert.
Pfeiler 5 u. (Abb. S. 14).
Mann mit altfränkischer Lockentracht schleppt eine Sau,
zwischen deren Ohren ein gewundenes Hörn vorragt: also ein
Einhorn von schweinischer Bildung! Ob dergleichen wohl sonst
vorkommt? An der Konsole Laubwerk.
Pfeiler 6 u. (Abb. S. 16).
Ganze Hirschjagd. Der Hirsch würde
ohne sein Geweih entschieden für ein
Schwein gehalten werden. Er setzt über
den Jäger (oder Treiber?) hinweg, der mit
Krummstock und Jagdhorn bewaffnet ist-
in jedes Ohr des Hirsches hat sich ein
Hündlein festgebissen. An der Konsole
eine hockende Figur im Gesträuch: ihr
Blick ist aufwärts gerichtet.
Pfeiler 7 u. (Abb. S. 16).
Abb. 15. Ronen.
Eglise S. Quen.
Nach Adeline.
Bärtiger, kahlköpfiger Alter, der wie
ein Schneider an der Mauer hockt. Der
große Kopf mit deutlichen Stirnrunzeln
macht den Eindruck einer vorgehaltenen Maske, ist aber normal
angewachsen. Die Hände greifen, wie bei vielen Speiern, nach
der Schläfengegend. An der Konsole ein kostümiertes Äffchen,
das sich im Spiegel beschaut.
Pfeiler III u. (Abb. S. 15).
Einhufer mit beschlagenen Hufen und ehedem sehr langen,
jetzt zerbrochenen Ohren. Also wohl ein Esel? Der von mir
Abb. 16. Paris. S. Germain l'Auxerrois.
konsultierte Landwirt erklärt das Tier für ein Rind, trotz des
kreisrunden Hufbeschlags, der auch bei Rindern angewandt
werde. An der Konsole Laubwerk.
Pfeiler IV u. (Abb. S. 15).
Schafbock. An der Konsole Laubwerk.
Pfeiler V u. (Abb. S. 15).
Springender Wolfshund. An der Konsole Blattwerk.
Pfeiler VI u. (Abb. S. 16).
Nach dem Urteil meiner Sachverständigen am ehesten ein
Wolf, obgleich die Kopfform und Dickwanstigkeit mehr für einen
Bären zu sprechen scheinen. An seinem Bauch liegt schräg,
gewissermaßen auf der Luft, ein männliches Ferkel, mit Ringel-
schwanz und Borstenkamm, das Ganze eine sehr unwahrschein-
liche Gruppe. An der Konsole ein Mann in Kapuze, der mit
der Hacke arbeitet, ungewöhnlich gut erhalten.
Pfeiler VII u. (Abb. S. 16).
Bauer mit Lockenfrisur trägt ein Kalb, sehr ähnlich 5 u,
nur dass hier das Tier nicht an den Vorderbeinen, sondern um
den Nacken gehalten wird. An der Konsole ein im Efeu
atzender Ziegenbock.
Die Wasserspeier am Westturm.
Wie der Westturm in jeder andern Hinsicht der
vollendetste Teil unserer Münsterkirche ist, so über-
ragen auch die an ihm befestigten Wasserspeier alle
andern an Vollkommenheit. Sie wurden geschaffen,
als die gotische Bildnerkunst in Deutschland in ihre
klassische Epoche eingetreten war. Trotz starker
Verwitterung, der sie natürlich in der Höhe des
Turmes durch Stürme und Steinschlag ganz beson-
ders ausgesetzt waren, zeugen sie noch heute von
einem ungewöhnlichen technischen Vermögen und
genügen, was Lebenswahrheit und Schönheit der
Umrisse betrifft, den höchsten Anforderungen. Im
Gegensatz zu
der rauhen
Oberfläche der
bisher betrach-
teten Speier
sind sie glatt,
als wären sie
poliert; alle
Formen sind
scharf, wie aus Abb ;7_ Speier am Schlos& zu Dangu
Erz gebildet. (Eure). Nach Raguenet.
Abb. 14. Wasserspeier am Kölner
Dom. Nach Raguenet.
reich und infolgedessen so plump, wie sie meines
Wissens in Frankreich nicht nachweisbar sind. Der
Humor ist von derselben stillen, biedern Sorte wie
bei der vorhergehenden Gruppe. Die zoologische
Zuweisung ist nicht immer leicht, einmal wegen der
starken Verwitterung mancher dieser Speier, und dann
wohl auch, weil die Bildhauer in der charakte-
ristischen Auffassung
der Tiergattungen
keineswegs vollkom-
men waren. Um mit
den Deutungen, die
ich vorschlage, auf
möglichst zuverläs-
sigem Boden zu ste-
hen, ließ ich mich von einem Zoologen von Beruf
beraten. Außerdem holte ich das unbefangene Urteil
eines viehzüchtenden Landwirts von langer Erfah-
rung ein.
Pfeiler 3 u. (Abb. S. 14).
Lamm (?) mit großen Ohren und gefletschten Zähnen. Die
Muskulatur am Kopf und Hals vortrefflich erhalten. An der
Konsole tanzender (?) Mann, der seine rechte Hand auf die
Hüfte setzt.
Pfeiler 4 u. (Abb. S. 14).
Fabelwesen mit Hundekopf und -Vorderpfoten, mit Flügeln,
in einen dicken, mit Sehuppenkamm besetzten Schwanz aus-
laufend. Das Untier hockt auf seinem Schwänze; am Schwanz-
ende ein Ziegenkopf. Vgl. das sehr ähnliche Monstrum zu Dangu
(Abb. 17). An der Konsole zwei kleinere Monstra, ebenfalls
schlangenleibig, heraldisch gruppiert.
Pfeiler 5 u. (Abb. S. 14).
Mann mit altfränkischer Lockentracht schleppt eine Sau,
zwischen deren Ohren ein gewundenes Hörn vorragt: also ein
Einhorn von schweinischer Bildung! Ob dergleichen wohl sonst
vorkommt? An der Konsole Laubwerk.
Pfeiler 6 u. (Abb. S. 16).
Ganze Hirschjagd. Der Hirsch würde
ohne sein Geweih entschieden für ein
Schwein gehalten werden. Er setzt über
den Jäger (oder Treiber?) hinweg, der mit
Krummstock und Jagdhorn bewaffnet ist-
in jedes Ohr des Hirsches hat sich ein
Hündlein festgebissen. An der Konsole
eine hockende Figur im Gesträuch: ihr
Blick ist aufwärts gerichtet.
Pfeiler 7 u. (Abb. S. 16).
Abb. 15. Ronen.
Eglise S. Quen.
Nach Adeline.
Bärtiger, kahlköpfiger Alter, der wie
ein Schneider an der Mauer hockt. Der
große Kopf mit deutlichen Stirnrunzeln
macht den Eindruck einer vorgehaltenen Maske, ist aber normal
angewachsen. Die Hände greifen, wie bei vielen Speiern, nach
der Schläfengegend. An der Konsole ein kostümiertes Äffchen,
das sich im Spiegel beschaut.
Pfeiler III u. (Abb. S. 15).
Einhufer mit beschlagenen Hufen und ehedem sehr langen,
jetzt zerbrochenen Ohren. Also wohl ein Esel? Der von mir
Abb. 16. Paris. S. Germain l'Auxerrois.
konsultierte Landwirt erklärt das Tier für ein Rind, trotz des
kreisrunden Hufbeschlags, der auch bei Rindern angewandt
werde. An der Konsole Laubwerk.
Pfeiler IV u. (Abb. S. 15).
Schafbock. An der Konsole Laubwerk.
Pfeiler V u. (Abb. S. 15).
Springender Wolfshund. An der Konsole Blattwerk.
Pfeiler VI u. (Abb. S. 16).
Nach dem Urteil meiner Sachverständigen am ehesten ein
Wolf, obgleich die Kopfform und Dickwanstigkeit mehr für einen
Bären zu sprechen scheinen. An seinem Bauch liegt schräg,
gewissermaßen auf der Luft, ein männliches Ferkel, mit Ringel-
schwanz und Borstenkamm, das Ganze eine sehr unwahrschein-
liche Gruppe. An der Konsole ein Mann in Kapuze, der mit
der Hacke arbeitet, ungewöhnlich gut erhalten.
Pfeiler VII u. (Abb. S. 16).
Bauer mit Lockenfrisur trägt ein Kalb, sehr ähnlich 5 u,
nur dass hier das Tier nicht an den Vorderbeinen, sondern um
den Nacken gehalten wird. An der Konsole ein im Efeu
atzender Ziegenbock.
Die Wasserspeier am Westturm.
Wie der Westturm in jeder andern Hinsicht der
vollendetste Teil unserer Münsterkirche ist, so über-
ragen auch die an ihm befestigten Wasserspeier alle
andern an Vollkommenheit. Sie wurden geschaffen,
als die gotische Bildnerkunst in Deutschland in ihre
klassische Epoche eingetreten war. Trotz starker
Verwitterung, der sie natürlich in der Höhe des
Turmes durch Stürme und Steinschlag ganz beson-
ders ausgesetzt waren, zeugen sie noch heute von
einem ungewöhnlichen technischen Vermögen und
genügen, was Lebenswahrheit und Schönheit der
Umrisse betrifft, den höchsten Anforderungen. Im
Gegensatz zu
der rauhen
Oberfläche der
bisher betrach-
teten Speier
sind sie glatt,
als wären sie
poliert; alle
Formen sind
scharf, wie aus Abb ;7_ Speier am Schlos& zu Dangu
Erz gebildet. (Eure). Nach Raguenet.