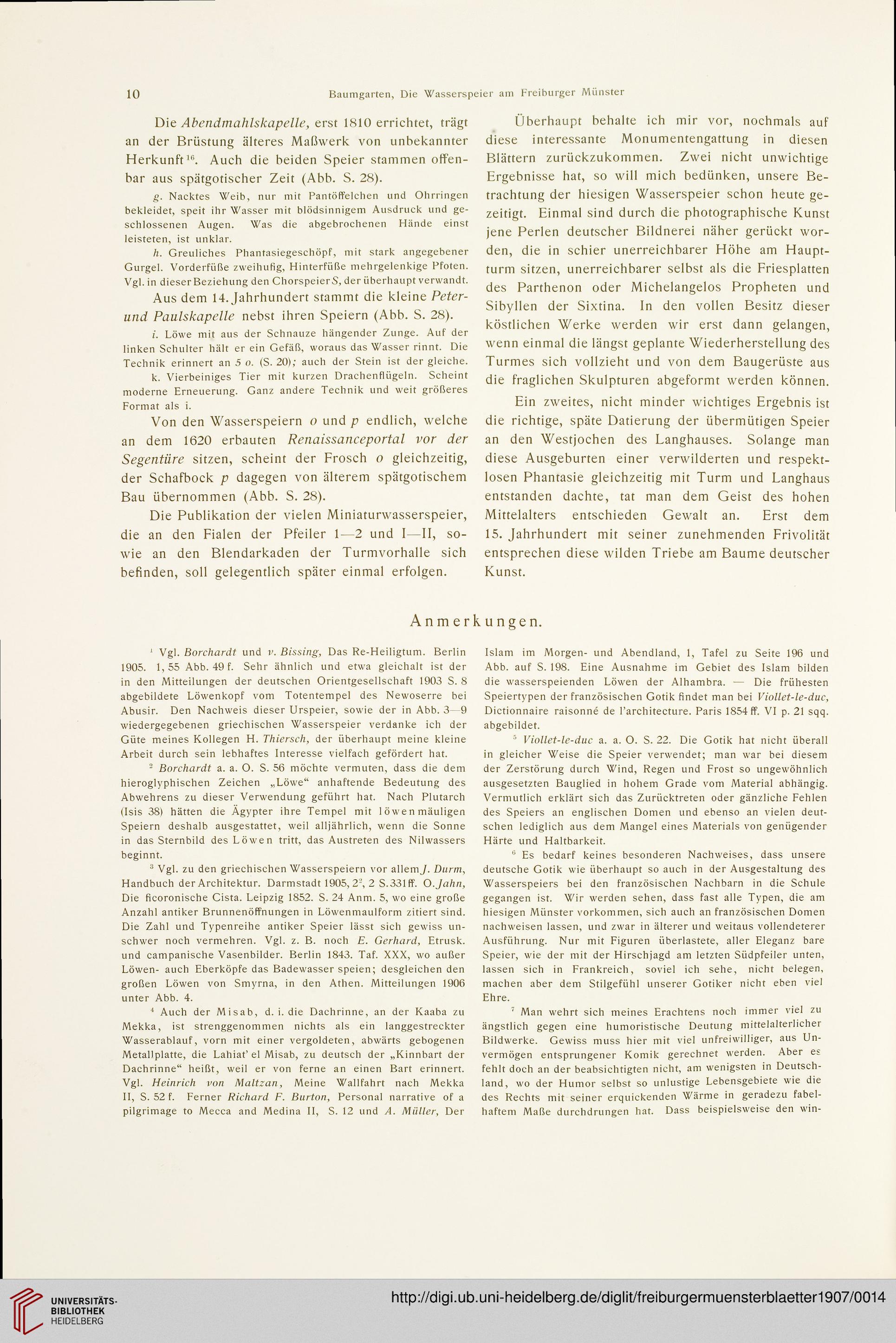10
Baumgarten, Die Wasserspeier am Freiburger Münster
Die Abendmahlskapelle, erst 1810 errichtet, trägt
an der Brüstung älteres Maßwerk von unbekannter
Herkunft16. Auch die beiden Speier stammen offen-
bar aus spätgotischer Zeit (Abb. S. 28).
g. Nacktes Weib, nur mit PantöFFelclien und Ohrringen
bekleidet, speit ihr Wasser mit blödsinnigem Ausdruck und ge-
schlossenen Augen. Was die abgebrochenen Hände einst
leisteten, ist unklar.
h. Greuliches Phantasiegeschöpf, mit stark angegebener
Gurgel. Vorderfüße zweihuflg, Hinterfüße mehrgelenkige Pfoten.
Vgl. in dieser Beziehung den ChorspeierS, der überhaupt verwandt.
Aus dem H.Jahrhundert stammt die kleine Peter-
und Paulskapelle nebst ihren Speiern (Abb. S. 28).
i. Löwe mit aus der Schnauze hängender Zunge. Auf der
linken Schulter hält er ein Gefäß, woraus das Wasser rinnt. Die
Technik erinnert an 5 o. (S. 20); auch der Stein ist der gleiche.
k. Vierbeiniges Tier mit kurzen Drachenflügeln. Scheint
moderne Erneuerung. Ganz andere Technik und weit größeres
Format als i.
Von den Wasserspeiern o und p endlich, welche
an dem 1620 erbauten Renaissanceportal vor der
Segentüre sitzen, scheint der Frosch o gleichzeitig,
der Schafbock p dagegen von älterem spätgotischem
Bau übernommen (Abb. S. 28).
Die Publikation der vielen Miniaturwasserspeier,
die an den Fialen der Pfeiler 1—2 und I—II, so-
wie an den Blendarkaden der Turmvorhalle sich
befinden, soll gelegentlich später einmal erfolgen.
Überhaupt behalte ich mir vor, nochmals auf
diese interessante Monumentengattung in diesen
Blättern zurückzukommen. Zwei nicht unwichtige
Ergebnisse hat, so will mich bedünken, unsere Be-
trachtung der hiesigen Wasserspeier schon heute ge-
zeitigt. Einmal sind durch die photographische Kunst
jene Perlen deutscher Bildnerei näher gerückt wor-
den, die in schier unerreichbarer Höhe am Haupt-
turm sitzen, unerreichbarer selbst als die Friesplatten
des Parthenon oder Michelangelos Propheten und
Sibyllen der Sixtina. In den vollen Besitz dieser
köstlichen Werke werden wir erst dann gelangen,
wenn einmal die längst geplante Wiederherstellung des
Turmes sich vollzieht und von dem Baugerüste aus
die fraglichen Skulpturen abgeformt werden können.
Ein zweites, nicht minder wichtiges Ergebnis ist
die richtige, späte Datierung der übermütigen Speier
an den Westjochen des Langhauses. Solange man
diese Ausgeburten einer verwilderten und respekt-
losen Phantasie gleichzeitig mit Turm und Langhaus
entstanden dachte, tat man dem Geist des hohen
Mittelalters entschieden Gewalt an. Erst dem
15. Jahrhundert mit seiner zunehmenden Frivolität
entsprechen diese wilden Triebe am Baume deutscher
Kunst.
Anmerkungen.
1 Vgl. Borchardt und v. Bissing, Das Re-Heiligtum. Berlin
1905. 1,55 Abb. 49 f. Sehr ähnlich und etwa gleichalt ist der
in den Mitteilungen der deutschen Orientgesellschaft 1903 S. 8
abgebildete Löwenkopf vom Totentempel des Newoserre bei
Abusir. Den Nachweis dieser Urspeier, sowie der in Abb. 3—9
wiedergegebenen griechischen Wasserspeier verdanke ich der
Güte meines Kollegen H. Thiersch, der überhaupt meine kleine
Arbeit durch sein lebhaftes Interesse vielfach gefördert hat.
2 Borchardt a. a. O. S. 56 möchte vermuten, dass die dem
hieroglyphischen Zeichen „Löwe" anhaftende Bedeutung des
Abwehrens zu dieser Verwendung geführt hat. Nach Plutarch
(Isis 38) hätten die Ägypter ihre Tempel mit löwenmäuligen
Speiern deshalb ausgestattet, weil alljährlich, wenn die Sonne
in das Sternbild des Löwen tritt, das Austreten des Nilwassers
beginnt.
3 Vgl. zu den griechischen Wasserspeiern vor allemj. Durm,
Handbuch der Architektur. Darmstadt 1905,2=, 2 S. 331 ff. O.Jahn,
Die ficoronische Cista. Leipzig 1852. S. 24 Anm. 5, wo eine große
Anzahl antiker Brunnenöffnungen in Löwenmaulform zitiert sind.
Die Zahl und Typenreihe antiker Speier lässt sich gewiss un-
schwer noch vermehren. Vgl. z. B. noch E. Gerhard, Etrusk.
und campanische Vasenbilder. Berlin 1843. Taf. XXX, wo außer
Löwen- auch Eberköpfe das Badewasser speien; desgleichen den
großen Löwen von Smyrna, in den Athen. Mitteilungen 1906
unter Abb. 4.
4 Auch der Misab, d. i. die Dachrinne, an der Kaaba zu
Mekka, ist strenggenommen nichts als ein langgestreckter
Wasserablauf, vorn mit einer vergoldeten, abwärts gebogenen
Metallplatte, die Lahiat' el Misab, zu deutsch der „Kinnbart der
Dachrinne" heißt, weil er von ferne an einen Bart erinnert.
Vgl. Heinrich von Maltzan, Meine Wallfahrt nach Mekka
II, S. 52 f. Ferner Richard F. Barton, Personal narrative of a
pilgrimage to Mecca and Medina II, S. 12 und A. Müller, Der
Islam im Morgen- und Abendland, 1, Tafel zu Seite 196 und
Abb. auf S. 198. Eine Ausnahme im Gebiet des Islam bilden
die wasserspeienden Löwen der Alhambra. — Die frühesten
Speiertypen der französischen Gotik findet man bei Viollet-le-duc,
Dictionnaire raisonne de l'architecture. Paris 1854 ff. VI p. 21 sqq.
abgebildet.
5 Viollet-le-duc a. a. O. S. 22. Die Gotik hat nicht überall
in gleicher Weise die Speier verwendet; man war bei diesem
der Zerstörung durch Wind, Regen und Frost so ungewöhnlich
ausgesetzten Bauglied in hohem Grade vom Material abhängig.
Vermutlich erklärt sich das Zurücktreten oder gänzliche Fehlen
des Speiers an englischen Domen und ebenso an vielen deut-
schen lediglich aus dem Mangel eines Materials von genügender
Härte und Haltbarkeit.
" Es bedarf keines besonderen Nachweises, dass unsere
deutsche Gotik wie überhaupt so auch in der Ausgestaltung des
Wasserspeiers bei den französischen Nachbarn in die Schule
gegangen ist. Wir werden sehen, dass fast alle Typen, die am
hiesigen Münster vorkommen, sich auch an französischen Domen
nachweisen lassen, und zwar in älterer und weitaus vollendeterer
Ausführung. Nur mit Figuren überlastete, aller Eleganz bare
Speier, wie der mit der Hirschjagd am letzten Südpfeiler unten,
lassen sich in Frankreich, soviel ich sehe, nicht belegen,
machen aber dem Stilgefühl unserer Gotiker nicht eben viel
Ehre.
7 Man wehrt sich meines Erachtens noch immer viel zu
ängstlich gegen eine humoristische Deutung mittelalterlicher
Bildwerke. Gewiss muss hier mit viel unfreiwilliger, aus Un-
vermögen entsprungener Komik gerechnet werden. Aber es
fehlt doch an der beabsichtigten nicht, am wenigsten in Deutsch-
land, wo der Humor selbst so unlustige Lebensgebiete wie die
des Rechts mit seiner erquickenden Wärme in geradezu fabel-
haftem Maße durchdrungen hat. Dass beispielsweise den win-
Baumgarten, Die Wasserspeier am Freiburger Münster
Die Abendmahlskapelle, erst 1810 errichtet, trägt
an der Brüstung älteres Maßwerk von unbekannter
Herkunft16. Auch die beiden Speier stammen offen-
bar aus spätgotischer Zeit (Abb. S. 28).
g. Nacktes Weib, nur mit PantöFFelclien und Ohrringen
bekleidet, speit ihr Wasser mit blödsinnigem Ausdruck und ge-
schlossenen Augen. Was die abgebrochenen Hände einst
leisteten, ist unklar.
h. Greuliches Phantasiegeschöpf, mit stark angegebener
Gurgel. Vorderfüße zweihuflg, Hinterfüße mehrgelenkige Pfoten.
Vgl. in dieser Beziehung den ChorspeierS, der überhaupt verwandt.
Aus dem H.Jahrhundert stammt die kleine Peter-
und Paulskapelle nebst ihren Speiern (Abb. S. 28).
i. Löwe mit aus der Schnauze hängender Zunge. Auf der
linken Schulter hält er ein Gefäß, woraus das Wasser rinnt. Die
Technik erinnert an 5 o. (S. 20); auch der Stein ist der gleiche.
k. Vierbeiniges Tier mit kurzen Drachenflügeln. Scheint
moderne Erneuerung. Ganz andere Technik und weit größeres
Format als i.
Von den Wasserspeiern o und p endlich, welche
an dem 1620 erbauten Renaissanceportal vor der
Segentüre sitzen, scheint der Frosch o gleichzeitig,
der Schafbock p dagegen von älterem spätgotischem
Bau übernommen (Abb. S. 28).
Die Publikation der vielen Miniaturwasserspeier,
die an den Fialen der Pfeiler 1—2 und I—II, so-
wie an den Blendarkaden der Turmvorhalle sich
befinden, soll gelegentlich später einmal erfolgen.
Überhaupt behalte ich mir vor, nochmals auf
diese interessante Monumentengattung in diesen
Blättern zurückzukommen. Zwei nicht unwichtige
Ergebnisse hat, so will mich bedünken, unsere Be-
trachtung der hiesigen Wasserspeier schon heute ge-
zeitigt. Einmal sind durch die photographische Kunst
jene Perlen deutscher Bildnerei näher gerückt wor-
den, die in schier unerreichbarer Höhe am Haupt-
turm sitzen, unerreichbarer selbst als die Friesplatten
des Parthenon oder Michelangelos Propheten und
Sibyllen der Sixtina. In den vollen Besitz dieser
köstlichen Werke werden wir erst dann gelangen,
wenn einmal die längst geplante Wiederherstellung des
Turmes sich vollzieht und von dem Baugerüste aus
die fraglichen Skulpturen abgeformt werden können.
Ein zweites, nicht minder wichtiges Ergebnis ist
die richtige, späte Datierung der übermütigen Speier
an den Westjochen des Langhauses. Solange man
diese Ausgeburten einer verwilderten und respekt-
losen Phantasie gleichzeitig mit Turm und Langhaus
entstanden dachte, tat man dem Geist des hohen
Mittelalters entschieden Gewalt an. Erst dem
15. Jahrhundert mit seiner zunehmenden Frivolität
entsprechen diese wilden Triebe am Baume deutscher
Kunst.
Anmerkungen.
1 Vgl. Borchardt und v. Bissing, Das Re-Heiligtum. Berlin
1905. 1,55 Abb. 49 f. Sehr ähnlich und etwa gleichalt ist der
in den Mitteilungen der deutschen Orientgesellschaft 1903 S. 8
abgebildete Löwenkopf vom Totentempel des Newoserre bei
Abusir. Den Nachweis dieser Urspeier, sowie der in Abb. 3—9
wiedergegebenen griechischen Wasserspeier verdanke ich der
Güte meines Kollegen H. Thiersch, der überhaupt meine kleine
Arbeit durch sein lebhaftes Interesse vielfach gefördert hat.
2 Borchardt a. a. O. S. 56 möchte vermuten, dass die dem
hieroglyphischen Zeichen „Löwe" anhaftende Bedeutung des
Abwehrens zu dieser Verwendung geführt hat. Nach Plutarch
(Isis 38) hätten die Ägypter ihre Tempel mit löwenmäuligen
Speiern deshalb ausgestattet, weil alljährlich, wenn die Sonne
in das Sternbild des Löwen tritt, das Austreten des Nilwassers
beginnt.
3 Vgl. zu den griechischen Wasserspeiern vor allemj. Durm,
Handbuch der Architektur. Darmstadt 1905,2=, 2 S. 331 ff. O.Jahn,
Die ficoronische Cista. Leipzig 1852. S. 24 Anm. 5, wo eine große
Anzahl antiker Brunnenöffnungen in Löwenmaulform zitiert sind.
Die Zahl und Typenreihe antiker Speier lässt sich gewiss un-
schwer noch vermehren. Vgl. z. B. noch E. Gerhard, Etrusk.
und campanische Vasenbilder. Berlin 1843. Taf. XXX, wo außer
Löwen- auch Eberköpfe das Badewasser speien; desgleichen den
großen Löwen von Smyrna, in den Athen. Mitteilungen 1906
unter Abb. 4.
4 Auch der Misab, d. i. die Dachrinne, an der Kaaba zu
Mekka, ist strenggenommen nichts als ein langgestreckter
Wasserablauf, vorn mit einer vergoldeten, abwärts gebogenen
Metallplatte, die Lahiat' el Misab, zu deutsch der „Kinnbart der
Dachrinne" heißt, weil er von ferne an einen Bart erinnert.
Vgl. Heinrich von Maltzan, Meine Wallfahrt nach Mekka
II, S. 52 f. Ferner Richard F. Barton, Personal narrative of a
pilgrimage to Mecca and Medina II, S. 12 und A. Müller, Der
Islam im Morgen- und Abendland, 1, Tafel zu Seite 196 und
Abb. auf S. 198. Eine Ausnahme im Gebiet des Islam bilden
die wasserspeienden Löwen der Alhambra. — Die frühesten
Speiertypen der französischen Gotik findet man bei Viollet-le-duc,
Dictionnaire raisonne de l'architecture. Paris 1854 ff. VI p. 21 sqq.
abgebildet.
5 Viollet-le-duc a. a. O. S. 22. Die Gotik hat nicht überall
in gleicher Weise die Speier verwendet; man war bei diesem
der Zerstörung durch Wind, Regen und Frost so ungewöhnlich
ausgesetzten Bauglied in hohem Grade vom Material abhängig.
Vermutlich erklärt sich das Zurücktreten oder gänzliche Fehlen
des Speiers an englischen Domen und ebenso an vielen deut-
schen lediglich aus dem Mangel eines Materials von genügender
Härte und Haltbarkeit.
" Es bedarf keines besonderen Nachweises, dass unsere
deutsche Gotik wie überhaupt so auch in der Ausgestaltung des
Wasserspeiers bei den französischen Nachbarn in die Schule
gegangen ist. Wir werden sehen, dass fast alle Typen, die am
hiesigen Münster vorkommen, sich auch an französischen Domen
nachweisen lassen, und zwar in älterer und weitaus vollendeterer
Ausführung. Nur mit Figuren überlastete, aller Eleganz bare
Speier, wie der mit der Hirschjagd am letzten Südpfeiler unten,
lassen sich in Frankreich, soviel ich sehe, nicht belegen,
machen aber dem Stilgefühl unserer Gotiker nicht eben viel
Ehre.
7 Man wehrt sich meines Erachtens noch immer viel zu
ängstlich gegen eine humoristische Deutung mittelalterlicher
Bildwerke. Gewiss muss hier mit viel unfreiwilliger, aus Un-
vermögen entsprungener Komik gerechnet werden. Aber es
fehlt doch an der beabsichtigten nicht, am wenigsten in Deutsch-
land, wo der Humor selbst so unlustige Lebensgebiete wie die
des Rechts mit seiner erquickenden Wärme in geradezu fabel-
haftem Maße durchdrungen hat. Dass beispielsweise den win-