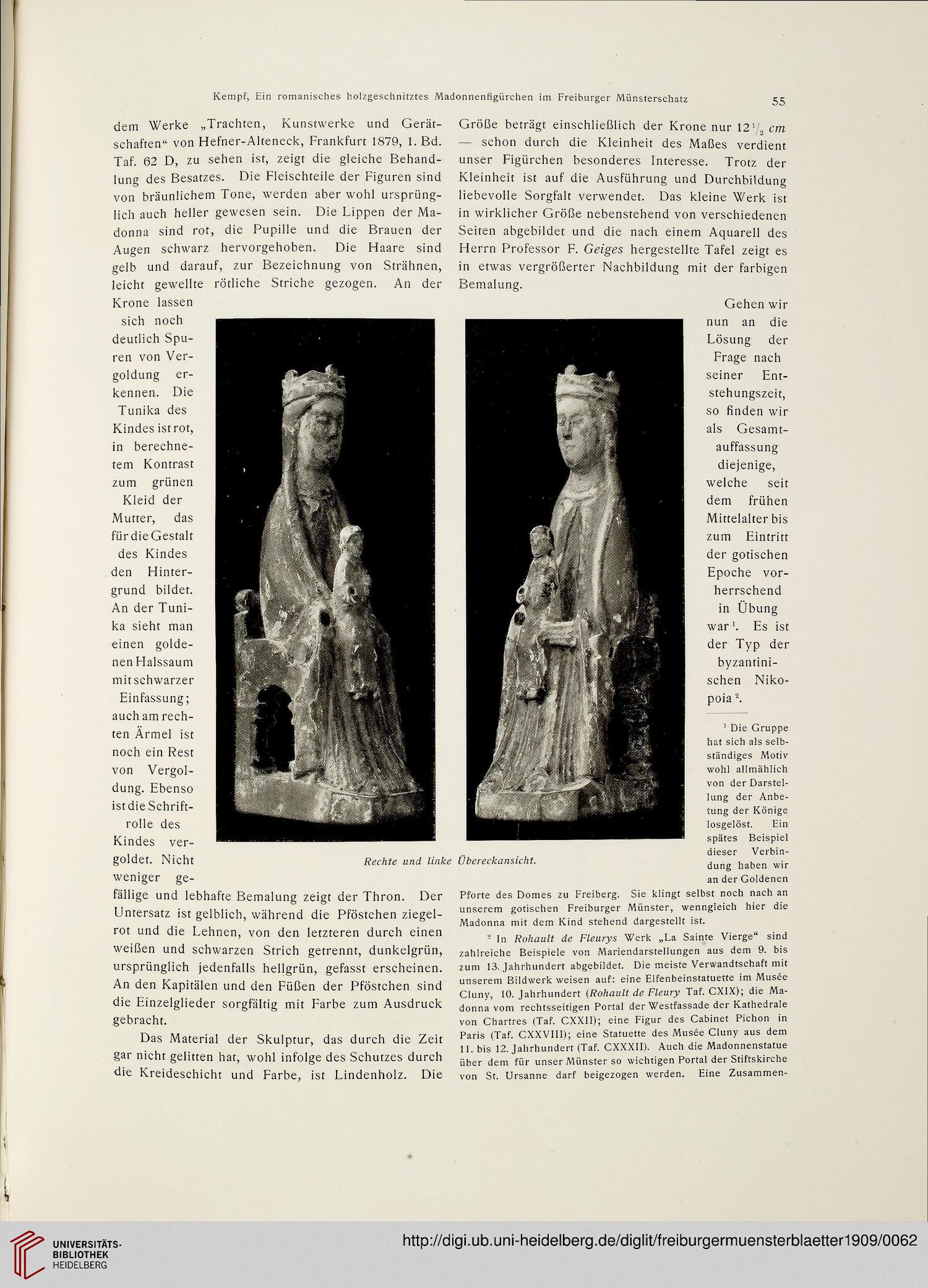Kempf, Ein romanisches holzgeschnitztes Madonnenflgürchen im Freiburger Münsterschatz
55
dem Werke „Trachten, Kunstwerke und Gerät-
schaften" von Hefner-Alteneck, Frankfurt 1879, 1. Bd.
Taf. 62 D, zu sehen ist, zeigt die gleiche Behand-
lung des Besatzes. Die Fleischteile der Figuren sind
von bräunlichem Tone, werden aber wohl ursprüng-
lich auch heller gewesen sein. Die Lippen der Ma-
donna sind rot, die Pupille und die Brauen der
Augen schwarz hervorgehoben. Die Haare sind
gelb und darauf, zur Bezeichnung von Strähnen,
leicht gewellte rötliche Striche gezogen. An der
Krone lassen
sich noch
deutlich Spu-
ren von Ver-
goldung er-
kennen. Die
Tunika des
Kindes ist rot,
in berechne-
tem Kontrast
zum grünen
Kleid der
Mutter, das
fürdieGestalt
des Kindes
den Hinter-
grund bildet.
An der Tuni-
ka sieht man
einen golde-
nen Halssaum
mit schwarzer
Einfassung;
auch am rech-
ten Ärmel ist
noch ein Rest
von Vergol-
dung. Ebenso
ist die Schrift-
rolle des
Kindes ver-
goldet. Nicht
weniger ge-
fällige und lebhafte Bemalung zeigt der Thron. Der
Untersatz ist gelblich, während die Pföstchen ziegel-
rot und die Lehnen, von den letzteren durch einen
weißen und schwarzen Strich getrennt, dunkelgrün,
ursprünglich jedenfalls hellgrün, gefasst erscheinen.
An den Kapitalen und den Füßen der Pföstchen sind
die Einzelglieder sorgfältig mit Farbe zum Ausdruck
gebracht.
Das Material der Skulptur, das durch die Zeit
gar nicht gelitten hat, wohl infolge des Schutzes durch
■die Kreideschicht und Farbe, ist Lindenholz. Die
Rechte und linke Übereckansicht,
Größe beträgt einschließlich der Krone nur 12]/2 cm
— schon durch die Kleinheit des Maßes verdient
unser Figürchen besonderes Interesse. Trotz der
Kleinheit ist auf die Ausführung und Durchbildung
liebevolle Sorgfalt verwendet. Das kleine Werk ist
in wirklicher Größe nebenstehend von verschiedenen
Seiten abgebildet und die nach einem Aquarell des
Herrn Professor F. Geiges hergestellte Tafel zeigt es
in etwas vergrößerter Nachbildung mit der farbigen
Bemalung.
Gehen wir
nun an die
Lösung der
Frage nach
seiner Ent-
stehungszeit,
so finden wir
als Gesamt-
auffassung
diejenige,
welche seit
dem frühen
Mittelalter bis
zum Eintritt
der gotischen
Epoche vor-
herrschend
in Übung
war1. Es ist
der Typ der
byzantini-
schen Niko-
poia2.
1 Die Gruppe
hat sich als selb-
ständiges Motiv
wohl allmählich
von der Darstel-
lung der Anbe-
tung der Könige
losgelöst. Ein
spätes Beispiel
dieser Verbin-
dung haben wir
an der Goldenen
Pforte des Domes zu Freiberg. Sie klingt selbst noch nach an
unserem gotischen Freiburger Münster, wenngleich hier die
Madonna mit dem Kind stehend dargestellt ist.
3 In Rohault de Fleurys Werk „La Sainte Vierge" sind
zahlreiche Beispiele von Mariendarstellungen aus dem 9. bis
zum 13. Jahrhundert abgebildet. Die meiste Verwandtschaft mit
unserem Bildwerk weisen auf: eine Elfenbeinstatuette im Musée
Cluny, 10. Jahrhundert (Rohault de Fleury Taf. CXIX); die Ma-
donna vom rechtsseitigen Portal der Westfassade der Kathedrale
von Chartres (Taf. CXXII); eine Figur des Cabinet Pichon in
Paris (Taf. CXXVI1I); eine Statuette des Musée Cluny aus dem
11. bis 12. Jahrhundert (Taf. CXXXII). Auch die Madonnenstatue
über dem für unser Münster so wichtigen Portal der Stiftskirche
von St. Ursanne darf beigezogen werden. Eine Zusammen-
55
dem Werke „Trachten, Kunstwerke und Gerät-
schaften" von Hefner-Alteneck, Frankfurt 1879, 1. Bd.
Taf. 62 D, zu sehen ist, zeigt die gleiche Behand-
lung des Besatzes. Die Fleischteile der Figuren sind
von bräunlichem Tone, werden aber wohl ursprüng-
lich auch heller gewesen sein. Die Lippen der Ma-
donna sind rot, die Pupille und die Brauen der
Augen schwarz hervorgehoben. Die Haare sind
gelb und darauf, zur Bezeichnung von Strähnen,
leicht gewellte rötliche Striche gezogen. An der
Krone lassen
sich noch
deutlich Spu-
ren von Ver-
goldung er-
kennen. Die
Tunika des
Kindes ist rot,
in berechne-
tem Kontrast
zum grünen
Kleid der
Mutter, das
fürdieGestalt
des Kindes
den Hinter-
grund bildet.
An der Tuni-
ka sieht man
einen golde-
nen Halssaum
mit schwarzer
Einfassung;
auch am rech-
ten Ärmel ist
noch ein Rest
von Vergol-
dung. Ebenso
ist die Schrift-
rolle des
Kindes ver-
goldet. Nicht
weniger ge-
fällige und lebhafte Bemalung zeigt der Thron. Der
Untersatz ist gelblich, während die Pföstchen ziegel-
rot und die Lehnen, von den letzteren durch einen
weißen und schwarzen Strich getrennt, dunkelgrün,
ursprünglich jedenfalls hellgrün, gefasst erscheinen.
An den Kapitalen und den Füßen der Pföstchen sind
die Einzelglieder sorgfältig mit Farbe zum Ausdruck
gebracht.
Das Material der Skulptur, das durch die Zeit
gar nicht gelitten hat, wohl infolge des Schutzes durch
■die Kreideschicht und Farbe, ist Lindenholz. Die
Rechte und linke Übereckansicht,
Größe beträgt einschließlich der Krone nur 12]/2 cm
— schon durch die Kleinheit des Maßes verdient
unser Figürchen besonderes Interesse. Trotz der
Kleinheit ist auf die Ausführung und Durchbildung
liebevolle Sorgfalt verwendet. Das kleine Werk ist
in wirklicher Größe nebenstehend von verschiedenen
Seiten abgebildet und die nach einem Aquarell des
Herrn Professor F. Geiges hergestellte Tafel zeigt es
in etwas vergrößerter Nachbildung mit der farbigen
Bemalung.
Gehen wir
nun an die
Lösung der
Frage nach
seiner Ent-
stehungszeit,
so finden wir
als Gesamt-
auffassung
diejenige,
welche seit
dem frühen
Mittelalter bis
zum Eintritt
der gotischen
Epoche vor-
herrschend
in Übung
war1. Es ist
der Typ der
byzantini-
schen Niko-
poia2.
1 Die Gruppe
hat sich als selb-
ständiges Motiv
wohl allmählich
von der Darstel-
lung der Anbe-
tung der Könige
losgelöst. Ein
spätes Beispiel
dieser Verbin-
dung haben wir
an der Goldenen
Pforte des Domes zu Freiberg. Sie klingt selbst noch nach an
unserem gotischen Freiburger Münster, wenngleich hier die
Madonna mit dem Kind stehend dargestellt ist.
3 In Rohault de Fleurys Werk „La Sainte Vierge" sind
zahlreiche Beispiele von Mariendarstellungen aus dem 9. bis
zum 13. Jahrhundert abgebildet. Die meiste Verwandtschaft mit
unserem Bildwerk weisen auf: eine Elfenbeinstatuette im Musée
Cluny, 10. Jahrhundert (Rohault de Fleury Taf. CXIX); die Ma-
donna vom rechtsseitigen Portal der Westfassade der Kathedrale
von Chartres (Taf. CXXII); eine Figur des Cabinet Pichon in
Paris (Taf. CXXVI1I); eine Statuette des Musée Cluny aus dem
11. bis 12. Jahrhundert (Taf. CXXXII). Auch die Madonnenstatue
über dem für unser Münster so wichtigen Portal der Stiftskirche
von St. Ursanne darf beigezogen werden. Eine Zusammen-