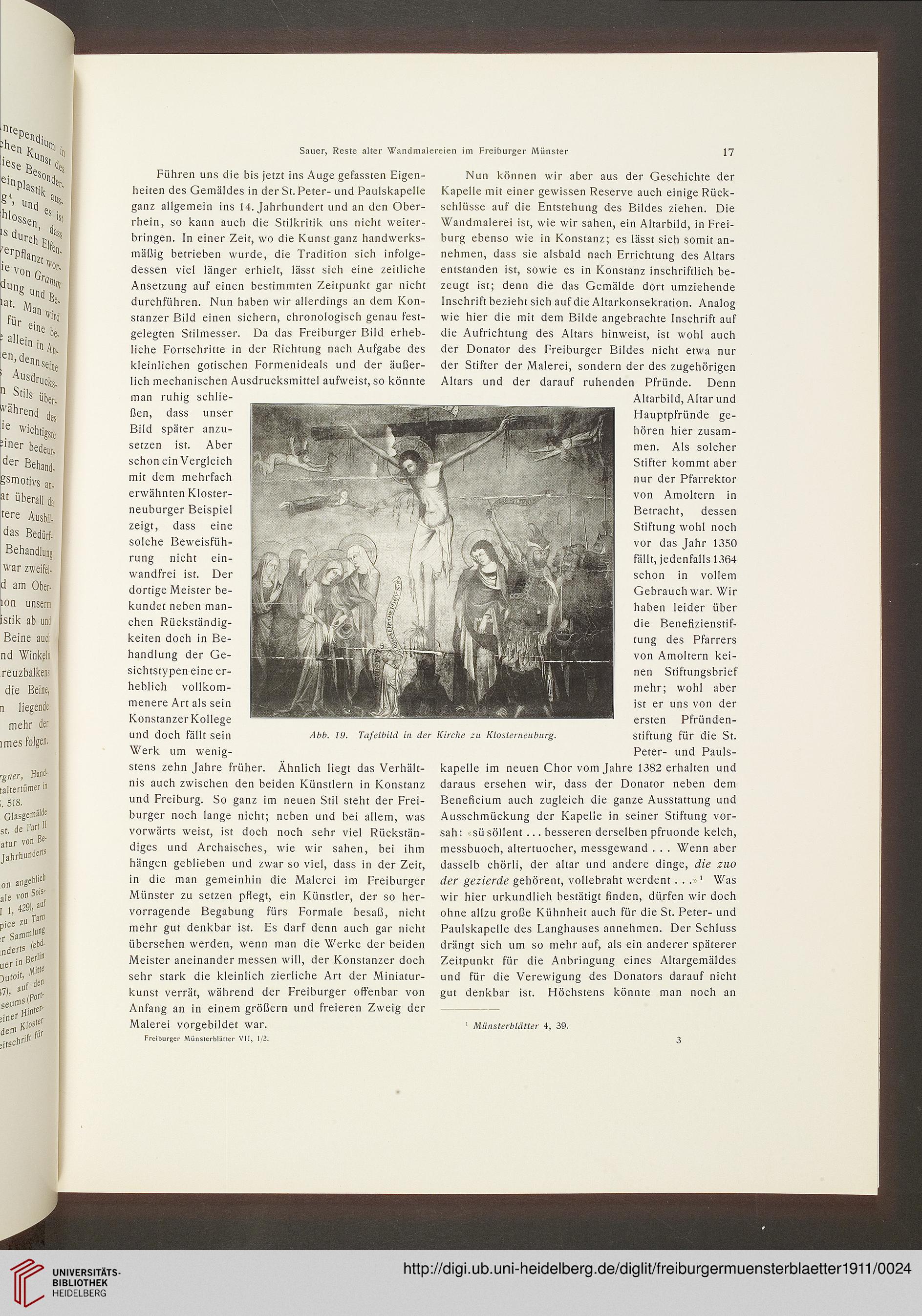&%,
ün$t
Hi
■eso
%.
ei"PlaStik
ist
nie-
'°ssen
15 d^h'E>
ievon>r-
VS
:aIlei«int:
AusdrUcks.
n Sti^ über,
ehrend des
16 ^richtigste
;iner bedeu,.
der ßehand-
gs™otiys an.
at überall da
tere Ausbil-
das Bediirf-
Behandlung
war Zweifel-
d am Ober- I
ion unserm I
istik ab um |
Beine auc |
nd Winkel« |
reuzbalkens |
die Beine, I
n liegende |
mehr der
ìmesi
Sauer, Reste alter Wandmalereien im Freiburger Münster
17
-gner, Hand-
taltertümer in
;. 518.
Glasgemälde
st.de l'a«"
atur von Be-
Jahrhunderts
on ange*6
ale von S»'5'
, « 429), w
ice ZU i»
Pr S.*«""?
seunislr
„er Hi»tef
der« K f5f
.itSchr<ft
Nun können wir aber aus der Geschichte der
Kapelle mit einer gewissen Reserve auch einige Rück-
schlüsse auf die Entstehung des Bildes ziehen. Die
Wandmalerei ist, wie wir sahen, ein Altarbild, in Frei-
burg ebenso wie in Konstanz; es lässt sich somit an-
nehmen, dass sie alsbald nach Errichtung des Altars
entstanden ist, sowie es in Konstanz inschriftlich be-
zeugt ist; denn die das Gemälde dort umziehende
Inschrift bezieht sich auf die Altarkonsekration. Analog
wie hier die mit dem Bilde angebrachte Inschrift auf
die Aufrichtung des Altars hinweist, ist wohl auch
der Donator des Freiburger Bildes nicht etwa nur
der Stifter der Malerei, sondern der des zugehörigen
Altars und der darauf ruhenden Pfründe. Denn
Altarbild, Altar und
Hauptpfründe ge-
hören hier zusam-
men. Als solcher
Stifter kommt aber
nur der Pfarrektor
von Amoltern in
Betracht, dessen
Stiftung wohl noch
vor das Jahr 1350
fällt, jedenfalls 1364
schon in vollem
Gebrauch war. Wir
haben leider über
die Benefizienstif-
tung des Pfarrers
von Amoltern kei-
nen Stiftungsbrief
mehr; wohl aber
ist er uns von der
ersten Pfründen-
stiftung für die St.
Peter- und Pauls-
stens zehn Jahre früher. Ähnlich liegt das Verhält- kapelle im neuen Chor vom Jahre 1382 erhalten und
nis auch zwischen den beiden Künstlern in Konstanz daraus ersehen wir, dass der Donator neben dem
und Freiburg. So ganz im neuen Stil steht der Frei- Beneficium auch zugleich die ganze Ausstattung und
burger noch lange nicht; neben und bei allem, was Ausschmückung der Kapelle in seiner Stiftung vor-
vorwärts weist, ist doch noch sehr viel Rückstän- sah: <süsöllent ... besseren derselben pfruonde kelch,
diges und Archaisches, wie wir sahen, bei ihm messbuoch, altertuocher, messgewand . . . Wenn aber
hängen geblieben und zwar so viel, dass in der Zeit, dasselb chörli, der altar und andere dinge, die zuo
in die man gemeinhin die Malerei im Freiburger der gezierde gehörent, vollebraht werdent . . -*1 Was
Münster zu setzen pflegt, ein Künstler, der so her- wir hier urkundlich bestätigt finden, dürfen wir doch
vorragende Begabung fürs Formale besaß, nicht ohne allzu große Kühnheit auch für die St. Peter-und
mehr gut denkbar ist. Es darf denn auch gar nicht Paulskapelle des Langhauses annehmen. Der Schluss
übersehen werden, wenn man die Werke der beiden drängt sich um so mehr auf, als ein anderer späterer
Meister aneinander messen will, der Konstanzer doch Zeitpunkt für die Anbringung eines Altargemäldes
sehr stark die kleinlich zierliche Art der Miniatur- und für die Verewigung des Donators darauf nicht
kunst verrät, während der Freiburger offenbar von gut denkbar ist. Höchstens könnte man noch an
Anfang an in einem größern und freieren Zweig der
Malerei vorgebildet war. ' Münsterblätter 4, 39.
Freiburger Münsterblätter VII, 1/2. 3
Führen uns die bis jetzt ins Auge gefassten Eigen-
heiten des Gemäldes in der St. Peter- und Paulskapelle
ganz allgemein ins 14. Jahrhundert und an den Ober-
rhein, so kann auch die Stilkritik uns nicht weiter-
bringen. In einer Zeit, wo die Kunst ganz handwerks-
mäßig betrieben wurde, die Tradition sich infolge-
dessen viel länger erhielt, lässt sich eine zeitliche
Ansetzung auf einen bestimmten Zeitpunkt gar nicht
durchführen. Nun haben wir allerdings an dem Kon-
stanzer Bild einen sichern, chronologisch genau fest-
gelegten Stilmesser. Da das Freiburger Bild erheb-
liche Fortschritte in der Richtung nach Aufgabe des
kleinlichen gotischen Formenideals und der äußer-
lich mechanischen Ausdrucksmittel aufweist, so könnte
man ruhig schlie-
ßen, dass unser
Bild später anzu-
setzen ist. Aber
schon ein Vergleich
mit dem mehrfach
erwähnten Kloster-
neuburger Beispiel
zeigt, dass eine
solche Beweisfüh-
rung nicht ein-
wandfrei ist. Der
dortige Meister be-
kundet neben man-
chen Rückständig-
keiten doch in Be-
handlung der Ge-
sichtstypen eine er-
heblich vollkom-
menere Art als sein
Konstanzer Kollege
und doch fällt sein
Werk um wenig-
Abb. 19. Tafelbild in der Kirche zu Klosterneuburg.
ün$t
Hi
■eso
%.
ei"PlaStik
ist
nie-
'°ssen
15 d^h'E>
ievon>r-
VS
:aIlei«int:
AusdrUcks.
n Sti^ über,
ehrend des
16 ^richtigste
;iner bedeu,.
der ßehand-
gs™otiys an.
at überall da
tere Ausbil-
das Bediirf-
Behandlung
war Zweifel-
d am Ober- I
ion unserm I
istik ab um |
Beine auc |
nd Winkel« |
reuzbalkens |
die Beine, I
n liegende |
mehr der
ìmesi
Sauer, Reste alter Wandmalereien im Freiburger Münster
17
-gner, Hand-
taltertümer in
;. 518.
Glasgemälde
st.de l'a«"
atur von Be-
Jahrhunderts
on ange*6
ale von S»'5'
, « 429), w
ice ZU i»
Pr S.*«""?
seunislr
„er Hi»tef
der« K f5f
.itSchr<ft
Nun können wir aber aus der Geschichte der
Kapelle mit einer gewissen Reserve auch einige Rück-
schlüsse auf die Entstehung des Bildes ziehen. Die
Wandmalerei ist, wie wir sahen, ein Altarbild, in Frei-
burg ebenso wie in Konstanz; es lässt sich somit an-
nehmen, dass sie alsbald nach Errichtung des Altars
entstanden ist, sowie es in Konstanz inschriftlich be-
zeugt ist; denn die das Gemälde dort umziehende
Inschrift bezieht sich auf die Altarkonsekration. Analog
wie hier die mit dem Bilde angebrachte Inschrift auf
die Aufrichtung des Altars hinweist, ist wohl auch
der Donator des Freiburger Bildes nicht etwa nur
der Stifter der Malerei, sondern der des zugehörigen
Altars und der darauf ruhenden Pfründe. Denn
Altarbild, Altar und
Hauptpfründe ge-
hören hier zusam-
men. Als solcher
Stifter kommt aber
nur der Pfarrektor
von Amoltern in
Betracht, dessen
Stiftung wohl noch
vor das Jahr 1350
fällt, jedenfalls 1364
schon in vollem
Gebrauch war. Wir
haben leider über
die Benefizienstif-
tung des Pfarrers
von Amoltern kei-
nen Stiftungsbrief
mehr; wohl aber
ist er uns von der
ersten Pfründen-
stiftung für die St.
Peter- und Pauls-
stens zehn Jahre früher. Ähnlich liegt das Verhält- kapelle im neuen Chor vom Jahre 1382 erhalten und
nis auch zwischen den beiden Künstlern in Konstanz daraus ersehen wir, dass der Donator neben dem
und Freiburg. So ganz im neuen Stil steht der Frei- Beneficium auch zugleich die ganze Ausstattung und
burger noch lange nicht; neben und bei allem, was Ausschmückung der Kapelle in seiner Stiftung vor-
vorwärts weist, ist doch noch sehr viel Rückstän- sah: <süsöllent ... besseren derselben pfruonde kelch,
diges und Archaisches, wie wir sahen, bei ihm messbuoch, altertuocher, messgewand . . . Wenn aber
hängen geblieben und zwar so viel, dass in der Zeit, dasselb chörli, der altar und andere dinge, die zuo
in die man gemeinhin die Malerei im Freiburger der gezierde gehörent, vollebraht werdent . . -*1 Was
Münster zu setzen pflegt, ein Künstler, der so her- wir hier urkundlich bestätigt finden, dürfen wir doch
vorragende Begabung fürs Formale besaß, nicht ohne allzu große Kühnheit auch für die St. Peter-und
mehr gut denkbar ist. Es darf denn auch gar nicht Paulskapelle des Langhauses annehmen. Der Schluss
übersehen werden, wenn man die Werke der beiden drängt sich um so mehr auf, als ein anderer späterer
Meister aneinander messen will, der Konstanzer doch Zeitpunkt für die Anbringung eines Altargemäldes
sehr stark die kleinlich zierliche Art der Miniatur- und für die Verewigung des Donators darauf nicht
kunst verrät, während der Freiburger offenbar von gut denkbar ist. Höchstens könnte man noch an
Anfang an in einem größern und freieren Zweig der
Malerei vorgebildet war. ' Münsterblätter 4, 39.
Freiburger Münsterblätter VII, 1/2. 3
Führen uns die bis jetzt ins Auge gefassten Eigen-
heiten des Gemäldes in der St. Peter- und Paulskapelle
ganz allgemein ins 14. Jahrhundert und an den Ober-
rhein, so kann auch die Stilkritik uns nicht weiter-
bringen. In einer Zeit, wo die Kunst ganz handwerks-
mäßig betrieben wurde, die Tradition sich infolge-
dessen viel länger erhielt, lässt sich eine zeitliche
Ansetzung auf einen bestimmten Zeitpunkt gar nicht
durchführen. Nun haben wir allerdings an dem Kon-
stanzer Bild einen sichern, chronologisch genau fest-
gelegten Stilmesser. Da das Freiburger Bild erheb-
liche Fortschritte in der Richtung nach Aufgabe des
kleinlichen gotischen Formenideals und der äußer-
lich mechanischen Ausdrucksmittel aufweist, so könnte
man ruhig schlie-
ßen, dass unser
Bild später anzu-
setzen ist. Aber
schon ein Vergleich
mit dem mehrfach
erwähnten Kloster-
neuburger Beispiel
zeigt, dass eine
solche Beweisfüh-
rung nicht ein-
wandfrei ist. Der
dortige Meister be-
kundet neben man-
chen Rückständig-
keiten doch in Be-
handlung der Ge-
sichtstypen eine er-
heblich vollkom-
menere Art als sein
Konstanzer Kollege
und doch fällt sein
Werk um wenig-
Abb. 19. Tafelbild in der Kirche zu Klosterneuburg.