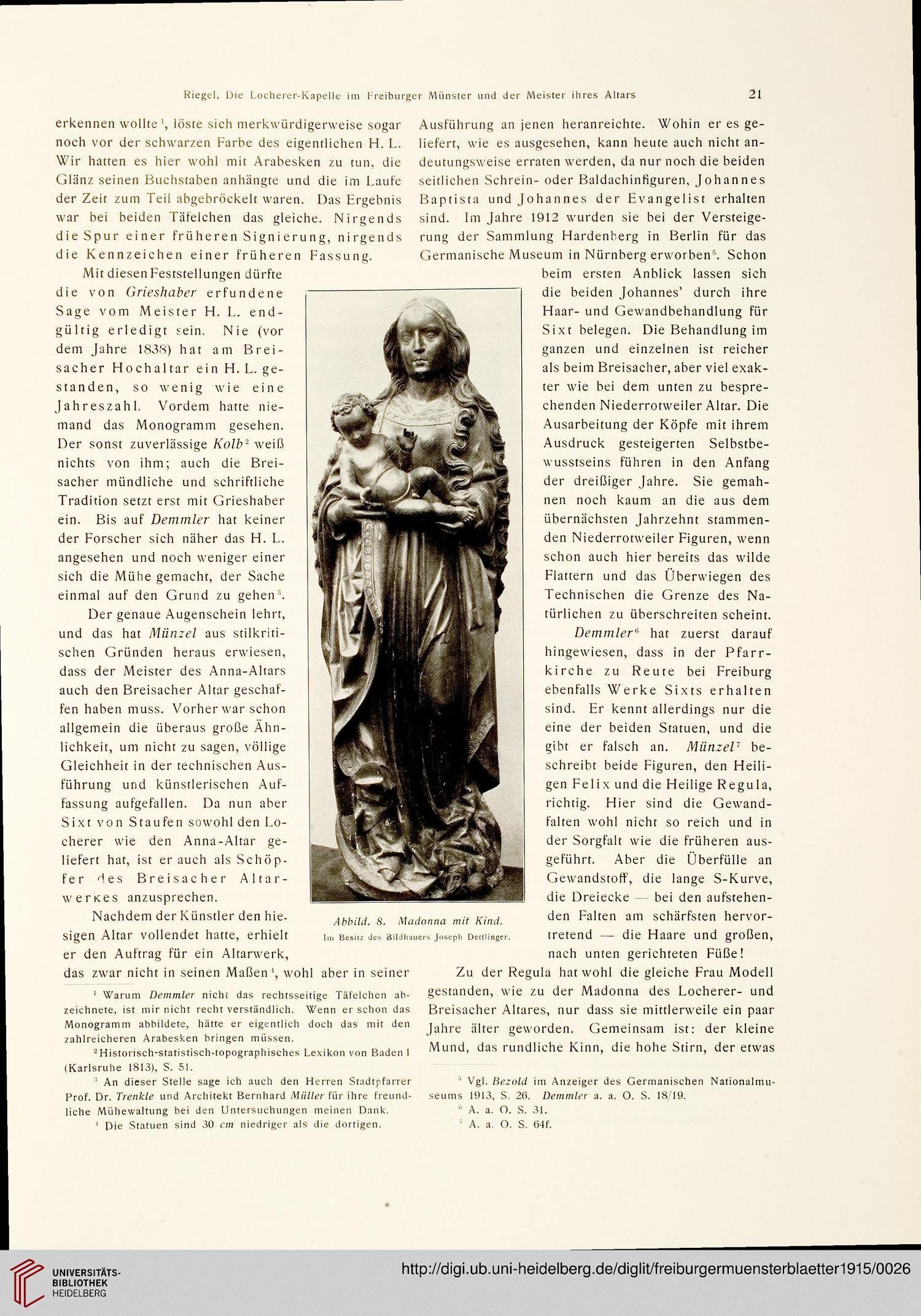Riegel, Die Locherer-Kapelle im Freiburger Münster und der Meister ihres Altars
21
erkennen wollte', löste sich merkwürdigerweise sogar Ausführung an jenen heranreichte. Wohin er es ge-
noch vor der schwarzen Farbe des eigentlichen H. L. liefert, wie es ausgesehen, kann heute auch nicht an-
Wir hatten es hier wohl mit Arabesken zu tun, die deutungsweise erraten werden, da nur noch die beiden
Glänz seinen Buchstaben anhängte und die im Laufe seitlichen Schrein- oder Baldachinfiguren, Johannes
der Zeit zum Teil abgebröckelt waren. Das Ergebnis Baptista und Johannes der Evangelist erhalten
war bei beiden Täfelchen das gleiche. Nirgends sind. Im Jahre 1912 wurden sie bei der Versteige-
die Spur einer früheren Signierung, nirgends rung der Sammlung Hardenberg in Berlin für das
die Kennzeichen einer früheren Fassung. Germanische Museum in Nürnberg erworben5. Schon
Mit diesenFeststellungen dürfte
die von Grieshaber erfundene
Sage vom Meister H. L. end-
gültig erledigt sein. Nie (vor
dem Jahre 1838) hat am Brei-
sacher Hochaltar ein H. L. ge-
standen, so wenig wie eine
Jahreszahl. Vordem hatte nie-
mand das Monogramm gesehen.
Der sonst zuverlässige Kolb'2 weiß
nichts von ihm; auch die Brei-
sacher mündliche und schriftliche
Tradition setzt erst mit Grieshaber
ein. Bis auf Demmler hat keiner
der Forscher sich näher das H. L.
angesehen und noch weniger einer
sich die Mühe gemacht, der Sache
einmal auf den Grund zu gehen3.
Der genaue Augenschein lehrt,
und das hat Münzel aus stilkriti-
schen Gründen heraus erwiesen,
dass der Meister des Anna-Altars
auch den Breisacher Altar geschaf-
fen haben muss. Vorher war schon
allgemein die überaus große Ähn-
lichkeit, um nicht zu sagen, völlige
Gleichheit in der technischen Aus-
führung und künstlerischen Auf-
fassung aufgefallen. Da nun aber
Sixt von Staufen sowohl den Lo-
cherer wie den Anna-Altar ge-
liefert hat, ist er auch als Schöp-
fer des Breisacher Altar-
werKes anzusprechen.
Nachdem der Künstler den hie-
sigen Altar vollendet hatte, erhielt
er den Auftrag für ein Altarwerk,
das zwar nicht in seinen Maßen ', wohl aber in seiner
1 Warum Demmler nicht das rechtsseitige Täfelchen ab-
zeichnete, ist mir nicht recht verständlieh. Wenn er schon das
Monogramm abbildete, hätte er eigentlich doch das mit den
zahlreicheren Arabesken bringen müssen.
2Historisch-statistisch-topographisches Lexikon von Baden 1
(Karlsruhe 1813), S. 51.
:! An dieser Stelle sage ich auch den Herren Stadtpfarrer
Prof. Dr. Trenkle und Architekt Bernhard Müller für ihre freund-
liche Mühewaltung bei den Untersuchungen meinen Dank.
' Die Statuen sind 30 cm niedriger als die dortigen.
Abbild. 8. Madonna mit Kind.
Im Besitz des Bildhauers Joseph Deitlinger,
beim ersten Anblick lassen sich
die beiden Johannes' durch ihre
Haar- und Gewandbehandlung für
Sixt belegen. Die Behandlung im
ganzen und einzelnen ist reicher
als beim Breisacher, aber viel exak-
ter wie bei dem unten zu bespre-
chenden Niederrotweiler Altar. Die
Ausarbeitung der Köpfe mit ihrem
Ausdruck gesteigerten Selbstbe-
wusstseins führen in den Anfang
der dreißiger Jahre. Sie gemah-
nen noch kaum an die aus dem
übernächsten Jahrzehnt stammen-
den Niederrotweiler Figuren, wenn
schon auch hier bereits das wilde
Flattern und das Überwiegen des
Technischen die Grenze des Na-
türlichen zu überschreiten scheint.
Demmler'' hat zuerst darauf
hingewiesen, dass in der Pfarr-
kirche zu Reute bei Freiburg
ebenfalls Werke Sixts erhalten
sind. Er kennt allerdings nur die
eine der beiden Statuen, und die
gibt er falsch an. Münzel7 be-
schreibt beide Figuren, den Heili-
gen Felix und die Heilige Regula,
richtig. Hier sind die Gewand-
falten wohl nicht so reich und in
der Sorgfalt wie die früheren aus-
geführt. Aber die Überfülle an
Gewandstoff, die lange S-Kurve,
die Dreiecke — bei den aufstehen-
den Falten am schärfsten hervor-
tretend — die Haare und großen,
nach unten gerichteten Füße!
Zu der Regula hat wohl die gleiche Frau Modell
gestanden, wie zu der Madonna des Locherer- und
Breisacher Altares, nur dass sie mittlerweile ein paar
Jahre älter geworden. Gemeinsam ist: der kleine
Mund, das rundliche Kinn, die hohe Stirn, der etwas
' Vgl. Bezold im Anzeiger des Germanischen Nationalmu-
seums 1913, S, 26. Demmler a. a. O. S. 1819.
" A. a. O. S. 31.
; A. a. O. S. 64f.
21
erkennen wollte', löste sich merkwürdigerweise sogar Ausführung an jenen heranreichte. Wohin er es ge-
noch vor der schwarzen Farbe des eigentlichen H. L. liefert, wie es ausgesehen, kann heute auch nicht an-
Wir hatten es hier wohl mit Arabesken zu tun, die deutungsweise erraten werden, da nur noch die beiden
Glänz seinen Buchstaben anhängte und die im Laufe seitlichen Schrein- oder Baldachinfiguren, Johannes
der Zeit zum Teil abgebröckelt waren. Das Ergebnis Baptista und Johannes der Evangelist erhalten
war bei beiden Täfelchen das gleiche. Nirgends sind. Im Jahre 1912 wurden sie bei der Versteige-
die Spur einer früheren Signierung, nirgends rung der Sammlung Hardenberg in Berlin für das
die Kennzeichen einer früheren Fassung. Germanische Museum in Nürnberg erworben5. Schon
Mit diesenFeststellungen dürfte
die von Grieshaber erfundene
Sage vom Meister H. L. end-
gültig erledigt sein. Nie (vor
dem Jahre 1838) hat am Brei-
sacher Hochaltar ein H. L. ge-
standen, so wenig wie eine
Jahreszahl. Vordem hatte nie-
mand das Monogramm gesehen.
Der sonst zuverlässige Kolb'2 weiß
nichts von ihm; auch die Brei-
sacher mündliche und schriftliche
Tradition setzt erst mit Grieshaber
ein. Bis auf Demmler hat keiner
der Forscher sich näher das H. L.
angesehen und noch weniger einer
sich die Mühe gemacht, der Sache
einmal auf den Grund zu gehen3.
Der genaue Augenschein lehrt,
und das hat Münzel aus stilkriti-
schen Gründen heraus erwiesen,
dass der Meister des Anna-Altars
auch den Breisacher Altar geschaf-
fen haben muss. Vorher war schon
allgemein die überaus große Ähn-
lichkeit, um nicht zu sagen, völlige
Gleichheit in der technischen Aus-
führung und künstlerischen Auf-
fassung aufgefallen. Da nun aber
Sixt von Staufen sowohl den Lo-
cherer wie den Anna-Altar ge-
liefert hat, ist er auch als Schöp-
fer des Breisacher Altar-
werKes anzusprechen.
Nachdem der Künstler den hie-
sigen Altar vollendet hatte, erhielt
er den Auftrag für ein Altarwerk,
das zwar nicht in seinen Maßen ', wohl aber in seiner
1 Warum Demmler nicht das rechtsseitige Täfelchen ab-
zeichnete, ist mir nicht recht verständlieh. Wenn er schon das
Monogramm abbildete, hätte er eigentlich doch das mit den
zahlreicheren Arabesken bringen müssen.
2Historisch-statistisch-topographisches Lexikon von Baden 1
(Karlsruhe 1813), S. 51.
:! An dieser Stelle sage ich auch den Herren Stadtpfarrer
Prof. Dr. Trenkle und Architekt Bernhard Müller für ihre freund-
liche Mühewaltung bei den Untersuchungen meinen Dank.
' Die Statuen sind 30 cm niedriger als die dortigen.
Abbild. 8. Madonna mit Kind.
Im Besitz des Bildhauers Joseph Deitlinger,
beim ersten Anblick lassen sich
die beiden Johannes' durch ihre
Haar- und Gewandbehandlung für
Sixt belegen. Die Behandlung im
ganzen und einzelnen ist reicher
als beim Breisacher, aber viel exak-
ter wie bei dem unten zu bespre-
chenden Niederrotweiler Altar. Die
Ausarbeitung der Köpfe mit ihrem
Ausdruck gesteigerten Selbstbe-
wusstseins führen in den Anfang
der dreißiger Jahre. Sie gemah-
nen noch kaum an die aus dem
übernächsten Jahrzehnt stammen-
den Niederrotweiler Figuren, wenn
schon auch hier bereits das wilde
Flattern und das Überwiegen des
Technischen die Grenze des Na-
türlichen zu überschreiten scheint.
Demmler'' hat zuerst darauf
hingewiesen, dass in der Pfarr-
kirche zu Reute bei Freiburg
ebenfalls Werke Sixts erhalten
sind. Er kennt allerdings nur die
eine der beiden Statuen, und die
gibt er falsch an. Münzel7 be-
schreibt beide Figuren, den Heili-
gen Felix und die Heilige Regula,
richtig. Hier sind die Gewand-
falten wohl nicht so reich und in
der Sorgfalt wie die früheren aus-
geführt. Aber die Überfülle an
Gewandstoff, die lange S-Kurve,
die Dreiecke — bei den aufstehen-
den Falten am schärfsten hervor-
tretend — die Haare und großen,
nach unten gerichteten Füße!
Zu der Regula hat wohl die gleiche Frau Modell
gestanden, wie zu der Madonna des Locherer- und
Breisacher Altares, nur dass sie mittlerweile ein paar
Jahre älter geworden. Gemeinsam ist: der kleine
Mund, das rundliche Kinn, die hohe Stirn, der etwas
' Vgl. Bezold im Anzeiger des Germanischen Nationalmu-
seums 1913, S, 26. Demmler a. a. O. S. 1819.
" A. a. O. S. 31.
; A. a. O. S. 64f.