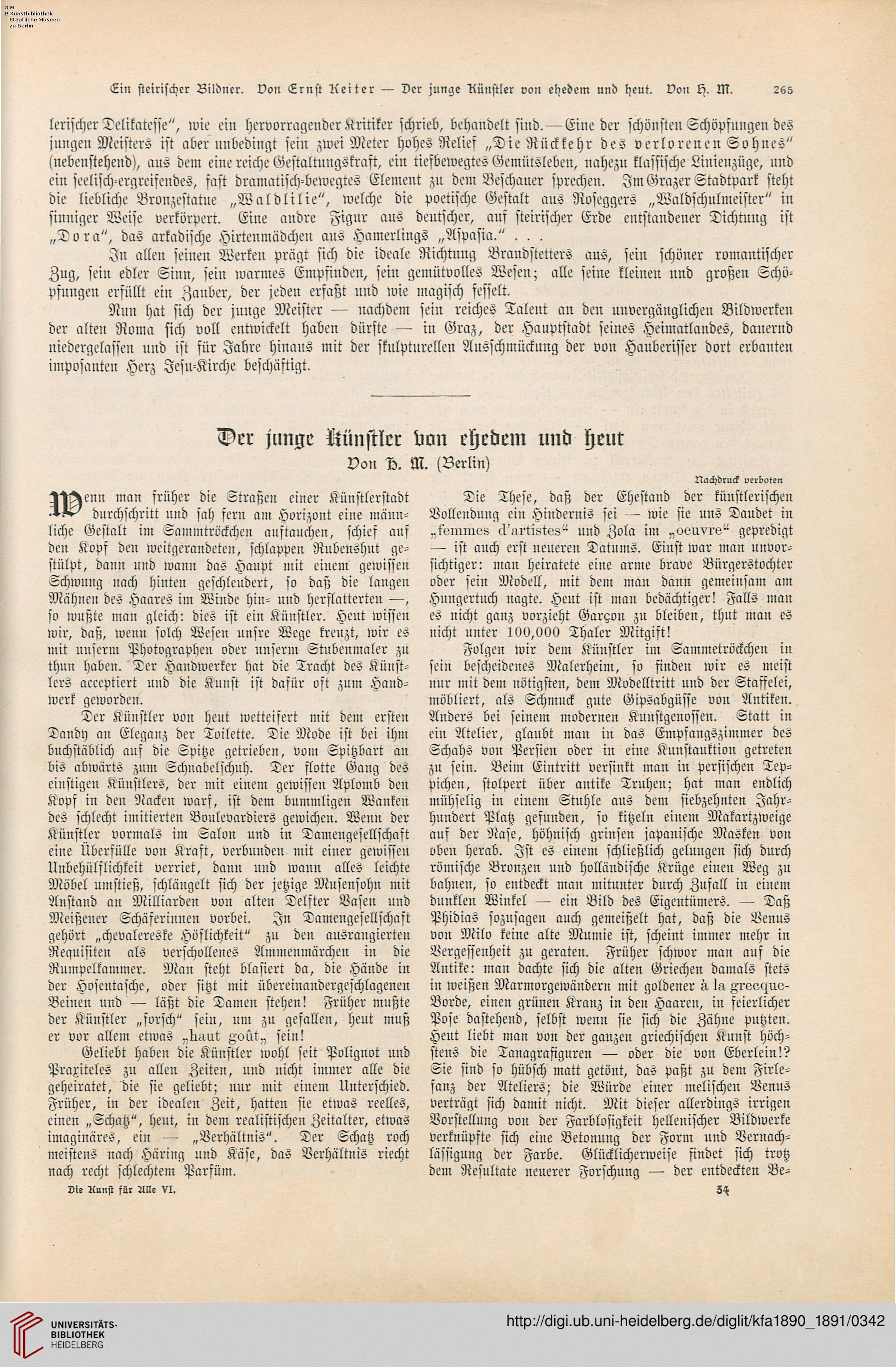Lin steirischer Bildner, von Ernst Reiter — Der junge Riinstler von ehedem und heut, von ki. M.
265
lyrischer Delikatesse", wie ein hervorragender Kritiker schrieb, behandelt sind. — Eine der schönsten Schöpfungen des
jungen Meisters ist aber unbedingt sein zwei Meter hohes Relief „Die Rückkehr des verlorenen Sohnes"
(nebenstehend), aus dem eine reiche Gestaltungskraft, ein tiefbewegtes Gemütsleben, nahezu klassische Linienzüge, und
ein seelisch-ergreifendes, fast dramatisch-bewegtes Element zu dem Beschauer sprechen. Im Grazer Stadtpark steht
die liebliche Bronzestatue „Waldlilie", welche die poetische Gestalt aus Roseggers „Waldschulmeister" in
sinniger Weise verkörpert. Eine andre Figur aus deutscher, aus steirischer Erde entstandener Dichtung ist
„Dora", das arkadische Hirtenmädchen aus Hamerlings „Aspasia." . . .
In allen seinen Werken prägt sich die ideale Richtung Brandstetters aus, sein schöner romantischer
Zug, sein edler Sinn, sein warmes Empfinden, sein gemütvolles Wesen; alle seine kleinen nnd großen Schö-
pfungen erfüllt ein Zauber, der jeden erfaßt und wie magisch fesselt.
Nun hat sich der junge Meister — nachdem sein reiches Talent an den unvergänglichen Bildwerken
der alten Roma sich voll entwickelt haben dürste — in Graz, der Hauptstadt seines Heimatlandes, dauernd
niedergelassen und ist für Jabre hinaus mit der skulpturellen Ausschmückung der von Hauberisser dort erbanten
imposanten Herz Jesu-Kirche beschäftigt.
Der junge Künstler von ehedem und heut
von D. M. (Berlin)
enn man früher die Straßen einer Künstlerstadt
durchschritt und sah fern am Horizont eine männ-
liche Gestalt im Sammtröckchen auftauchen, schief ans
den Kopf den weitgerandeten, schlappen Rubenshut ge-
stülpt, dann und wann das Haupt mit einem gewissen
Schwung nach hinten geschleudert, so daß die langen
Mähnen des Haares im Winde hin- und herflatterten —,
so wußte mau gleich: dies ist ein Künstler. Heut wissen
wir, daß, wenn solch Wesen unsre Wege kreuzt, wir es
mit unscrm Photographen oder unserm Stubenmaler zu
thun haben. Ter Handwerker hat die Tracht des Künst-
lers acceptiert und die Kunst ist dafür oft zum Hand-
werk geworden.
Der Künstler von heut wetteifert mit dem ersten
Tandy an Eleganz der Toilette. Tie Mode ist bei ihm
buchstäblich auf die Spitze getrieben, vom Spitzbart an
bis abwärts zum Schnabelschuh. Ter flotte Gang des
einstigen Künstlers, der mit einem gewissen Aplomb den
Kopf in den Nacken warf, ist dem bummligen Wanken
des schlecht imitierten Boulevardiers gewichen. Wenn der
Künstler vormals im Salon und in Tamengesellschaft
eine Überfülle von Kraft, verbunden mit einer gewissen
llnbehülflichkeit verriet, dann und wann alles leichte
Möbel umstieß, schlängelt sich der jetzige Musensohn mit
Anstand an Milliarden von alten Delfter Vasen und
Meißener Schäferinnen vorbei. In Tamengesellschaft
gehört „chevalereske Höflichkeit" zu den ausrangierten
Requisiten als verschollenes Ammenmärchen in die
Rumpelkammer. Man steht blasiert da, die Hände in
der Hosentasche, oder sitzt mit übereinandergeschlagenen
Beinen und — läßt die Damen stehen! Früher mußte
der Künstler „forsch" sein, um zu gefallen, heut muß
er vor allem etwas „Kaut sein!
Geliebt haben die Künstler wohl seit Polignot und
Praxiteles zu allen Zeiten, und nicht immer alle die
geheiratet, die sie geliebt; nur mit einem Unterschied.
Früher, in der idealen Zeit, hatten sie etwas reelles,
einen „Schatz", heut, in dem realistischen Zeitalter, etwas
imaginäres, ein — „Verhältnis". Der Schatz roch
meistens nach Häring und Käse, das Verhältnis riecht
nach recht schlechtem Parfüm.
Die Allnst fstr Alle VI.
Die These, daß der Ehestand der künstlerischen
Vollendung ein Hindernis sei — wie sie uns Daudet in
Z'siniuos ck'artistes^ und Zola im „oeuvro^ gepredigt
— ist auch erst neueren Datums. Einst war man unvor-
sichtiger: man heiratete eine arme brave Bürgerstochter
oder sein Modell, mit dem man dann gemeinsam am
Hungertuch nagte. Heut ist man bedächtiger! Falls man
es nicht ganz vorzieht Garqon zu bleiben, thut man es
nicht unter 100,000 Thaler Mitgift!
Folgen wir dem Künstler im Sammetröckchen in
sein bescheidenes Malerheim, so finden wir es meist
nur mit dem nötigsten, dem Modelltritt und der Staffelei,
möbliert, als Schmuck gute Gipsabgüsse von Antiken.
Anders bei seinem modernen Kunstgenossen. Statt in
ein Atelier, glaubt man in das Empfangszimmer des
Schahs von Persien oder in eine Kunstauktion getreten
zu sein. Beim Eintritt versinkt man in persischen Tep-
pichen, stolpert über antike Truhen; hat man endlich
mühselig in einem Stuhle aus dem siebzehnten Jahr-
hundert Platz gefunden, so kitzeln einem Makartzweige
auf der Nase, höhnisch grinsen japanische Masken von
oben herab. Ist es einem schließlich gelungen sich durch
römische Bronzen und holländische Krüge einen Weg zu
bahnen, so entdeckt man mitunter durch Zufall in einem
dunklen Winkel — ein Bild des Eigentümers. —- Daß
Phidias sozusagen auch gemeißelt hat, daß die Venus
von Milo keine alte Mumie ist, scheint immer mehr in
Vergessenheit zu geraten. Früher schwor man auf die
Antike: man dachte sich die alten Griechen damals stets
in weißen Marmorgewändern mit goldener ü la Freegus-
Borde, einen grünen Kranz in den Haaren, in feierlicher
Pose dastehend, selbst wenn sie sich die Zähne putzten.
Heut liebt man von der ganzen griechischen Kunst höch-
stens die Tanagrafiguren — oder die von Eberlein!?
Sie sind so hübsch matt getönt, das paßt zu dem Firle-
fanz der Ateliers; die Würde einer melischen Venus
verträgt sich damit nicht. Mit dieser allerdings irrigen
Vorstellung von der Farblosigkeit hellenischer Bildwerke
verknüpfte sich eine Betonung der Form und Vernach-
lässigung der Farbe. Glücklicherweise findet sich trotz
dem Resultate neuerer Forschung — der entdeckten Be-
2-l
265
lyrischer Delikatesse", wie ein hervorragender Kritiker schrieb, behandelt sind. — Eine der schönsten Schöpfungen des
jungen Meisters ist aber unbedingt sein zwei Meter hohes Relief „Die Rückkehr des verlorenen Sohnes"
(nebenstehend), aus dem eine reiche Gestaltungskraft, ein tiefbewegtes Gemütsleben, nahezu klassische Linienzüge, und
ein seelisch-ergreifendes, fast dramatisch-bewegtes Element zu dem Beschauer sprechen. Im Grazer Stadtpark steht
die liebliche Bronzestatue „Waldlilie", welche die poetische Gestalt aus Roseggers „Waldschulmeister" in
sinniger Weise verkörpert. Eine andre Figur aus deutscher, aus steirischer Erde entstandener Dichtung ist
„Dora", das arkadische Hirtenmädchen aus Hamerlings „Aspasia." . . .
In allen seinen Werken prägt sich die ideale Richtung Brandstetters aus, sein schöner romantischer
Zug, sein edler Sinn, sein warmes Empfinden, sein gemütvolles Wesen; alle seine kleinen nnd großen Schö-
pfungen erfüllt ein Zauber, der jeden erfaßt und wie magisch fesselt.
Nun hat sich der junge Meister — nachdem sein reiches Talent an den unvergänglichen Bildwerken
der alten Roma sich voll entwickelt haben dürste — in Graz, der Hauptstadt seines Heimatlandes, dauernd
niedergelassen und ist für Jabre hinaus mit der skulpturellen Ausschmückung der von Hauberisser dort erbanten
imposanten Herz Jesu-Kirche beschäftigt.
Der junge Künstler von ehedem und heut
von D. M. (Berlin)
enn man früher die Straßen einer Künstlerstadt
durchschritt und sah fern am Horizont eine männ-
liche Gestalt im Sammtröckchen auftauchen, schief ans
den Kopf den weitgerandeten, schlappen Rubenshut ge-
stülpt, dann und wann das Haupt mit einem gewissen
Schwung nach hinten geschleudert, so daß die langen
Mähnen des Haares im Winde hin- und herflatterten —,
so wußte mau gleich: dies ist ein Künstler. Heut wissen
wir, daß, wenn solch Wesen unsre Wege kreuzt, wir es
mit unscrm Photographen oder unserm Stubenmaler zu
thun haben. Ter Handwerker hat die Tracht des Künst-
lers acceptiert und die Kunst ist dafür oft zum Hand-
werk geworden.
Der Künstler von heut wetteifert mit dem ersten
Tandy an Eleganz der Toilette. Tie Mode ist bei ihm
buchstäblich auf die Spitze getrieben, vom Spitzbart an
bis abwärts zum Schnabelschuh. Ter flotte Gang des
einstigen Künstlers, der mit einem gewissen Aplomb den
Kopf in den Nacken warf, ist dem bummligen Wanken
des schlecht imitierten Boulevardiers gewichen. Wenn der
Künstler vormals im Salon und in Tamengesellschaft
eine Überfülle von Kraft, verbunden mit einer gewissen
llnbehülflichkeit verriet, dann und wann alles leichte
Möbel umstieß, schlängelt sich der jetzige Musensohn mit
Anstand an Milliarden von alten Delfter Vasen und
Meißener Schäferinnen vorbei. In Tamengesellschaft
gehört „chevalereske Höflichkeit" zu den ausrangierten
Requisiten als verschollenes Ammenmärchen in die
Rumpelkammer. Man steht blasiert da, die Hände in
der Hosentasche, oder sitzt mit übereinandergeschlagenen
Beinen und — läßt die Damen stehen! Früher mußte
der Künstler „forsch" sein, um zu gefallen, heut muß
er vor allem etwas „Kaut sein!
Geliebt haben die Künstler wohl seit Polignot und
Praxiteles zu allen Zeiten, und nicht immer alle die
geheiratet, die sie geliebt; nur mit einem Unterschied.
Früher, in der idealen Zeit, hatten sie etwas reelles,
einen „Schatz", heut, in dem realistischen Zeitalter, etwas
imaginäres, ein — „Verhältnis". Der Schatz roch
meistens nach Häring und Käse, das Verhältnis riecht
nach recht schlechtem Parfüm.
Die Allnst fstr Alle VI.
Die These, daß der Ehestand der künstlerischen
Vollendung ein Hindernis sei — wie sie uns Daudet in
Z'siniuos ck'artistes^ und Zola im „oeuvro^ gepredigt
— ist auch erst neueren Datums. Einst war man unvor-
sichtiger: man heiratete eine arme brave Bürgerstochter
oder sein Modell, mit dem man dann gemeinsam am
Hungertuch nagte. Heut ist man bedächtiger! Falls man
es nicht ganz vorzieht Garqon zu bleiben, thut man es
nicht unter 100,000 Thaler Mitgift!
Folgen wir dem Künstler im Sammetröckchen in
sein bescheidenes Malerheim, so finden wir es meist
nur mit dem nötigsten, dem Modelltritt und der Staffelei,
möbliert, als Schmuck gute Gipsabgüsse von Antiken.
Anders bei seinem modernen Kunstgenossen. Statt in
ein Atelier, glaubt man in das Empfangszimmer des
Schahs von Persien oder in eine Kunstauktion getreten
zu sein. Beim Eintritt versinkt man in persischen Tep-
pichen, stolpert über antike Truhen; hat man endlich
mühselig in einem Stuhle aus dem siebzehnten Jahr-
hundert Platz gefunden, so kitzeln einem Makartzweige
auf der Nase, höhnisch grinsen japanische Masken von
oben herab. Ist es einem schließlich gelungen sich durch
römische Bronzen und holländische Krüge einen Weg zu
bahnen, so entdeckt man mitunter durch Zufall in einem
dunklen Winkel — ein Bild des Eigentümers. —- Daß
Phidias sozusagen auch gemeißelt hat, daß die Venus
von Milo keine alte Mumie ist, scheint immer mehr in
Vergessenheit zu geraten. Früher schwor man auf die
Antike: man dachte sich die alten Griechen damals stets
in weißen Marmorgewändern mit goldener ü la Freegus-
Borde, einen grünen Kranz in den Haaren, in feierlicher
Pose dastehend, selbst wenn sie sich die Zähne putzten.
Heut liebt man von der ganzen griechischen Kunst höch-
stens die Tanagrafiguren — oder die von Eberlein!?
Sie sind so hübsch matt getönt, das paßt zu dem Firle-
fanz der Ateliers; die Würde einer melischen Venus
verträgt sich damit nicht. Mit dieser allerdings irrigen
Vorstellung von der Farblosigkeit hellenischer Bildwerke
verknüpfte sich eine Betonung der Form und Vernach-
lässigung der Farbe. Glücklicherweise findet sich trotz
dem Resultate neuerer Forschung — der entdeckten Be-
2-l