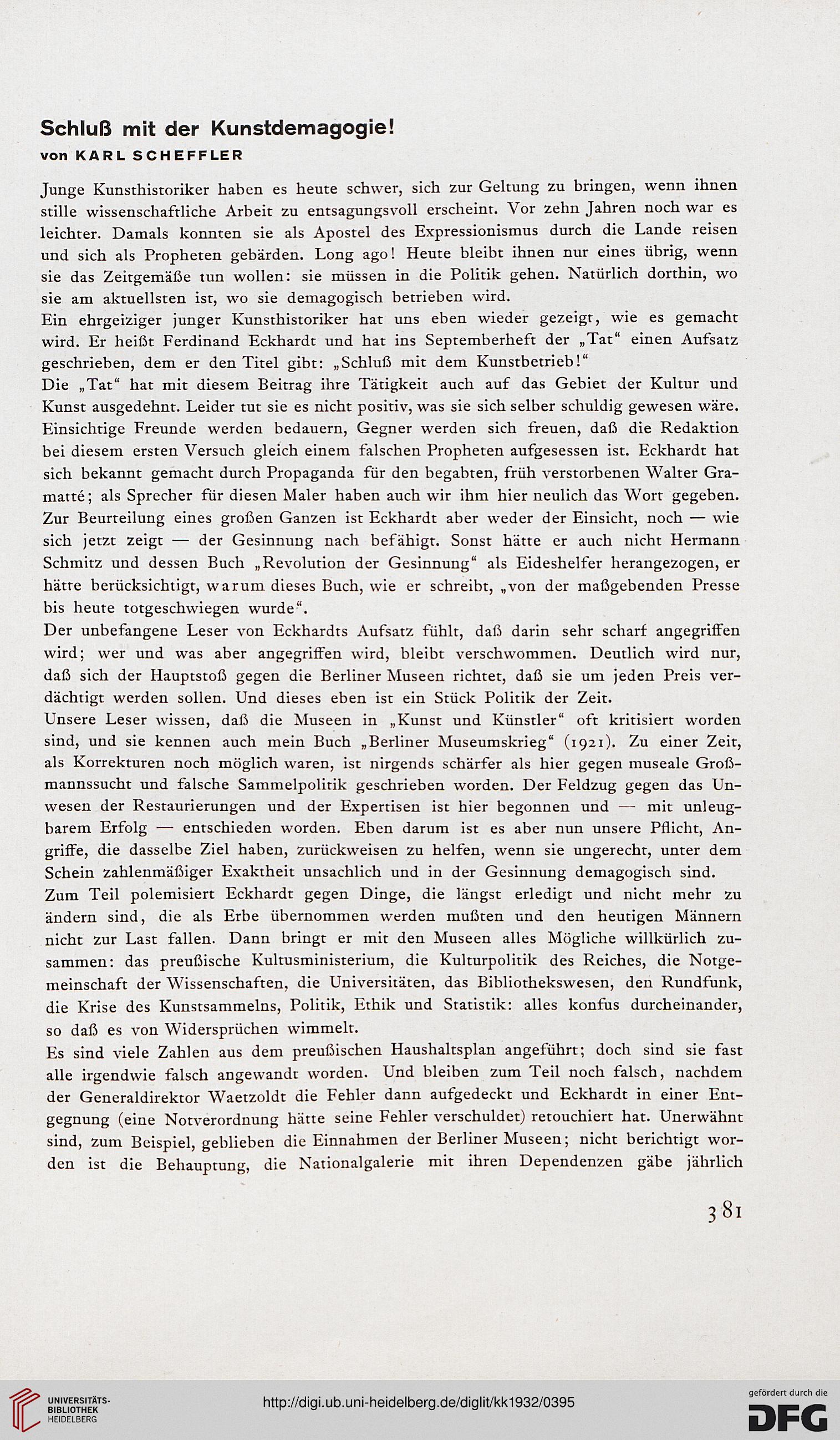Schluß mit der Kunstdemagogie!
von KARL SCHEFFLER
Junge Kunsthistoriker haben es heute schwer, sich zur Geltung zu bringen, wenn ihnen
stille wissenschaftliche Arbeit zu entsagungsvoll erscheint. Vor zehn Jahren noch war es
leichter. Damals konnten sie als Apostel des Expressionismus durch die Lande reisen
und sich als Propheten gebärden. Long ago! Heute bleibt ihnen nur eines übrig, wenn
sie das Zeitgemäße tun wollen: sie müssen in die Politik gehen. Natürlich dorthin, wo
sie am aktuellsten ist, wo sie demagogisch betrieben wird.
Ein ehrgeiziger junger Kunsthistoriker hat uns eben wieder gezeigt, wie es gemacht
wird. Er heißt Ferdinand Eckhardt und hat ins Septemberheft der „Tat" einen Aufsatz
geschrieben, dem er den Titel gibt: „Schluß mit dem Kunstbetrieb!"
Die „Tat" hat mit diesem Beitrag ihre Tätigkeit auch auf das Gebiet der Kultur und
Kunst ausgedehnt. Leider tut sie es nicht positiv, was sie sich selber schuldig gewesen wäre.
Einsichtige Freunde werden bedauern, Gegner werden sich freuen, daß die Redaktion
bei diesem ersten Versuch gleich einem falschen Propheten aufgesessen ist. Eckhardt hat
sich bekannt gemacht durch Propaganda für den begabten, früh verstorbenen Walter Gra-
matte; als Sprecher für diesen Maler haben auch wir ihm hier neulich das Wort gegeben.
Zur Beurteilung eines großen Ganzen ist Eckhardt aber weder der Einsicht, noch — wie
sich jetzt zeigt — der Gesinnung nach befähigt. Sonst hätte er auch nicht Hermann
Schmitz und dessen Buch „Revolution der Gesinnung" als Eideshelfer herangezogen, er
hätte berücksichtigt, warum dieses Buch, wie er schreibt, „von der maßgebenden Presse
bis heute totgeschwiegen wurde".
Der unbefangene Leser von Eckhardts Aufsatz fühlt, daß darin sehr scharf angegriffen
wird; wer und was aber angegriffen wird, bleibt verschwommen. Deutlich wird nur,
daß sich der Hauptstoß gegen die Berliner Museen richtet, daß sie um jeden Preis ver-
dächtigt werden sollen. Und dieses eben ist ein Stück Politik der Zeit.
Unsere Leser wissen, daß die Museen in „Kunst und Künstler" oft kritisiert worden
sind, und sie kennen auch mein Buch „Berliner Museumskrieg" (1921). Zu einer Zeit,
als Korrekturen noch möglich waren, ist nirgends schärfer als hier gegen museale Groß-
mannssucht und falsche Sammelpolitik geschrieben worden. Der Feldzug gegen das Un-
wesen der Restaurierungen und der Expertisen ist hier begonnen und — mit unleug-
barem Erfolg — entschieden worden. Eben darum ist es aber nun unsere Pflicht, An-
griffe, die dasselbe Ziel haben, zurückweisen zu helfen, wenn sie ungerecht, unter dem
Schein zahlenmäßiger Exaktheit unsachlich und in der Gesinnung demagogisch sind.
Zum Teil polemisiert Eckhardt gegen Dinge, die längst erledigt und nicht mehr zu
ändern sind, die als Erbe übernommen werden mußten und den heutigen Männern
nicht zur Last fallen. Dann bringt er mit den Museen alles Mögliche willkürlich zu-
sammen: das preußische Kultusministerium, die Kulturpolitik des Reiches, die Notge-
meinschaft der Wissenschaften, die Universitäten, das Bibliothekswesen, den Rundfunk,
die Krise des Kunstsammelns, Politik, Ethik und Statistik: alles konfus durcheinander,
so daß es von Widersprüchen wimmelt.
Es sind viele Zahlen aus dem preußischen Haushaltsplan angeführt; doch sind sie fast
alle irgendwie falsch angewandt worden. Und bleiben zum Teil noch falsch, nachdem
der Generaldirektor Waetzoldt die Fehler dann aufgedeckt und Eckhardt in einer Ent-
gegnung (eine Notverordnung hätte seine Fehler verschuldet) retouchiert hat. Unerwähnt
sind, zum Beispiel, geblieben die Einnahmen der Berliner Museen; nicht berichtigt wor-
den ist die Behauptung, die Nationalgalerie mit ihren Dependenzen gäbe jährlich
381
von KARL SCHEFFLER
Junge Kunsthistoriker haben es heute schwer, sich zur Geltung zu bringen, wenn ihnen
stille wissenschaftliche Arbeit zu entsagungsvoll erscheint. Vor zehn Jahren noch war es
leichter. Damals konnten sie als Apostel des Expressionismus durch die Lande reisen
und sich als Propheten gebärden. Long ago! Heute bleibt ihnen nur eines übrig, wenn
sie das Zeitgemäße tun wollen: sie müssen in die Politik gehen. Natürlich dorthin, wo
sie am aktuellsten ist, wo sie demagogisch betrieben wird.
Ein ehrgeiziger junger Kunsthistoriker hat uns eben wieder gezeigt, wie es gemacht
wird. Er heißt Ferdinand Eckhardt und hat ins Septemberheft der „Tat" einen Aufsatz
geschrieben, dem er den Titel gibt: „Schluß mit dem Kunstbetrieb!"
Die „Tat" hat mit diesem Beitrag ihre Tätigkeit auch auf das Gebiet der Kultur und
Kunst ausgedehnt. Leider tut sie es nicht positiv, was sie sich selber schuldig gewesen wäre.
Einsichtige Freunde werden bedauern, Gegner werden sich freuen, daß die Redaktion
bei diesem ersten Versuch gleich einem falschen Propheten aufgesessen ist. Eckhardt hat
sich bekannt gemacht durch Propaganda für den begabten, früh verstorbenen Walter Gra-
matte; als Sprecher für diesen Maler haben auch wir ihm hier neulich das Wort gegeben.
Zur Beurteilung eines großen Ganzen ist Eckhardt aber weder der Einsicht, noch — wie
sich jetzt zeigt — der Gesinnung nach befähigt. Sonst hätte er auch nicht Hermann
Schmitz und dessen Buch „Revolution der Gesinnung" als Eideshelfer herangezogen, er
hätte berücksichtigt, warum dieses Buch, wie er schreibt, „von der maßgebenden Presse
bis heute totgeschwiegen wurde".
Der unbefangene Leser von Eckhardts Aufsatz fühlt, daß darin sehr scharf angegriffen
wird; wer und was aber angegriffen wird, bleibt verschwommen. Deutlich wird nur,
daß sich der Hauptstoß gegen die Berliner Museen richtet, daß sie um jeden Preis ver-
dächtigt werden sollen. Und dieses eben ist ein Stück Politik der Zeit.
Unsere Leser wissen, daß die Museen in „Kunst und Künstler" oft kritisiert worden
sind, und sie kennen auch mein Buch „Berliner Museumskrieg" (1921). Zu einer Zeit,
als Korrekturen noch möglich waren, ist nirgends schärfer als hier gegen museale Groß-
mannssucht und falsche Sammelpolitik geschrieben worden. Der Feldzug gegen das Un-
wesen der Restaurierungen und der Expertisen ist hier begonnen und — mit unleug-
barem Erfolg — entschieden worden. Eben darum ist es aber nun unsere Pflicht, An-
griffe, die dasselbe Ziel haben, zurückweisen zu helfen, wenn sie ungerecht, unter dem
Schein zahlenmäßiger Exaktheit unsachlich und in der Gesinnung demagogisch sind.
Zum Teil polemisiert Eckhardt gegen Dinge, die längst erledigt und nicht mehr zu
ändern sind, die als Erbe übernommen werden mußten und den heutigen Männern
nicht zur Last fallen. Dann bringt er mit den Museen alles Mögliche willkürlich zu-
sammen: das preußische Kultusministerium, die Kulturpolitik des Reiches, die Notge-
meinschaft der Wissenschaften, die Universitäten, das Bibliothekswesen, den Rundfunk,
die Krise des Kunstsammelns, Politik, Ethik und Statistik: alles konfus durcheinander,
so daß es von Widersprüchen wimmelt.
Es sind viele Zahlen aus dem preußischen Haushaltsplan angeführt; doch sind sie fast
alle irgendwie falsch angewandt worden. Und bleiben zum Teil noch falsch, nachdem
der Generaldirektor Waetzoldt die Fehler dann aufgedeckt und Eckhardt in einer Ent-
gegnung (eine Notverordnung hätte seine Fehler verschuldet) retouchiert hat. Unerwähnt
sind, zum Beispiel, geblieben die Einnahmen der Berliner Museen; nicht berichtigt wor-
den ist die Behauptung, die Nationalgalerie mit ihren Dependenzen gäbe jährlich
381