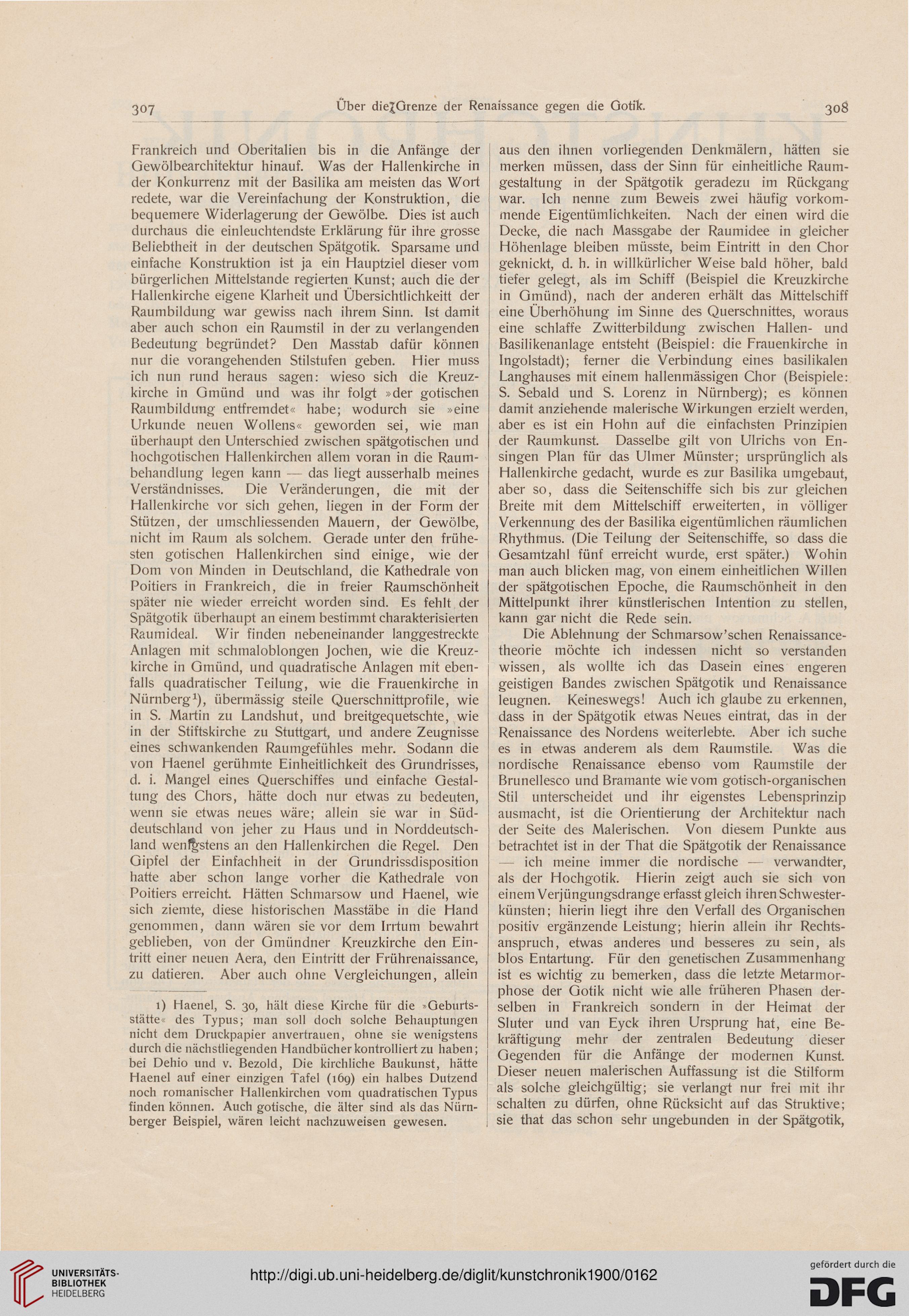307
Über diejGrenze der Renaissance gegen die Ootik.
Frankreich und Oberitalien bis in die Anfänge der
Gewölbearchitektur hinauf. Was der Hallenkirche in
der Konkurrenz mit der Basilika am meisten das Wort
redete, war die Vereinfachung der Konstruktion, die
bequemere Widerlagerung der Gewölbe. Dies ist auch
durchaus die einleuchtendste Erklärung für ihre grosse
Beliebtheit in der deutschen Spätgotik. Sparsame und
einfache Konstruktion ist ja ein Hauptziel dieser vom
bürgerlichen Mittelstande regierten Kunst; auch die der
Hallenkirche eigene Klarheit und Übersichtlichkeitt der
Raumbildung war gewiss nach ihrem Sinn. Ist damit
aber auch schon ein Raumstil in der zu verlangenden
Bedeutung begründet? Den Masstab dafür können
nur die vorangehenden Stilstufen geben. Hier muss
ich nun rund heraus sagen: wieso sich die Kreuz-
kirche in Gmünd und was ihr folgt »der gotischen
Raumbildung entfremdet« habe; wodurch sie »eine
Urkunde neuen Wollens« geworden sei, wie man
überhaupt den Unterschied zwischen spätgotischen und
hochgotischen Hallenkirchen allem voran in die Raum-
behandlung legen kann — das liegt ausserhalb meines
Verständnisses. Die Veränderungen, die mit der
Hallenkirche vor sich gehen, liegen in der Form der
Stützen, der umschliessenden Mauern, der Gewölbe,
nicht im Raum als solchem. Gerade unter den frühe-
sten gotischen Hallenkirchen sind einige, wie der
Dom von Minden in Deutschland, die Kathedrale von
Poitiers in Frankreich, die in freier Raumschönheit
später nie wieder erreicht worden sind. Es fehlt der
Spätgotik überhaupt an einem bestimmt charakterisierten
Raumideal. Wir finden nebeneinander langgestreckte
Anlagen mit schmaloblongen Jochen, wie die Kreuz-
kirche in Gmünd, und quadratische Anlagen mit eben-
falls quadratischer Teilung, wie die Frauenkirche in
Nürnberg1), übermässig steile Querschnittprofile, wie
in S. Martin zu Landshut, und breitgequetschte, wie
in der Stiftskirche zu Stuttgart, und andere Zeugnisse
eines schwankenden Raumgefühles mehr. Sodann die
von Haenel gerühmte Einheitlichkeit des Grundrisses,
d. i. Mangel eines Querschiffes und einfache Gestal-
tung des Chors, hätte doch nur etwas zu bedeuten,
wenn sie etwas neues wäre; allein sie war in Süd-
deutschland von jeher zu Haus und in Norddeutsch-
land wenigstens an den Hallenkirchen die Regel. Den
Gipfel der Einfachheit in der Grundrissdisposition
hatte aber schon lange vorher die Kathedrale von
Poitiers erreicht. Hätten Schmarsow und Haenel, wie
sich ziemte, diese historischen Masstäbe in die Hand
genommen, dann wären sie vor dem Irrtum bewahrt
geblieben, von der Gmündner Kreuzkirche den Ein-
tritt einer neuen Aera, den Eintritt der Frührenaissance,
zu datieren. Aber auch ohne Vergleichungen, allein
1) Haenel, S. 30, hält diese Kirche für die »Geburts-
stätte« des Typus; man soll doch solche Behauptungen
nicht dem Druckpapier anvertrauen, ohne sie wenigstens
durch die nächstliegenden Handbücher kontrolliert zu haben;
bei Dehio und v. Bezold, Die kirchliche Baukunst, hätte
Haenel auf einer einzigen Tafel (169) ein halbes Dutzend I
noch romanischer Hallenkirchen vom quadratischen Typus [
finden können. Auch gotische, die älter sind als das Nürn-
berger Beispiel, wären leicht nachzuweisen gewesen.
aus den ihnen vorliegenden Denkmälern, hätten sie
merken müssen, dass der Sinn für einheitliche Raum-
gestaltung in der Spätgotik geradezu im Rückgang
war. Ich nenne zum Beweis zwei häufig vorkom-
mende Eigentümlichkeiten. Nach der einen wird die
Decke, die nach Massgabe der Raumidee in gleicher
Höhenlage bleiben müsste, beim Eintritt in den Chor
geknickt, d. h. in willkürlicher Weise bald höher, bald
tiefer gelegt, als im Schiff (Beispiel die Kreuzkirche
in Gmünd), nach der anderen erhält das Mittelschiff
eine Überhöhung im Sinne des Querschnittes, woraus
eine schlaffe Zwitterbildung zwischen Hallen- und
Basilikenanlage entsteht (Beispiel: die Frauenkirche in
Ingolstadt); ferner die Verbindung eines basilikalen
Langhauses mit einem hallenmässigen Chor (Beispiele:
S. Sebald und S. Lorenz in Nürnberg); es können
damit anziehende malerische Wirkungen erzielt werden,
aber es ist ein Hohn auf die einfachsten Prinzipien
der Raumkunst. Dasselbe gilt von Ulrichs von En-
singen Plan für das Ulmer Münster; ursprünglich als
Hallenkirche gedacht, wurde es zur Basilika umgebaut,
aber so, dass die Seitenschiffe sich bis zur gleichen
Breite mit dem Mittelschiff erweiterten, in völliger
Verkennung des der Basilika eigentümlichen räumlichen
Rhythmus. (Die Teilung der Seitenschiffe, so dass die
Gesamtzahl fünf erreicht wurde, erst später.) Wohin
man auch blicken mag, von einem einheitlichen Willen
der spätgotischen Epoche, die Raumschönheit in den
Mittelpunkt ihrer künstlerischen Intention zu stellen,
kann gar nicht die Rede sein.
Die Ablehnung der Schmarsow'schen Renaissance-
theorie möchte ich indessen nicht so verstanden
wissen, als wollte ich das Dasein eines engeren
geistigen Bandes zwischen Spätgotik und Renaissance
leugnen. Keineswegs! Auch ich glaube zu erkennen,
dass in der Spätgotik etwas Neues eintrat, das in der
Renaissance des Nordens weiterlebte. Aber ich suche
es in etwas anderem als dem Raumstile. Was die
nordische Renaissance ebenso vom Raumstile der
Brunellesco und Bramante wie vom gotisch-organischen
Stil unterscheidet und ihr eigenstes Lebensprinzip
ausmacht, ist die Orientierung der Architektur nach
der Seite des Malerischen. Von diesem Punkte aus
betrachtet ist in der That die Spätgotik der Renaissance
ich meine immer die nordische — verwandter,
als der Hochgotik. Hierin zeigt auch sie sich von
einem Verjüngungsdrange erfasst gleich ihren Schwester-
künsten; hierin liegt ihre den Verfall des Organischen
positiv ergänzende Leistung; hierin allein ihr Rechts-
anspruch, etwas anderes und besseres zu sein, als
blos Entartung. Für den genetischen Zusammenhang
ist es wichtig zu bemerken, dass die letzte Metamor-
phose der Gotik nicht wie alle früheren Phasen der-
selben in Frankreich sondern in der Heimat der
Sluter und van Eyck ihren Ursprung hat, eine Be-
kräftigung mehr der zentralen Bedeutung dieser
Gegenden für die Anfänge der modernen Kunst.
Dieser neuen malerischen Auffassung ist die Stilform
als solche gleichgültig; sie verlangt nur frei mit ihr
schalten zu dürfen, ohne Rücksicht auf das Struktive;
sie that das schon sehr ungebunden in der Spätgotik,
Über diejGrenze der Renaissance gegen die Ootik.
Frankreich und Oberitalien bis in die Anfänge der
Gewölbearchitektur hinauf. Was der Hallenkirche in
der Konkurrenz mit der Basilika am meisten das Wort
redete, war die Vereinfachung der Konstruktion, die
bequemere Widerlagerung der Gewölbe. Dies ist auch
durchaus die einleuchtendste Erklärung für ihre grosse
Beliebtheit in der deutschen Spätgotik. Sparsame und
einfache Konstruktion ist ja ein Hauptziel dieser vom
bürgerlichen Mittelstande regierten Kunst; auch die der
Hallenkirche eigene Klarheit und Übersichtlichkeitt der
Raumbildung war gewiss nach ihrem Sinn. Ist damit
aber auch schon ein Raumstil in der zu verlangenden
Bedeutung begründet? Den Masstab dafür können
nur die vorangehenden Stilstufen geben. Hier muss
ich nun rund heraus sagen: wieso sich die Kreuz-
kirche in Gmünd und was ihr folgt »der gotischen
Raumbildung entfremdet« habe; wodurch sie »eine
Urkunde neuen Wollens« geworden sei, wie man
überhaupt den Unterschied zwischen spätgotischen und
hochgotischen Hallenkirchen allem voran in die Raum-
behandlung legen kann — das liegt ausserhalb meines
Verständnisses. Die Veränderungen, die mit der
Hallenkirche vor sich gehen, liegen in der Form der
Stützen, der umschliessenden Mauern, der Gewölbe,
nicht im Raum als solchem. Gerade unter den frühe-
sten gotischen Hallenkirchen sind einige, wie der
Dom von Minden in Deutschland, die Kathedrale von
Poitiers in Frankreich, die in freier Raumschönheit
später nie wieder erreicht worden sind. Es fehlt der
Spätgotik überhaupt an einem bestimmt charakterisierten
Raumideal. Wir finden nebeneinander langgestreckte
Anlagen mit schmaloblongen Jochen, wie die Kreuz-
kirche in Gmünd, und quadratische Anlagen mit eben-
falls quadratischer Teilung, wie die Frauenkirche in
Nürnberg1), übermässig steile Querschnittprofile, wie
in S. Martin zu Landshut, und breitgequetschte, wie
in der Stiftskirche zu Stuttgart, und andere Zeugnisse
eines schwankenden Raumgefühles mehr. Sodann die
von Haenel gerühmte Einheitlichkeit des Grundrisses,
d. i. Mangel eines Querschiffes und einfache Gestal-
tung des Chors, hätte doch nur etwas zu bedeuten,
wenn sie etwas neues wäre; allein sie war in Süd-
deutschland von jeher zu Haus und in Norddeutsch-
land wenigstens an den Hallenkirchen die Regel. Den
Gipfel der Einfachheit in der Grundrissdisposition
hatte aber schon lange vorher die Kathedrale von
Poitiers erreicht. Hätten Schmarsow und Haenel, wie
sich ziemte, diese historischen Masstäbe in die Hand
genommen, dann wären sie vor dem Irrtum bewahrt
geblieben, von der Gmündner Kreuzkirche den Ein-
tritt einer neuen Aera, den Eintritt der Frührenaissance,
zu datieren. Aber auch ohne Vergleichungen, allein
1) Haenel, S. 30, hält diese Kirche für die »Geburts-
stätte« des Typus; man soll doch solche Behauptungen
nicht dem Druckpapier anvertrauen, ohne sie wenigstens
durch die nächstliegenden Handbücher kontrolliert zu haben;
bei Dehio und v. Bezold, Die kirchliche Baukunst, hätte
Haenel auf einer einzigen Tafel (169) ein halbes Dutzend I
noch romanischer Hallenkirchen vom quadratischen Typus [
finden können. Auch gotische, die älter sind als das Nürn-
berger Beispiel, wären leicht nachzuweisen gewesen.
aus den ihnen vorliegenden Denkmälern, hätten sie
merken müssen, dass der Sinn für einheitliche Raum-
gestaltung in der Spätgotik geradezu im Rückgang
war. Ich nenne zum Beweis zwei häufig vorkom-
mende Eigentümlichkeiten. Nach der einen wird die
Decke, die nach Massgabe der Raumidee in gleicher
Höhenlage bleiben müsste, beim Eintritt in den Chor
geknickt, d. h. in willkürlicher Weise bald höher, bald
tiefer gelegt, als im Schiff (Beispiel die Kreuzkirche
in Gmünd), nach der anderen erhält das Mittelschiff
eine Überhöhung im Sinne des Querschnittes, woraus
eine schlaffe Zwitterbildung zwischen Hallen- und
Basilikenanlage entsteht (Beispiel: die Frauenkirche in
Ingolstadt); ferner die Verbindung eines basilikalen
Langhauses mit einem hallenmässigen Chor (Beispiele:
S. Sebald und S. Lorenz in Nürnberg); es können
damit anziehende malerische Wirkungen erzielt werden,
aber es ist ein Hohn auf die einfachsten Prinzipien
der Raumkunst. Dasselbe gilt von Ulrichs von En-
singen Plan für das Ulmer Münster; ursprünglich als
Hallenkirche gedacht, wurde es zur Basilika umgebaut,
aber so, dass die Seitenschiffe sich bis zur gleichen
Breite mit dem Mittelschiff erweiterten, in völliger
Verkennung des der Basilika eigentümlichen räumlichen
Rhythmus. (Die Teilung der Seitenschiffe, so dass die
Gesamtzahl fünf erreicht wurde, erst später.) Wohin
man auch blicken mag, von einem einheitlichen Willen
der spätgotischen Epoche, die Raumschönheit in den
Mittelpunkt ihrer künstlerischen Intention zu stellen,
kann gar nicht die Rede sein.
Die Ablehnung der Schmarsow'schen Renaissance-
theorie möchte ich indessen nicht so verstanden
wissen, als wollte ich das Dasein eines engeren
geistigen Bandes zwischen Spätgotik und Renaissance
leugnen. Keineswegs! Auch ich glaube zu erkennen,
dass in der Spätgotik etwas Neues eintrat, das in der
Renaissance des Nordens weiterlebte. Aber ich suche
es in etwas anderem als dem Raumstile. Was die
nordische Renaissance ebenso vom Raumstile der
Brunellesco und Bramante wie vom gotisch-organischen
Stil unterscheidet und ihr eigenstes Lebensprinzip
ausmacht, ist die Orientierung der Architektur nach
der Seite des Malerischen. Von diesem Punkte aus
betrachtet ist in der That die Spätgotik der Renaissance
ich meine immer die nordische — verwandter,
als der Hochgotik. Hierin zeigt auch sie sich von
einem Verjüngungsdrange erfasst gleich ihren Schwester-
künsten; hierin liegt ihre den Verfall des Organischen
positiv ergänzende Leistung; hierin allein ihr Rechts-
anspruch, etwas anderes und besseres zu sein, als
blos Entartung. Für den genetischen Zusammenhang
ist es wichtig zu bemerken, dass die letzte Metamor-
phose der Gotik nicht wie alle früheren Phasen der-
selben in Frankreich sondern in der Heimat der
Sluter und van Eyck ihren Ursprung hat, eine Be-
kräftigung mehr der zentralen Bedeutung dieser
Gegenden für die Anfänge der modernen Kunst.
Dieser neuen malerischen Auffassung ist die Stilform
als solche gleichgültig; sie verlangt nur frei mit ihr
schalten zu dürfen, ohne Rücksicht auf das Struktive;
sie that das schon sehr ungebunden in der Spätgotik,