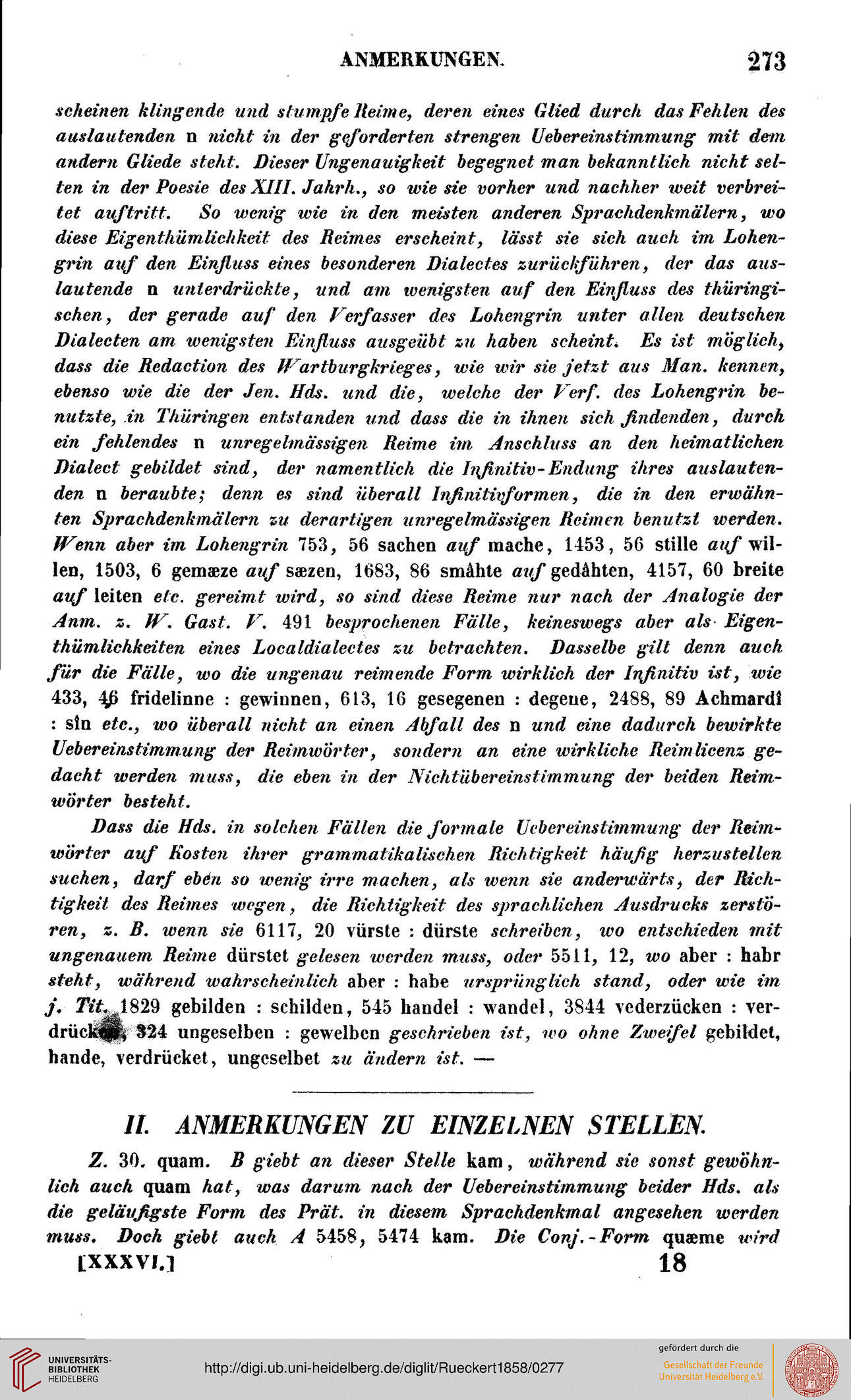ANMERKUNGEN. 273
scheinen klingende und stumpfe Heime, deren eines Glied durch das Fehlen des
auslautenden n nicht in der geforderten strengen Uebereinstimmung mit dent
andern Gliede steht. Dieser Ungenauigkeit begegnet man bekanntlich nicht sel-
ten in der Poesie des XIII. Jahrh., so wie sie vorher und nachher weit verbrei-
tet auftritt. So wenig wie in den meisten anderen Sprachdenkmälern, wo
diese Eigentümlichkeit des Reimes erscheint, lässt sie sich auch im Lohen-
grin auf den Einßuss eines besonderen Dialectes zurückführen, der das aus-
lautende n unierdrückte, und am wenigsten auf den Einßuss des thüringi-
schen, der gerade auf den Verfasser des Lohengrin unter allen deutschen
Dialecten am wenigsten Einßuss ausgeübt zu haben scheint* Es ist möglich}
doss die Redaction des Wartburgkrieges, wie wir sie jetzt aus Man. kennen,
ebenso wie die der Jen. Hds. und die, welche der Verf. des Lohengrin be-
nutzte, in Thüringen entstanden und dass die in ihnen sich findenden, durch
ein fehlendes n unregelmässigen Reime im Anschluss an den heimatlichen
Dialect gebildet sind, der namentlich die Infinitiv- Endung ihres auslauten-
den n beraubte; denn es sind überall Infinitivformen, die in den erwähn-
ten Sprachdenkmälern zu derartigen unregelmässigen Reimen benutzt werden.
Wenn aber im Lohengrin 753, 56 Sachen auf mache, 1453, 56 stille auf wil-
len, 1503, 6 gemaeze auf saezen, 1683, 86 smâhte auf gedâhten, 4157, 60 breite
auf leiten etc. gereimt wird, so sind diese Reime nur nach der Analogie der
Anm. z. W. Gast. V. 491 besprochenen Fälle, keineswegs aber als Eigen-
thümlichkeiten eines Localdialectes zu betrachten. Dasselbe gilt denn auch
für die Fälle, wo die ungenau reimende Form wirklich der Infinitiv ist, wie
433, 46 fridelinne : gewinnen, 613, 16 gesegenen : degeue, 2488, 89 Achmardî
: sin etc., wo überall nicht an einen Abfall des n und eine dadurch bewirkte
Uebereinstimmung der Reimwörter, sondern an eine wirkliche Reimlicenz ge-
dacht werden muss, die eben in der Nichtübereinstimmung der beiden Reim-
wÖrter besteht.
Dass die Hds. in solchen Fällen die formale Uebereinstimmung der Reim-
wörter auf Kosten ihrer grammatikalischen Richtigkeit häufig herzustellen
suchen, darf eben so wenig irre machen, als wenn sie anderwärts, der Rich-
tigkeit des Reimes wegen, die Richtigkeit des sprachliehen Ausdrucks zerstö-
ren, z. R. wenn sie 6117, 20 vürste : dürste schreiben, wo entschieden mit
ungenauem Reime dürstet gelesen werden muss, oder 5511, 12, wo aber : hahr
steht, während wahrscheinlich aber : habe ursprünglich stand, oder wie im
j, Tit^J.829 gebilden : Schilden, 545 handel : wandel, 3844 vederzücken : ver-
drückfps 824 ungeselben : gewelben geschrieben ist, wo ohne Zweifel gebildet,
hande, verdrücket, ungeselbet zu ändern ist. —
//. ANMERKUNGEN ZU EINZELNEN STELLEN.
Z. 30. quam. B giebt an dieser Stelle kam, während sie sonst gewöhn-
lich auch quam hat, was darum nach der Uebereinstimmung beider Hds. als
die geläufigste Form des Prät. in diesem Sprachdenkmal angesehen werden
muss. Doch giebt auch A 5458, 5474 kam. Die Conj.-Form quaeme wird
txxxvi.i 18
scheinen klingende und stumpfe Heime, deren eines Glied durch das Fehlen des
auslautenden n nicht in der geforderten strengen Uebereinstimmung mit dent
andern Gliede steht. Dieser Ungenauigkeit begegnet man bekanntlich nicht sel-
ten in der Poesie des XIII. Jahrh., so wie sie vorher und nachher weit verbrei-
tet auftritt. So wenig wie in den meisten anderen Sprachdenkmälern, wo
diese Eigentümlichkeit des Reimes erscheint, lässt sie sich auch im Lohen-
grin auf den Einßuss eines besonderen Dialectes zurückführen, der das aus-
lautende n unierdrückte, und am wenigsten auf den Einßuss des thüringi-
schen, der gerade auf den Verfasser des Lohengrin unter allen deutschen
Dialecten am wenigsten Einßuss ausgeübt zu haben scheint* Es ist möglich}
doss die Redaction des Wartburgkrieges, wie wir sie jetzt aus Man. kennen,
ebenso wie die der Jen. Hds. und die, welche der Verf. des Lohengrin be-
nutzte, in Thüringen entstanden und dass die in ihnen sich findenden, durch
ein fehlendes n unregelmässigen Reime im Anschluss an den heimatlichen
Dialect gebildet sind, der namentlich die Infinitiv- Endung ihres auslauten-
den n beraubte; denn es sind überall Infinitivformen, die in den erwähn-
ten Sprachdenkmälern zu derartigen unregelmässigen Reimen benutzt werden.
Wenn aber im Lohengrin 753, 56 Sachen auf mache, 1453, 56 stille auf wil-
len, 1503, 6 gemaeze auf saezen, 1683, 86 smâhte auf gedâhten, 4157, 60 breite
auf leiten etc. gereimt wird, so sind diese Reime nur nach der Analogie der
Anm. z. W. Gast. V. 491 besprochenen Fälle, keineswegs aber als Eigen-
thümlichkeiten eines Localdialectes zu betrachten. Dasselbe gilt denn auch
für die Fälle, wo die ungenau reimende Form wirklich der Infinitiv ist, wie
433, 46 fridelinne : gewinnen, 613, 16 gesegenen : degeue, 2488, 89 Achmardî
: sin etc., wo überall nicht an einen Abfall des n und eine dadurch bewirkte
Uebereinstimmung der Reimwörter, sondern an eine wirkliche Reimlicenz ge-
dacht werden muss, die eben in der Nichtübereinstimmung der beiden Reim-
wÖrter besteht.
Dass die Hds. in solchen Fällen die formale Uebereinstimmung der Reim-
wörter auf Kosten ihrer grammatikalischen Richtigkeit häufig herzustellen
suchen, darf eben so wenig irre machen, als wenn sie anderwärts, der Rich-
tigkeit des Reimes wegen, die Richtigkeit des sprachliehen Ausdrucks zerstö-
ren, z. R. wenn sie 6117, 20 vürste : dürste schreiben, wo entschieden mit
ungenauem Reime dürstet gelesen werden muss, oder 5511, 12, wo aber : hahr
steht, während wahrscheinlich aber : habe ursprünglich stand, oder wie im
j, Tit^J.829 gebilden : Schilden, 545 handel : wandel, 3844 vederzücken : ver-
drückfps 824 ungeselben : gewelben geschrieben ist, wo ohne Zweifel gebildet,
hande, verdrücket, ungeselbet zu ändern ist. —
//. ANMERKUNGEN ZU EINZELNEN STELLEN.
Z. 30. quam. B giebt an dieser Stelle kam, während sie sonst gewöhn-
lich auch quam hat, was darum nach der Uebereinstimmung beider Hds. als
die geläufigste Form des Prät. in diesem Sprachdenkmal angesehen werden
muss. Doch giebt auch A 5458, 5474 kam. Die Conj.-Form quaeme wird
txxxvi.i 18