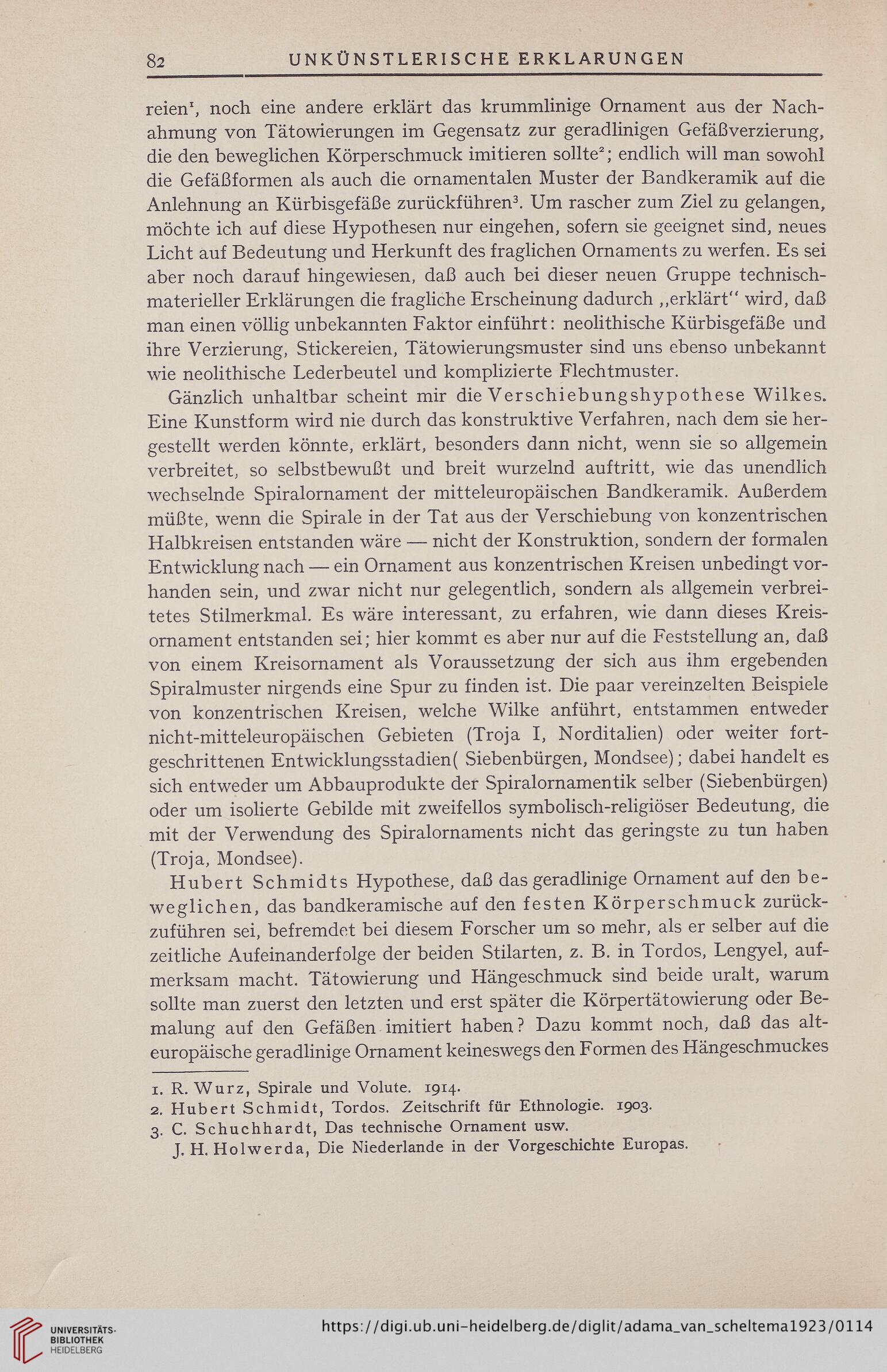82
UNKÜNSTLERISCHE ERKLÄRUNGEN
reien1, noch eine andere erklärt das krummlinige Ornament aus der Nach-
ahmung von Tätowierungen im Gegensatz zur geradlinigen Gefäßverzierung,
die den beweglichen Körperschmuck imitieren sollte2; endlich will man sowohl
die Gefäßformen als auch die ornamentalen Muster der Bandkeramik auf die
Anlehnung an Kürbisgefäße zurückführen3. Um rascher zum Ziel zu gelangen,
möchte ich auf diese Hypothesen nur eingehen, sofern sie geeignet sind, neues
Licht auf Bedeutung und Herkunft des fraglichen Ornaments zu werfen. Es sei
aber noch darauf hingewiesen, daß auch bei dieser neuen Gruppe technisch-
materieller Erklärungen die fragliche Erscheinung dadurch ,.erklärt" wird, daß
man einen völlig unbekannten Faktor einführt: neolithische Kürbisgefäße und
ihre Verzierung, Stickereien, Tätowierungsmuster sind uns ebenso unbekannt
wie neolithische Lederbeutel und komplizierte Flechtmuster.
Gänzlich unhaltbar scheint mir die Verschiebungshypothese Wilkes.
Eine Kunstform wird nie durch das konstruktive Verfahren, nach dem sie her-
gestellt werden könnte, erklärt, besonders dann nicht, wenn sie so allgemein
verbreitet, so selbstbewußt und breit wurzelnd auftritt, wie das unendlich
wechselnde Spiralornament der mitteleuropäischen Bandkeramik. Außerdem
müßte, wenn die Spirale in der Tat aus der Verschiebung von konzentrischen
Halbkreisen entstanden wäre — nicht der Konstruktion, sondern der formalen
Entwicklung nach — ein Ornament aus konzentrischen Kreisen unbedingt vor-
handen sein, und zwar nicht nur gelegentlich, sondern als allgemein verbrei-
tetes Stilmerkmal. Es wäre interessant, zu erfahren, wie dann dieses Kreis-
ornament entstanden sei; hier kommt es aber nur auf die Feststellung an, daß
von einem Kreisomament als Voraussetzung der sich aus ihm ergebenden
Spiralmuster nirgends eine Spur zu finden ist. Die paar vereinzelten Beispiele
von konzentrischen Kreisen, welche Wilke anführt, entstammen entweder
nicht-mitteleuropäischen Gebieten (Troja I, Norditalien) oder weiter fort-
geschrittenen Entwicklungsstadien( Siebenbürgen, Mondsee); dabei handelt es
sich entweder um Abbauprodukte der Spiralornamentik selber (Siebenbürgen)
oder um isolierte Gebilde mit zweifellos symbolisch-religiöser Bedeutung, die
mit der Verwendung des Spiralornaments nicht das geringste zu tun haben
(Troja, Mondsee).
Hubert Schmidts Hypothese, daß das geradlinige Ornament auf den be-
weglichen, das bandkeramische auf den festen Körperschmuck zurück-
zuführen sei, befremdet bei diesem Forscher um so mehr, als er selber auf die
zeitliche Aufeinanderfolge der beiden Stilarten, z. B. in Tordos, Lengyel, auf-
merksam macht. Tätowierung und Hängeschmuck sind beide uralt, warum
sollte man zuerst den letzten und erst später die Körpertätowierung oder Be-
malung auf den Gefäßen imitiert haben ? Dazu kommt noch, daß das alt-
europäische geradlinige Ornament keineswegs den Formen des Hängeschmuckes
1. R. Wurz, Spirale und Volute. 1914.
2. Hubert Schmidt, Tordos. Zeitschrift für Ethnologie. 1903.
3. C. Schuchhardt, Das technische Ornament usw.
J. H. Holwerda, Die Niederlande in der Vorgeschichte Europas.
UNKÜNSTLERISCHE ERKLÄRUNGEN
reien1, noch eine andere erklärt das krummlinige Ornament aus der Nach-
ahmung von Tätowierungen im Gegensatz zur geradlinigen Gefäßverzierung,
die den beweglichen Körperschmuck imitieren sollte2; endlich will man sowohl
die Gefäßformen als auch die ornamentalen Muster der Bandkeramik auf die
Anlehnung an Kürbisgefäße zurückführen3. Um rascher zum Ziel zu gelangen,
möchte ich auf diese Hypothesen nur eingehen, sofern sie geeignet sind, neues
Licht auf Bedeutung und Herkunft des fraglichen Ornaments zu werfen. Es sei
aber noch darauf hingewiesen, daß auch bei dieser neuen Gruppe technisch-
materieller Erklärungen die fragliche Erscheinung dadurch ,.erklärt" wird, daß
man einen völlig unbekannten Faktor einführt: neolithische Kürbisgefäße und
ihre Verzierung, Stickereien, Tätowierungsmuster sind uns ebenso unbekannt
wie neolithische Lederbeutel und komplizierte Flechtmuster.
Gänzlich unhaltbar scheint mir die Verschiebungshypothese Wilkes.
Eine Kunstform wird nie durch das konstruktive Verfahren, nach dem sie her-
gestellt werden könnte, erklärt, besonders dann nicht, wenn sie so allgemein
verbreitet, so selbstbewußt und breit wurzelnd auftritt, wie das unendlich
wechselnde Spiralornament der mitteleuropäischen Bandkeramik. Außerdem
müßte, wenn die Spirale in der Tat aus der Verschiebung von konzentrischen
Halbkreisen entstanden wäre — nicht der Konstruktion, sondern der formalen
Entwicklung nach — ein Ornament aus konzentrischen Kreisen unbedingt vor-
handen sein, und zwar nicht nur gelegentlich, sondern als allgemein verbrei-
tetes Stilmerkmal. Es wäre interessant, zu erfahren, wie dann dieses Kreis-
ornament entstanden sei; hier kommt es aber nur auf die Feststellung an, daß
von einem Kreisomament als Voraussetzung der sich aus ihm ergebenden
Spiralmuster nirgends eine Spur zu finden ist. Die paar vereinzelten Beispiele
von konzentrischen Kreisen, welche Wilke anführt, entstammen entweder
nicht-mitteleuropäischen Gebieten (Troja I, Norditalien) oder weiter fort-
geschrittenen Entwicklungsstadien( Siebenbürgen, Mondsee); dabei handelt es
sich entweder um Abbauprodukte der Spiralornamentik selber (Siebenbürgen)
oder um isolierte Gebilde mit zweifellos symbolisch-religiöser Bedeutung, die
mit der Verwendung des Spiralornaments nicht das geringste zu tun haben
(Troja, Mondsee).
Hubert Schmidts Hypothese, daß das geradlinige Ornament auf den be-
weglichen, das bandkeramische auf den festen Körperschmuck zurück-
zuführen sei, befremdet bei diesem Forscher um so mehr, als er selber auf die
zeitliche Aufeinanderfolge der beiden Stilarten, z. B. in Tordos, Lengyel, auf-
merksam macht. Tätowierung und Hängeschmuck sind beide uralt, warum
sollte man zuerst den letzten und erst später die Körpertätowierung oder Be-
malung auf den Gefäßen imitiert haben ? Dazu kommt noch, daß das alt-
europäische geradlinige Ornament keineswegs den Formen des Hängeschmuckes
1. R. Wurz, Spirale und Volute. 1914.
2. Hubert Schmidt, Tordos. Zeitschrift für Ethnologie. 1903.
3. C. Schuchhardt, Das technische Ornament usw.
J. H. Holwerda, Die Niederlande in der Vorgeschichte Europas.