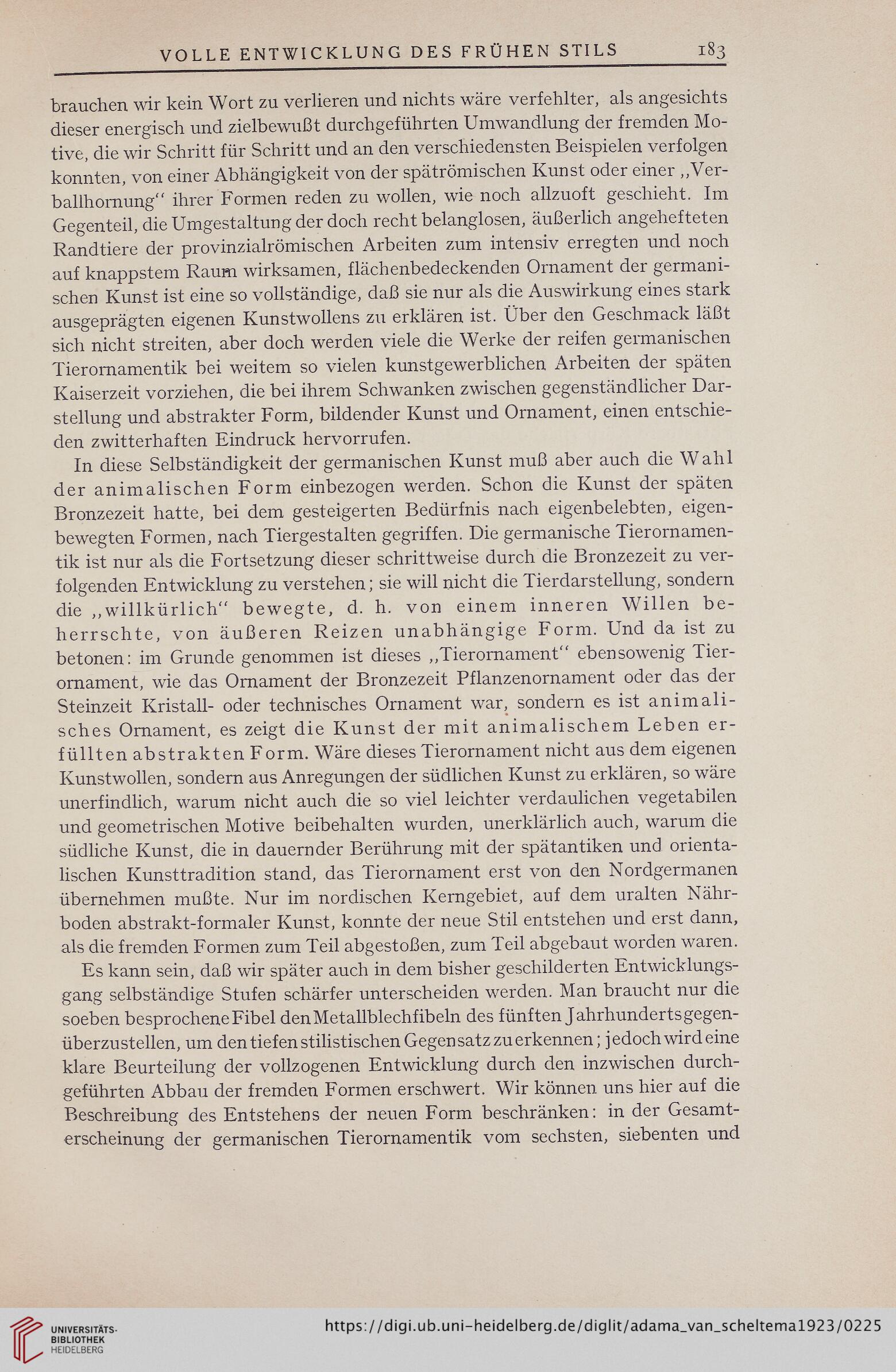VOLLE ENTWICKLUNG DES FRÜHEN STILS
183
brauchen wir kein Wort zu verlieren und nichts wäre verfehlter, als angesichts
dieser energisch und zielbewußt durchgeführten Umwandlung der fremden Mo-
tive, die wir Schritt für Schritt und an den verschiedensten Beispielen verfolgen
konnten, von einer Abhängigkeit von der spätrömischen Kunst oder einer „Ver-
ballhornung“ ihrer Formen reden zu wollen, wie noch allzuoft geschieht. Im
Gegenteil, die Umgestaltung der doch recht belanglosen, äußerlich angehefteten
Randtiere der provinzialrömischen Arbeiten zum intensiv erregten und noch
auf knappstem Raum wirksamen, flächenbedeckenden Ornament der germani-
schen Kunst ist eine so vollständige, daß sie nur als die Auswirkung eines stark
ausgeprägten eigenen Kunstwollens zu erklären ist. Über den Geschmack läßt
sich nicht streiten, aber doch werden viele die Werke der reifen germanischen
Tieromamentik bei weitem so vielen kunstgewerblichen Arbeiten der späten
Kaiserzeit vorziehen, die bei ihrem Schwanken zwischen gegenständlicher Dar-
stellung und abstrakter Form, bildender Kunst und Ornament, einen entschie-
den zwitterhaften Eindruck hervorrufen.
In diese Selbständigkeit der germanischen Kunst muß aber auch die Wahl
der animalischen Form einbezogen werden. Schon die Kunst der späten
Bronzezeit hatte, bei dem gesteigerten Bedürfnis nach eigenbelebten, eigen-
bewegten Formen, nach Tiergestalten gegriffen. Die germanische Tierornamen-
tik ist nur als die Fortsetzung dieser schrittweise durch die Bronzezeit zu ver-
folgenden Entwicklung zu verstehen; sie will nicht die Tierdarstellung, sondern
die „willkürlich“ bewegte, d. h. von einem inneren Willen be-
herrschte, von äußeren Reizen unabhängige Form. Und da ist zu
betonen: im Grunde genommen ist dieses „Tieromament“ ebensowenig Tier-
ornament, wie das Ornament der Bronzezeit Pflanzenornament oder das der
Steinzeit Kristall- oder technisches Ornament war, sondern es ist animali-
sches Ornament, es zeigt die Kunst der mit animalischem Leben er-
füllten abstrakten Form. Wäre dieses Tierornament nicht aus dem eigenen
Kunstwollen, sondern aus Anregungen der südlichen Kunst zu erklären, so wäre
unerfindlich, warum nicht auch die so viel leichter verdaulichen vegetabilen
und geometrischen Motive beibehalten wurden, unerklärlich auch, warum die
südliche Kunst, die in dauernder Berührung mit der spätantiken und orienta-
lischen Kunsttradition stand, das Tierornament erst von den Nordgermanen
übernehmen mußte. Nur im nordischen Kerngebiet, auf dem uralten Nähr-
boden abstrakt-formaler Kunst, konnte der neue Stil entstehen und erst dann,
als die fremden Formen zum Teil abgestoßen, zum Teil abgebaut worden waren.
Es kann sein, daß wir später auch in dem bisher geschilderten Entwicklungs-
gang selbständige Stufen schärfer unterscheiden werden. Man braucht nur die
soeben besprochene Fibel den Metallblechfibeln des fünften Jahrhundertsgegen-
überzustellen, um den tiefen stilistischen Gegensatz zu erkennen; jedoch wird eine
klare Beurteilung der vollzogenen Entwicklung durch den inzwischen durch-
geführten Abbau der fremden Formen erschwert. Wir können uns hier auf die
Beschreibung des Entstehens der neuen Form beschränken: in der Gesamt-
erscheinung der germanischen Tier Ornamentik vom sechsten, siebenten und
183
brauchen wir kein Wort zu verlieren und nichts wäre verfehlter, als angesichts
dieser energisch und zielbewußt durchgeführten Umwandlung der fremden Mo-
tive, die wir Schritt für Schritt und an den verschiedensten Beispielen verfolgen
konnten, von einer Abhängigkeit von der spätrömischen Kunst oder einer „Ver-
ballhornung“ ihrer Formen reden zu wollen, wie noch allzuoft geschieht. Im
Gegenteil, die Umgestaltung der doch recht belanglosen, äußerlich angehefteten
Randtiere der provinzialrömischen Arbeiten zum intensiv erregten und noch
auf knappstem Raum wirksamen, flächenbedeckenden Ornament der germani-
schen Kunst ist eine so vollständige, daß sie nur als die Auswirkung eines stark
ausgeprägten eigenen Kunstwollens zu erklären ist. Über den Geschmack läßt
sich nicht streiten, aber doch werden viele die Werke der reifen germanischen
Tieromamentik bei weitem so vielen kunstgewerblichen Arbeiten der späten
Kaiserzeit vorziehen, die bei ihrem Schwanken zwischen gegenständlicher Dar-
stellung und abstrakter Form, bildender Kunst und Ornament, einen entschie-
den zwitterhaften Eindruck hervorrufen.
In diese Selbständigkeit der germanischen Kunst muß aber auch die Wahl
der animalischen Form einbezogen werden. Schon die Kunst der späten
Bronzezeit hatte, bei dem gesteigerten Bedürfnis nach eigenbelebten, eigen-
bewegten Formen, nach Tiergestalten gegriffen. Die germanische Tierornamen-
tik ist nur als die Fortsetzung dieser schrittweise durch die Bronzezeit zu ver-
folgenden Entwicklung zu verstehen; sie will nicht die Tierdarstellung, sondern
die „willkürlich“ bewegte, d. h. von einem inneren Willen be-
herrschte, von äußeren Reizen unabhängige Form. Und da ist zu
betonen: im Grunde genommen ist dieses „Tieromament“ ebensowenig Tier-
ornament, wie das Ornament der Bronzezeit Pflanzenornament oder das der
Steinzeit Kristall- oder technisches Ornament war, sondern es ist animali-
sches Ornament, es zeigt die Kunst der mit animalischem Leben er-
füllten abstrakten Form. Wäre dieses Tierornament nicht aus dem eigenen
Kunstwollen, sondern aus Anregungen der südlichen Kunst zu erklären, so wäre
unerfindlich, warum nicht auch die so viel leichter verdaulichen vegetabilen
und geometrischen Motive beibehalten wurden, unerklärlich auch, warum die
südliche Kunst, die in dauernder Berührung mit der spätantiken und orienta-
lischen Kunsttradition stand, das Tierornament erst von den Nordgermanen
übernehmen mußte. Nur im nordischen Kerngebiet, auf dem uralten Nähr-
boden abstrakt-formaler Kunst, konnte der neue Stil entstehen und erst dann,
als die fremden Formen zum Teil abgestoßen, zum Teil abgebaut worden waren.
Es kann sein, daß wir später auch in dem bisher geschilderten Entwicklungs-
gang selbständige Stufen schärfer unterscheiden werden. Man braucht nur die
soeben besprochene Fibel den Metallblechfibeln des fünften Jahrhundertsgegen-
überzustellen, um den tiefen stilistischen Gegensatz zu erkennen; jedoch wird eine
klare Beurteilung der vollzogenen Entwicklung durch den inzwischen durch-
geführten Abbau der fremden Formen erschwert. Wir können uns hier auf die
Beschreibung des Entstehens der neuen Form beschränken: in der Gesamt-
erscheinung der germanischen Tier Ornamentik vom sechsten, siebenten und