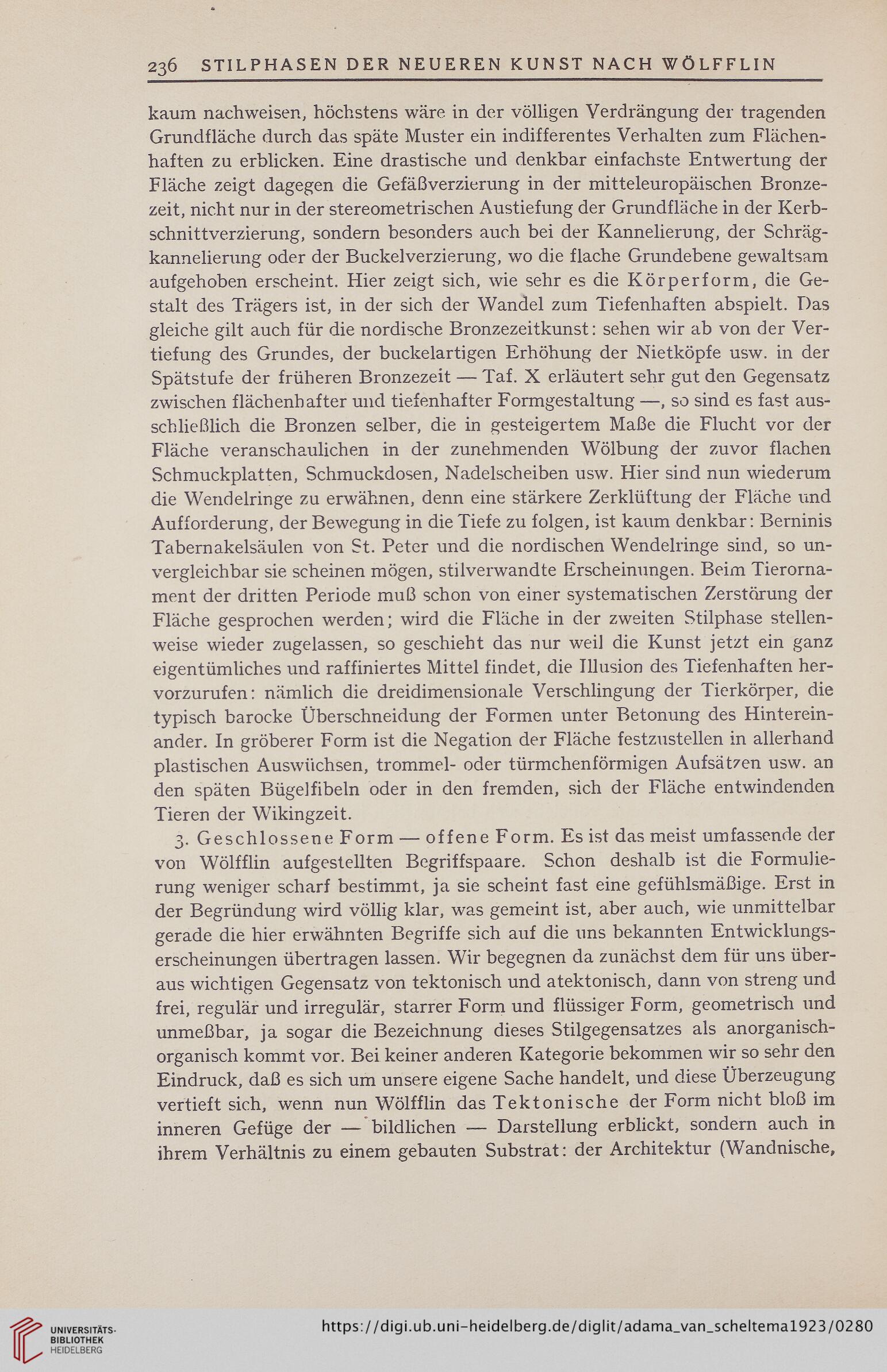236 STILPHASEN DER NEUEREN KUNST NACH WÖLFFLIN
kaum nachweisen, höchstens wäre, in der völligen Verdrängung der tragenden
Grundfläche durch das späte Muster ein indifferentes Verhalten zum Flächen-
haften zu erblicken. Eine drastische und denkbar einfachste Entwertung der
Fläche zeigt dagegen die Gefäßverzierung in der mitteleuropäischen Bronze-
zeit, nicht nur in der stereometrischen Austiefung der Grundfläche in der Kerb-
schnittverzierung, sondern besonders auch bei der Kannelierung, der Schräg-
kannelierung oder der Buckelverzierung, wo die flache Grundebene gewaltsam
aufgehoben erscheint. Hier zeigt sich, wie sehr es die Körperform, die Ge-
stalt des Trägers ist, in der sich der Wandel zum Tiefenhaften abspielt. Das
gleiche gilt auch für die nordische Bronzezeitkunst: sehen wir ab von der Ver-
tiefung des Grundes, der buckelartigen Erhöhung der Nietköpfe usw. in der
Spätstufe der früheren Bronzezeit — Taf. X erläutert sehr gut den Gegensatz
zwischen flächenhafter und tiefenhafter Formgestaltung —, so sind es fast aus-
schließlich die Bronzen selber, die in gesteigertem Maße die Flucht vor der
Fläche veranschaulichen in der zunehmenden Wölbung der zuvor flachen
Schmuckplatten, Schmuckdosen, Nadelscheiben usw. Hier sind nun wiederum
die Wendeiringe zu erwähnen, denn eine stärkere Zerklüftung der Fläche und
Aufforderung, der Bewegung in die Tiefe zu folgen, ist kaum denkbar: Berninis
Tabernakelsäulen von St. Peter und die nordischen Wendeiringe sind, so un-
vergleichbar sie scheinen mögen, stilverwandte Erscheinungen. Beim Tierorna-
ment der dritten Periode muß schon von einer systematischen Zerstörung der
Fläche gesprochen werden; wird die Fläche in der zweiten Stilphase stellen-
weise wieder zugelassen, so geschieht das nur weil die Kunst jetzt ein ganz
eigentümliches und raffiniertes Mittel findet, die Illusion des Tiefenhaften her-
vorzurufen: nämlich die dreidimensionale Verschlingung der Tierkörper, die
typisch barocke Überschneidung der Formen unter Betonung des Hinterein-
ander. In gröberer Form ist die Negation der Fläche festzustellen in allerhand
plastischen Auswüchsen, trommel- oder türmchenförmigen Aufsätzen usw. an
den späten Bügelfibeln oder in den fremden, sich der Fläche entwindenden
Tieren der Wikingzeit.
3. Geschlossene Form — offene Form. Es ist das meist umfassende der
von Wölfflin aufgestellten Begriffspaare. Schon deshalb ist die Formulie-
rung weniger scharf bestimmt, ja sie scheint fast eine gefühlsmäßige. Erst in
der Begründung wird völlig klar, was gemeint ist, aber auch, wie unmittelbar
gerade die hier erwähnten Begriffe sich auf die uns bekannten Entwicklungs-
erscheinungen übertragen lassen. Wir begegnen da zunächst dem für uns über-
aus wichtigen Gegensatz von tektonisch und atektonisch, dann von streng und
frei, regulär und irregulär, starrer Form und flüssiger Form, geometrisch und
unmeßbar, ja sogar die Bezeichnung dieses Stilgegensatzes als anorganisch-
organisch kommt vor. Bei keiner anderen Kategorie bekommen wir so sehr den
Eindruck, daß es sich um unsere eigene Sache handelt, und diese Überzeugung
vertieft sich, wenn nun Wölfflin das Tektonische der Form nicht bloß im
inneren Gefüge der — bildlichen — Darstellung erblickt, sondern auch in
ihrem Verhältnis zu einem gebauten Substrat: der Architektur (Wandnische,
kaum nachweisen, höchstens wäre, in der völligen Verdrängung der tragenden
Grundfläche durch das späte Muster ein indifferentes Verhalten zum Flächen-
haften zu erblicken. Eine drastische und denkbar einfachste Entwertung der
Fläche zeigt dagegen die Gefäßverzierung in der mitteleuropäischen Bronze-
zeit, nicht nur in der stereometrischen Austiefung der Grundfläche in der Kerb-
schnittverzierung, sondern besonders auch bei der Kannelierung, der Schräg-
kannelierung oder der Buckelverzierung, wo die flache Grundebene gewaltsam
aufgehoben erscheint. Hier zeigt sich, wie sehr es die Körperform, die Ge-
stalt des Trägers ist, in der sich der Wandel zum Tiefenhaften abspielt. Das
gleiche gilt auch für die nordische Bronzezeitkunst: sehen wir ab von der Ver-
tiefung des Grundes, der buckelartigen Erhöhung der Nietköpfe usw. in der
Spätstufe der früheren Bronzezeit — Taf. X erläutert sehr gut den Gegensatz
zwischen flächenhafter und tiefenhafter Formgestaltung —, so sind es fast aus-
schließlich die Bronzen selber, die in gesteigertem Maße die Flucht vor der
Fläche veranschaulichen in der zunehmenden Wölbung der zuvor flachen
Schmuckplatten, Schmuckdosen, Nadelscheiben usw. Hier sind nun wiederum
die Wendeiringe zu erwähnen, denn eine stärkere Zerklüftung der Fläche und
Aufforderung, der Bewegung in die Tiefe zu folgen, ist kaum denkbar: Berninis
Tabernakelsäulen von St. Peter und die nordischen Wendeiringe sind, so un-
vergleichbar sie scheinen mögen, stilverwandte Erscheinungen. Beim Tierorna-
ment der dritten Periode muß schon von einer systematischen Zerstörung der
Fläche gesprochen werden; wird die Fläche in der zweiten Stilphase stellen-
weise wieder zugelassen, so geschieht das nur weil die Kunst jetzt ein ganz
eigentümliches und raffiniertes Mittel findet, die Illusion des Tiefenhaften her-
vorzurufen: nämlich die dreidimensionale Verschlingung der Tierkörper, die
typisch barocke Überschneidung der Formen unter Betonung des Hinterein-
ander. In gröberer Form ist die Negation der Fläche festzustellen in allerhand
plastischen Auswüchsen, trommel- oder türmchenförmigen Aufsätzen usw. an
den späten Bügelfibeln oder in den fremden, sich der Fläche entwindenden
Tieren der Wikingzeit.
3. Geschlossene Form — offene Form. Es ist das meist umfassende der
von Wölfflin aufgestellten Begriffspaare. Schon deshalb ist die Formulie-
rung weniger scharf bestimmt, ja sie scheint fast eine gefühlsmäßige. Erst in
der Begründung wird völlig klar, was gemeint ist, aber auch, wie unmittelbar
gerade die hier erwähnten Begriffe sich auf die uns bekannten Entwicklungs-
erscheinungen übertragen lassen. Wir begegnen da zunächst dem für uns über-
aus wichtigen Gegensatz von tektonisch und atektonisch, dann von streng und
frei, regulär und irregulär, starrer Form und flüssiger Form, geometrisch und
unmeßbar, ja sogar die Bezeichnung dieses Stilgegensatzes als anorganisch-
organisch kommt vor. Bei keiner anderen Kategorie bekommen wir so sehr den
Eindruck, daß es sich um unsere eigene Sache handelt, und diese Überzeugung
vertieft sich, wenn nun Wölfflin das Tektonische der Form nicht bloß im
inneren Gefüge der — bildlichen — Darstellung erblickt, sondern auch in
ihrem Verhältnis zu einem gebauten Substrat: der Architektur (Wandnische,