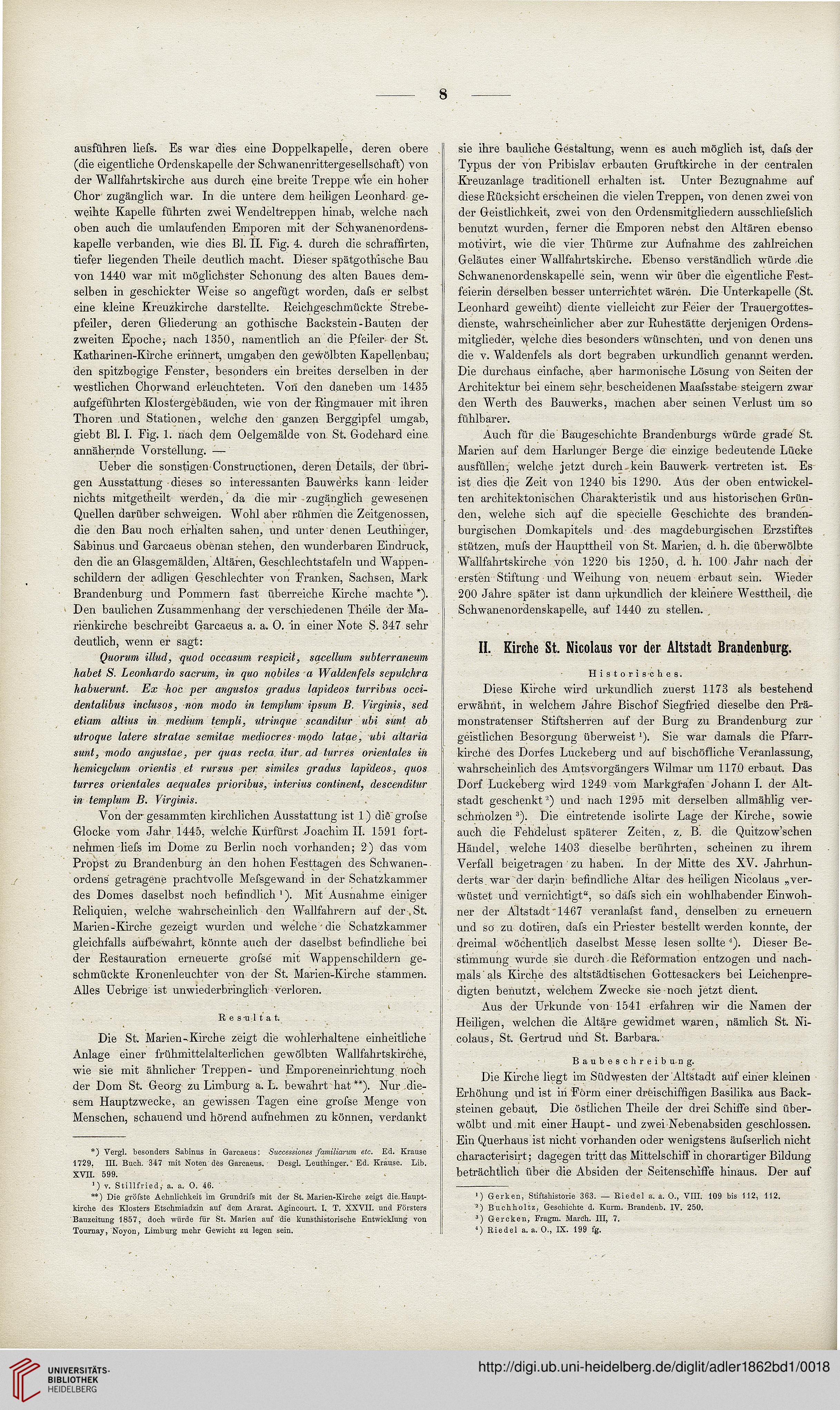8
ausführen liefs. Es war die& eine Doppelkapelle, deren obere
(die eigentliche Ordenskapelle der Schwanenrittergesellschaft) von
der Wallfahrtskirche aus durch eine breite Treppe wie ein hoher
Chor zugänglich war. In die untere dem heiligen Leonhard ge-
weihte Kapelle führten zwei Wendeltreppen hinab, welche nach
oben auch die umlaufenden Emporen mit der Schwanenordens-
kapelle yei’banden, wie dies Bl. II. Fig. 4. durch die schraffii’ten,
tiefer liegenden Theile deutlich macht. Dieser spätgothische Bau
von 1440 war mit möglichster Schonung des alten Baues dem-
selben in geschickter Weise so angefügt woi'den, dafs er selbst
eine kleine Kreuzkirche darstellte. Keichgeschmückte Strebe-
pfeiler, deren Gliederung an gothische Backstein-Bauten der
zweiten Epoche, nach 1350, namentlich an die Pfeiler der St.
Katharinen-Kirche erinnert, umgaben den gewölbten Kapellenbau,
den spitzbogige Fenster, besonders ein breites derselben in der
westlichen Chorwand erleuchteten. Von den daneben um 1435
aufgefiihi’ten Klostergebäuden, wie von der Ringmauer mit ihren
Thox-en und Stationen, welche den ganzen Berggipfel umgab,
giebt Bl. I. Fig. 1. nach dem Oelgemälde von St. Godehard eine
annähernde Vorstellung. —
Ueber die sonstigen Constructionen, deren Details, der übri-
gen Ausstattung dieses so interessanten Bauwei’ks kann leider
nichts mitgetheilt wei’den, da die mir zugänglich gewesenen
Quellen darüber schweigen. Wohl aber l’ühmen die Zeitgenossen,
die den Bau noch ei’halten saheri, und unter denen Leuthingei’,
Sabinus und Garcaeus obenan stehen, den wunderbaren Eindruck,
den die an Glasgemälden, Altären, Geschlechtstafeln und Wappen-
schildern der adligen Geschlechter von Franken, Sachsen, Mark
Bi’andenburg und Pommei'n fast übex'reiche Kirche machte *).
Den baulichen Zusammenhang der verschiedenen Theile der Ma-
rienkirche beschreibt Garcaeus a. a. 0. in einer Note S. 347 sehr
deutlich, wenn er sagt:
Quorum illud, quocl occasum respicii, sqcellum subterraneum
habet S. Leonhardo sacrum, in quo nobiles a Waldenfels sepulchra
habuerunt. Ex hoc per angustos gradus lapideos turribus occi-
dentalibus inclusos, non modo in templum ipsum B. Virginis, sed jj
etiam altius in medium templi, utrinque scanditur ubi sunt ab
utroque latere stratae semitae mediocres modo tatae, ubi altaria
sunt, modo angustae, per quas recta itur ad turres orientales in \
hemicyclum orientis et rursus per similes gradus lapideos, quos
turres orientales aequales prioribus, interius continent, descenditur
in templum B. Virginis.
Von der gesammten kirchlichen Ausstattung ist 1) diö grofse
Glocke vom Jahr 1445, welche Kürfürst Joachim II. 1591 fort-
nehmen liefs im Dome zu Bei’lin noch voi’handen; 2) das vom
Propst zu Brandenburg an derx hohen Festtagen des Schwanen-
ordens getragene prachtvolle Mefsgewand in der Schatzkammer
des Domes daselbst noch befindlich 1 2). Mit Ausnahme einiger
Reliquien, welche wahrscheinlich den Wallfahrern auf der St.
Marien-Kirche gezeigt wurden und welche * die Schatzkammer
gleichfalls aufbewahrt, könnte auch der daselbst befindliche bei
der Restauration erneuei'te grofse' mit Wappenschildern ge-
schmückte Kronenleuchter von der St. Mai’ien-Kirche stammen.
Alles Uebrige ist unwiederbi’inglich verloren.
ßes-nltat.
Die St. Marien-Kirche zeigt die wohlerhaltene einheitliche
Anlage einer frühmittelalterlichen gewölbten Wallfahrtskirche,
wie sie mit ähnlicher Treppen- und Emporeneinrichtung nöch
der Dom St. Georg zu Limburg a. L. bewahrt hat**). Nur die-
sem Hauptzwecke, an gewissen Tagen eine grofse Menge von
Menschen, schauend und hörend aufnehmen zu können, verdankt
*) Vergl. besonders Sabinus in Garcaeus: Successiones familianm etc. Ed. Krause
1729. m. Buch. 347 mit Noten des Garcaeus. Desgl. Leutliinger. Ed. Krause. Lib.
XVII. 599.
') v. Stillfried, a. a. 0. 46.
**) Die gröfste Aehnlichkeit im Grundrifs mit der St. Marien-Kirche zeigt die Haupt-
kirche des Klosters Etschmiadzin auf dem Ararat. Agincourt. I. T. XXVII. und Försters
Bauzeitung 1857, doeh wiirde für St. Marien auf die kunsthistorische Entwicldung von
Tournay, Noyon, Limburg mehr Gewicht zu legen sein.
sie ihre bauliche Gestaltung, wenn es auch möglich ist, dafs der
Typus der von Pribislav erbauten Gruftkirche in der centralen
Kreuzanlage traditionell erhalten ist. Unter Bezugnahme auf
diese Rücksicht erscheinen die vielen Treppen, von denen zwei von
der Geistlichkeit, zwei von den Ordensmitgliedern ausschliefslich
benutzt wurden, ferner die Emporen nebst den Altären ebenso
mötivirt, wie die vier Thürme zur Aufnahme des zahlreichen
Geläutes einer Wallfahrtskirche. Ebenso verständlich würde -die
Schwanenordenskapelle sein, wenn wir über die eigentliche Fest-
feierin derselben besser unterrichtet wären. Die Unterkapelle (St.
Leonhard geweiht) diente vielleicht zur Feier der Trauergottes-
dienste, wahrscheinlicher aber zur Ruhestätte derjenigen Ordens-
mitglieder, welche dies besonders wünschten, und von denen uns
die v. Waldenfels als dort begraben urkundlich genannt werden.
Die durchaus einfache, aber harmonische Lösung von Seiten der
Architektur bei einem sehr bescheidenen Maafsstabe steigern zwar
den Werth des Bauwerks, machen aber seinen Verlust um so
fühlbarer.
Auch für die’ Baugeschichte Brandenburgs würde grade St.
Marien auf dem Harlunger Berge die einzige bedeutende Lücke
ausfüllen, welche jetzt durch kein Bauwerk vertreten ist. Es
ist dies die Zeit von 1240 bis 1290. Aus der oben entwickel-
ten architektonischen Charakteristik und aus historischen Grün-
den, welche sich auf die specielle Geschichte des branden-
burgischen Domkapitels und des magdeburgischen ErzstifteS
stützen, mufs der Haupttheil von St. Marien, d. h. die überwölbte
Wällfahrtskirche von 1220 bis 1250, d. h. 100 Jahr nach der
ersten Stiftung und Weihung von neuem erbaut sein. Wieder
200 Jahre später ist dann urkundlich der kleinere Westtheil, die
Schwanenordenskapelle, auf 1440 zu stellen.
II. Kirche St. Nicolaus vor der Altstadt Brandenburg.
Historis-ches.
Diese Kirche wird urkundlich zuerst 1173 als bestehend
jj erwähnt, in welchem Jahre Bischof Siegfried dieselbe den Prä-
monstratenser Stiftsherren auf der Burg zu Brandenburg zur
geistlichen Besorgung überweist ’). Sie war damals die Pfarr-
] kirche des Dorfes Luckeberg und auf bischöfliche Veranlassung,
wahrscheinlich des Amtsvorgängers Wilmar um 1170 erbaut. Das
Dorf Luckeberg wird 1249 vom Markgrafen Johann I. der Alt-
stadt geschenkt •’) und nach 1295 mit derselben allmählig ver-
schmolzen 3). Die eintretende isolirte Lage der Kirche, sowie
auch die Fehdelust späterer Zeiten, z. B. die Quitzow’schen
Händel, welche 1403 dieselbe berührten, scheinen zu ihrem
Verfall beigetragen zu haben. In der Mitte des XV. Jahrhun-
derts war der darin befindliche Altar des heiligen Nicolaus „ver-
wüstet und vernichtigt“, so dafs sich ein wohlhabender Einwoh-
ner der Altstadt 1467 veranlafst fand, denselben zu erneuern
und so zu dotiren, dafs ein Priester bestellt werden konnte, der
dreimal wöchentlich daselbst Messe lesen sollte 4). Dieser Be-
stimmung wurde sie durch clie Reformation entzogen und nach-
mals als Kirche des altstädtischen Gottesackers bei Leichenpre-
digten benutzt, welchem Zwecke sie noch jetzt dient.
Aus der Urkunde von 1541 erfahren wir die Namen der
Heiligen, welchen die Altäre gewidmet waren, nämlich St. Ni-
colaus, St. Gertrud und St. Barbara.
Baubeschreibung.
Die Kirche liegt im Südwesten der Altstadt aüf einer kleinen
Erhöhung und ist in Förm einer dreischiffigen Basilika aus Back-
steinen gebaut. Die östlichen Theile der drei Schiffe sind über-
wölbt und mit einer Haupt- und zwei Nebenabsiden geschlossen.
Ein Querhaus ist nicht vorhanden oder wenigstens äufserlich nicht
characterisirt; dagegen tritt das Mittelschiff in chorartiger Bildung
beträchtlich über die Absiden der Seitenschiffe hinaus. Der auf
1) Gerken, Stiftshistorie 363. — Riedel a. a. O., VIII. 109 bis 112, 112.
2) Buchholtz, Geschichte d. Kurm. Brandenb. IV. 250.
3) Gercken, Fragnr. March. III, 7.
4) Riedel a. a. O., IX. 199 fg.
ausführen liefs. Es war die& eine Doppelkapelle, deren obere
(die eigentliche Ordenskapelle der Schwanenrittergesellschaft) von
der Wallfahrtskirche aus durch eine breite Treppe wie ein hoher
Chor zugänglich war. In die untere dem heiligen Leonhard ge-
weihte Kapelle führten zwei Wendeltreppen hinab, welche nach
oben auch die umlaufenden Emporen mit der Schwanenordens-
kapelle yei’banden, wie dies Bl. II. Fig. 4. durch die schraffii’ten,
tiefer liegenden Theile deutlich macht. Dieser spätgothische Bau
von 1440 war mit möglichster Schonung des alten Baues dem-
selben in geschickter Weise so angefügt woi'den, dafs er selbst
eine kleine Kreuzkirche darstellte. Keichgeschmückte Strebe-
pfeiler, deren Gliederung an gothische Backstein-Bauten der
zweiten Epoche, nach 1350, namentlich an die Pfeiler der St.
Katharinen-Kirche erinnert, umgaben den gewölbten Kapellenbau,
den spitzbogige Fenster, besonders ein breites derselben in der
westlichen Chorwand erleuchteten. Von den daneben um 1435
aufgefiihi’ten Klostergebäuden, wie von der Ringmauer mit ihren
Thox-en und Stationen, welche den ganzen Berggipfel umgab,
giebt Bl. I. Fig. 1. nach dem Oelgemälde von St. Godehard eine
annähernde Vorstellung. —
Ueber die sonstigen Constructionen, deren Details, der übri-
gen Ausstattung dieses so interessanten Bauwei’ks kann leider
nichts mitgetheilt wei’den, da die mir zugänglich gewesenen
Quellen darüber schweigen. Wohl aber l’ühmen die Zeitgenossen,
die den Bau noch ei’halten saheri, und unter denen Leuthingei’,
Sabinus und Garcaeus obenan stehen, den wunderbaren Eindruck,
den die an Glasgemälden, Altären, Geschlechtstafeln und Wappen-
schildern der adligen Geschlechter von Franken, Sachsen, Mark
Bi’andenburg und Pommei'n fast übex'reiche Kirche machte *).
Den baulichen Zusammenhang der verschiedenen Theile der Ma-
rienkirche beschreibt Garcaeus a. a. 0. in einer Note S. 347 sehr
deutlich, wenn er sagt:
Quorum illud, quocl occasum respicii, sqcellum subterraneum
habet S. Leonhardo sacrum, in quo nobiles a Waldenfels sepulchra
habuerunt. Ex hoc per angustos gradus lapideos turribus occi-
dentalibus inclusos, non modo in templum ipsum B. Virginis, sed jj
etiam altius in medium templi, utrinque scanditur ubi sunt ab
utroque latere stratae semitae mediocres modo tatae, ubi altaria
sunt, modo angustae, per quas recta itur ad turres orientales in \
hemicyclum orientis et rursus per similes gradus lapideos, quos
turres orientales aequales prioribus, interius continent, descenditur
in templum B. Virginis.
Von der gesammten kirchlichen Ausstattung ist 1) diö grofse
Glocke vom Jahr 1445, welche Kürfürst Joachim II. 1591 fort-
nehmen liefs im Dome zu Bei’lin noch voi’handen; 2) das vom
Propst zu Brandenburg an derx hohen Festtagen des Schwanen-
ordens getragene prachtvolle Mefsgewand in der Schatzkammer
des Domes daselbst noch befindlich 1 2). Mit Ausnahme einiger
Reliquien, welche wahrscheinlich den Wallfahrern auf der St.
Marien-Kirche gezeigt wurden und welche * die Schatzkammer
gleichfalls aufbewahrt, könnte auch der daselbst befindliche bei
der Restauration erneuei'te grofse' mit Wappenschildern ge-
schmückte Kronenleuchter von der St. Mai’ien-Kirche stammen.
Alles Uebrige ist unwiederbi’inglich verloren.
ßes-nltat.
Die St. Marien-Kirche zeigt die wohlerhaltene einheitliche
Anlage einer frühmittelalterlichen gewölbten Wallfahrtskirche,
wie sie mit ähnlicher Treppen- und Emporeneinrichtung nöch
der Dom St. Georg zu Limburg a. L. bewahrt hat**). Nur die-
sem Hauptzwecke, an gewissen Tagen eine grofse Menge von
Menschen, schauend und hörend aufnehmen zu können, verdankt
*) Vergl. besonders Sabinus in Garcaeus: Successiones familianm etc. Ed. Krause
1729. m. Buch. 347 mit Noten des Garcaeus. Desgl. Leutliinger. Ed. Krause. Lib.
XVII. 599.
') v. Stillfried, a. a. 0. 46.
**) Die gröfste Aehnlichkeit im Grundrifs mit der St. Marien-Kirche zeigt die Haupt-
kirche des Klosters Etschmiadzin auf dem Ararat. Agincourt. I. T. XXVII. und Försters
Bauzeitung 1857, doeh wiirde für St. Marien auf die kunsthistorische Entwicldung von
Tournay, Noyon, Limburg mehr Gewicht zu legen sein.
sie ihre bauliche Gestaltung, wenn es auch möglich ist, dafs der
Typus der von Pribislav erbauten Gruftkirche in der centralen
Kreuzanlage traditionell erhalten ist. Unter Bezugnahme auf
diese Rücksicht erscheinen die vielen Treppen, von denen zwei von
der Geistlichkeit, zwei von den Ordensmitgliedern ausschliefslich
benutzt wurden, ferner die Emporen nebst den Altären ebenso
mötivirt, wie die vier Thürme zur Aufnahme des zahlreichen
Geläutes einer Wallfahrtskirche. Ebenso verständlich würde -die
Schwanenordenskapelle sein, wenn wir über die eigentliche Fest-
feierin derselben besser unterrichtet wären. Die Unterkapelle (St.
Leonhard geweiht) diente vielleicht zur Feier der Trauergottes-
dienste, wahrscheinlicher aber zur Ruhestätte derjenigen Ordens-
mitglieder, welche dies besonders wünschten, und von denen uns
die v. Waldenfels als dort begraben urkundlich genannt werden.
Die durchaus einfache, aber harmonische Lösung von Seiten der
Architektur bei einem sehr bescheidenen Maafsstabe steigern zwar
den Werth des Bauwerks, machen aber seinen Verlust um so
fühlbarer.
Auch für die’ Baugeschichte Brandenburgs würde grade St.
Marien auf dem Harlunger Berge die einzige bedeutende Lücke
ausfüllen, welche jetzt durch kein Bauwerk vertreten ist. Es
ist dies die Zeit von 1240 bis 1290. Aus der oben entwickel-
ten architektonischen Charakteristik und aus historischen Grün-
den, welche sich auf die specielle Geschichte des branden-
burgischen Domkapitels und des magdeburgischen ErzstifteS
stützen, mufs der Haupttheil von St. Marien, d. h. die überwölbte
Wällfahrtskirche von 1220 bis 1250, d. h. 100 Jahr nach der
ersten Stiftung und Weihung von neuem erbaut sein. Wieder
200 Jahre später ist dann urkundlich der kleinere Westtheil, die
Schwanenordenskapelle, auf 1440 zu stellen.
II. Kirche St. Nicolaus vor der Altstadt Brandenburg.
Historis-ches.
Diese Kirche wird urkundlich zuerst 1173 als bestehend
jj erwähnt, in welchem Jahre Bischof Siegfried dieselbe den Prä-
monstratenser Stiftsherren auf der Burg zu Brandenburg zur
geistlichen Besorgung überweist ’). Sie war damals die Pfarr-
] kirche des Dorfes Luckeberg und auf bischöfliche Veranlassung,
wahrscheinlich des Amtsvorgängers Wilmar um 1170 erbaut. Das
Dorf Luckeberg wird 1249 vom Markgrafen Johann I. der Alt-
stadt geschenkt •’) und nach 1295 mit derselben allmählig ver-
schmolzen 3). Die eintretende isolirte Lage der Kirche, sowie
auch die Fehdelust späterer Zeiten, z. B. die Quitzow’schen
Händel, welche 1403 dieselbe berührten, scheinen zu ihrem
Verfall beigetragen zu haben. In der Mitte des XV. Jahrhun-
derts war der darin befindliche Altar des heiligen Nicolaus „ver-
wüstet und vernichtigt“, so dafs sich ein wohlhabender Einwoh-
ner der Altstadt 1467 veranlafst fand, denselben zu erneuern
und so zu dotiren, dafs ein Priester bestellt werden konnte, der
dreimal wöchentlich daselbst Messe lesen sollte 4). Dieser Be-
stimmung wurde sie durch clie Reformation entzogen und nach-
mals als Kirche des altstädtischen Gottesackers bei Leichenpre-
digten benutzt, welchem Zwecke sie noch jetzt dient.
Aus der Urkunde von 1541 erfahren wir die Namen der
Heiligen, welchen die Altäre gewidmet waren, nämlich St. Ni-
colaus, St. Gertrud und St. Barbara.
Baubeschreibung.
Die Kirche liegt im Südwesten der Altstadt aüf einer kleinen
Erhöhung und ist in Förm einer dreischiffigen Basilika aus Back-
steinen gebaut. Die östlichen Theile der drei Schiffe sind über-
wölbt und mit einer Haupt- und zwei Nebenabsiden geschlossen.
Ein Querhaus ist nicht vorhanden oder wenigstens äufserlich nicht
characterisirt; dagegen tritt das Mittelschiff in chorartiger Bildung
beträchtlich über die Absiden der Seitenschiffe hinaus. Der auf
1) Gerken, Stiftshistorie 363. — Riedel a. a. O., VIII. 109 bis 112, 112.
2) Buchholtz, Geschichte d. Kurm. Brandenb. IV. 250.
3) Gercken, Fragnr. March. III, 7.
4) Riedel a. a. O., IX. 199 fg.