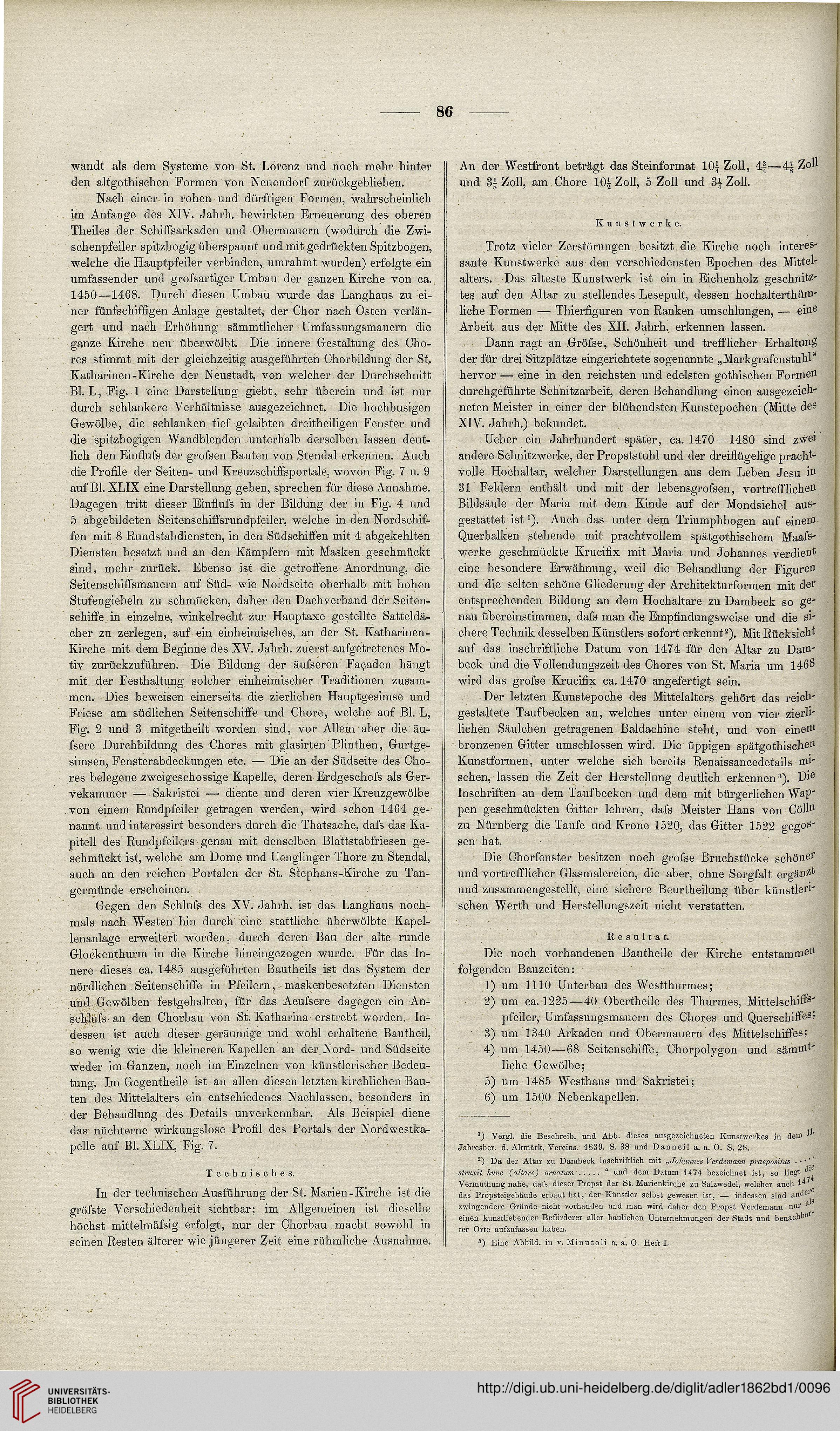86
wandt als dem Systeme von St. Lorenz und noch mehr hinter
den altgothisclien Formen von Neuendorf zurückgeblieben.
JsTach einer in rohen und dürftigen Formen, wahrscheinlich
im Anfange des XIV. Jahrh. bewirkten Erneuerung des oberen
Theiles der Schiffsarkaden und Obermauern (wodurch die Zwi-
schenpfeiler spit-zbogig überspannt tmd mit gedrückten Spitzbogen,
welche die Hauptpfeiler verbinden, umrahmt wurden) erfolgte ein
umfassender und grofsartiger Umbau der ganzen Kirche von ca.
1450—1468. Durch diesen Umbau wurde das Langhaus zu ei-
ner fünfschiffigen Anlage gestaltet, der Chor nach Osten verlän-
gert und nach Erhöhung sämmtlicher Umfassungsmauern die
ganze Kirche neu überwölbt. Die innere Gestaltung des Cho-
res stimmt mit der gleichzeitig ausgeführten Chorbildung der St.
Katharinen-Kirche der Neustadt, von welcher der Durchschnitt
Bl. L, Fig. 1 eine Darstellung giebt, sehr überein und ist nur
durch schlankere Verhältnisse ausgezeichnet. Die hochbusigen
Gewölbe, die schlanken tief gelaibten dreitheiligen Fenster und
die spitzbogigen Wandblenden unterhalb derselben lassen deut-
lich den Einflufs der grofsen Bauten von Stendal erkennen. Auch
die Profile der Seiten- und Kreuzschiffsportale, wovon Fig. 7 u. 9
auf Bl. XLIX eine Darstellung geben, sprechen für diese Annahme.
Dagegen tritt dieser Einflufs in der Bildung der in Fig. 4 und
5 abgebildeten Seitenschiffsrundpfeiler, welche in den Nordschif-
fen mit 8 Rundstabdiensten, in den Südschiffen mit 4 abgekehlten
Diensten besetzt und an den Kämpfern mit Masken geschmückt
sind, mehr zurück. Ebenso ist die getroffene Anordnung, die
Seitenschiffsmauern auf Süd- wie Nordseite oberhalb mit hohen
Stufengiebeln zu schmücken, daher den Dachverband der Seiten-
schiffe in einzelne, winkelrecht zur Iiauptaxe gestellte Satteldä-
cher zu zerlegen, auf ein einheimisches, an der St. Katharinen-
Kirche mit dem Beginne des XV. Jahrh. zuerst aufgetretenes Mo-
tiv zurückzuführen. Die Bildung der äufseren Fa^aden hängt
mit der Festhaltung solcher einheimischer Traditionen zusam-
men. Dies beweisen einerseits die ziexdichen Hauptgesimse und
Fi’iese am südlichen Seitenschiffe und Chore, welche auf Bl. L,
Fig. 2 und 3 mitgetheilt worden sind, vor Allem aber die äu-
fsere Durchbildung des Chores mit glasirten Blinthen, Gurtge-
simsen, Fensterabdeckungen etc. — Die an der Südseite des Cho-
res belegene zweigeschossige Kapelle, deren Erdgeschofs als Ger-
vekammer — Sakristei — diente und deren vier Kreuzgewölbe
von einem Rundpfeiler getragen werden, wird schon 1464 ge-
nannt und interessirt besonders durch die Thatsache, dafs das Ka-
pitell des Rundpfeilers genau mit denselbeix Blattstabfriesen ge-
schmückt ist, welche am Dome und Uenglinger Thore zu Stendal,
auch an den reichen Portalen der St. Stephans-Kirche zu Tan-
germünde erscheinen.
Gegen den Schlufs des XV. Jahx’h. ist das Langhaus noch-
mals nach Westen hin durch eine stattliche überwölbte Kapel-
lenanlage erweitert worden, dux*ch deren Bau der alte runde
Glockenthurm in die Kirche hineingezogen wurde. Für das In-
nere dieses ca. 1485 ausgeführten Bautheils ist das System der
nördlichen Seitenschiffe in Pfeilern, maskenbesetzten Diensten
und Gewölben festgehalten, für das Aeufsere dagegen ein An-
schlufs an den Chorbau von St. Katharina erstrebt worden. In-
dessen ist auch dieser geräumige und wohl erhaltene Bautheil,
so wenig wie die kleineren Kapellen an der Nord- und Südseite
weder im Ganzen, noch irn Einzelnen von künstlerischer Bedeu-
tuno-. Im Gesentheile ist an allen diesen letzten kirchlichen Bau-
ten des Mittelalters ein entschiedenes Nachlassen, besonders in
der Behandlung des Details unverkennbar. Als Beispiel diene
das nüchtei’ne wirkungslose Profil des Poi’tals der Nordwestka-
pelle auf Bl. XLIX, Fig. 7.
Technisches.
In der technischen Ausführung der St. Marien-Kirche ist die
gröfste Verschiedenheit sichtbar; im Allgemeinen ist dieselbe
höchst mittelmäfsig erfolgt, nur der Chorbau macht sowohl in
seinen Resten älterer wie jüngerer Zeit eine rühmliche Ausnahme.
An der Westfront beträgt das Steinformat 10) Zoll, 4|—4| Zoll
und 3| Zoll, am Chore 10| Zoll, 5 Zoll und 3^ Zolh
Kunstwerke.
Trotz vieler Zerstörungen besitzt die Kirche noch intei’es-
sante Kunstwerke aus den verschiedensten Epochen des Mittel-
alters. Das älteste Kunstwerk ist ein in Eichenholz geschnitZ'
tes auf den Altar zu stellendes Lesepult, dessen hochalterthüiT'
liche Foi’men — Thierfiguren von Ranken umschlungen, — ein e
Arbeit aus der Mitte des XII. Jahrh. erkennen lassen.
Dann ragt an Gröfse, Schönheit und trefflicher Ei’haltung
der fiir drei Sitzplätze eingerichtete sogenannte „Markgrafenstuhl“
hei’vor — eine in den reichsten und edelsten gothischen Foi’mßü
durchgeführte Schnitzai’beit, deren Behandlung einen ausgezeich-
neten Meister in einer der blühendsten Kunstepochen (Mitte deS
XIV. Jahrh.) bekundet.
Ueber ein Jahi’hundert später, ca. 1470—1480 sind zwei
andere Schnitzwerke, der Propststuhl und der dreiflügelige pracffl'
volle Hochaltar, welcher Darstellungen aus dem Leben Jesu iü
31 Feldern enthält und mit der lebensgrofsen, vortrefflichen
Bildsäule der Maria mit dem Kinde auf der Mondsichel aus-
gestattet ist *). Auch das unter dem Triumphbogen auf einein
Querbalken stehende nxit prachtvollem spätgothischem Maafs-
werke geschmückte Krucifix mit Maria und Johannes vei’dient
eine besondere Erwähnung, weil die Behandlung der Figuren
und die selten schöne Gliederung der Architekturfornxen mit def
entsprechenden Bildung an dem Hochaltare zu Dambeck so g e'
näu übereinstimmen, dafs man die Empfindungsweise und die si'
chere Technik desselben Künstlers sofort erkennt * 2). Mit RücksicU
auf das inschriftliche Datum von 1474 für den Altar zu DaiC'
beck und die Vollendungszeit des Choi’es von St. Maria um 146^
wird das grofse Krucifix ca. 1470 angefertigt sein.
Der letzten Kunstepoche des Mittelalters gehört das reich-
gestaltete Taufbecken an, welches unter einem von vier zierli'
lichen Säulchen getragenen Baldachine steht, und von eineiü
bronzenen Gitter umschlossen wird. Die üppigen spätgothisch erJ
Kunstformen, unter welche sich bereits Renaissancedetails i»i'
schen, lassen die Zeit der Herstellung deutlich erkennen 3 * * * * 8). Di e
Inschriften an dem Taufbecken und dem mit bürgei’lichen Wap'
pen geschmückten Gitter lehren, dafs Meister Hans von CölD
zu Nürnbei’g die Taufe und Krone 1520, das Gitter 1522 gegos-
sen hat.
Die Chorfenster besitzen noch grofse Bruchstücke schönd’
und vortrefflicher Glasmalereien, die abex% ohxxe Sorsfalt eriränA
und zusammengestellt, eine sichere Beurtheilung über künstlei’ 1'
schen Werth und Herstellungszeit nicht verstatten.
Resultat.
Die noch vorhandenen Bautheile der Kirche entstamm el1
folgenden Bauzeiten:
1) um 1110 Unterbau des Westthurmes;
2) um ca. 1225—40 Obertheile des Thurmes, Mittelscbifl s'
pfeiler, Umfassungsmauern des Chores und Querschiff eS’
3) um 1340 Arkaden und Obermauern des Mittelschiffes;
4) um 1450 — 68 Seitenschiffe, Choi’polygon und sämnJ'
liche Gewölbe;
5) unx 1485 Westhaus und Sakristei;
6) uxn 1500 Nebenkapellen.
*) Vergl. die Beschreib. und Abb. dieses ausgezeichnoten Kunstwerkes in dem J'
Jahresber. d. Altmärk. Vereins. 1839. S. 38 und Danneil a. a. O. S. 28.
2) Da der Altar zu Dambeck inschriftlich mit „Johannes Verdem.ann praepositus • • *'
struxit hunc (altare) ornatum.“ und dem Datum 1474 bezeichnet ist, so liegt ^ 1®
Vermuthung nahe, dafs dieser Propst der St. Marienkirche zu Salzwedel, welcher auch
das Propsteigebäude erbaut hat, der Künstler selbst gewesen ist, — indessen sind and el
zwingendere Gründe nieht vorhanden und man wird daher den Propst Verdemann nur
einen kunstliebenden Beförderer aller baulichen Unternehmungen der Stadt und benaohb* 11
ter Örte aufzufassen haben.
8) Eine Abbild. in v. Minutoli a. a. O. Heft I.
wandt als dem Systeme von St. Lorenz und noch mehr hinter
den altgothisclien Formen von Neuendorf zurückgeblieben.
JsTach einer in rohen und dürftigen Formen, wahrscheinlich
im Anfange des XIV. Jahrh. bewirkten Erneuerung des oberen
Theiles der Schiffsarkaden und Obermauern (wodurch die Zwi-
schenpfeiler spit-zbogig überspannt tmd mit gedrückten Spitzbogen,
welche die Hauptpfeiler verbinden, umrahmt wurden) erfolgte ein
umfassender und grofsartiger Umbau der ganzen Kirche von ca.
1450—1468. Durch diesen Umbau wurde das Langhaus zu ei-
ner fünfschiffigen Anlage gestaltet, der Chor nach Osten verlän-
gert und nach Erhöhung sämmtlicher Umfassungsmauern die
ganze Kirche neu überwölbt. Die innere Gestaltung des Cho-
res stimmt mit der gleichzeitig ausgeführten Chorbildung der St.
Katharinen-Kirche der Neustadt, von welcher der Durchschnitt
Bl. L, Fig. 1 eine Darstellung giebt, sehr überein und ist nur
durch schlankere Verhältnisse ausgezeichnet. Die hochbusigen
Gewölbe, die schlanken tief gelaibten dreitheiligen Fenster und
die spitzbogigen Wandblenden unterhalb derselben lassen deut-
lich den Einflufs der grofsen Bauten von Stendal erkennen. Auch
die Profile der Seiten- und Kreuzschiffsportale, wovon Fig. 7 u. 9
auf Bl. XLIX eine Darstellung geben, sprechen für diese Annahme.
Dagegen tritt dieser Einflufs in der Bildung der in Fig. 4 und
5 abgebildeten Seitenschiffsrundpfeiler, welche in den Nordschif-
fen mit 8 Rundstabdiensten, in den Südschiffen mit 4 abgekehlten
Diensten besetzt und an den Kämpfern mit Masken geschmückt
sind, mehr zurück. Ebenso ist die getroffene Anordnung, die
Seitenschiffsmauern auf Süd- wie Nordseite oberhalb mit hohen
Stufengiebeln zu schmücken, daher den Dachverband der Seiten-
schiffe in einzelne, winkelrecht zur Iiauptaxe gestellte Satteldä-
cher zu zerlegen, auf ein einheimisches, an der St. Katharinen-
Kirche mit dem Beginne des XV. Jahrh. zuerst aufgetretenes Mo-
tiv zurückzuführen. Die Bildung der äufseren Fa^aden hängt
mit der Festhaltung solcher einheimischer Traditionen zusam-
men. Dies beweisen einerseits die ziexdichen Hauptgesimse und
Fi’iese am südlichen Seitenschiffe und Chore, welche auf Bl. L,
Fig. 2 und 3 mitgetheilt worden sind, vor Allem aber die äu-
fsere Durchbildung des Chores mit glasirten Blinthen, Gurtge-
simsen, Fensterabdeckungen etc. — Die an der Südseite des Cho-
res belegene zweigeschossige Kapelle, deren Erdgeschofs als Ger-
vekammer — Sakristei — diente und deren vier Kreuzgewölbe
von einem Rundpfeiler getragen werden, wird schon 1464 ge-
nannt und interessirt besonders durch die Thatsache, dafs das Ka-
pitell des Rundpfeilers genau mit denselbeix Blattstabfriesen ge-
schmückt ist, welche am Dome und Uenglinger Thore zu Stendal,
auch an den reichen Portalen der St. Stephans-Kirche zu Tan-
germünde erscheinen.
Gegen den Schlufs des XV. Jahx’h. ist das Langhaus noch-
mals nach Westen hin durch eine stattliche überwölbte Kapel-
lenanlage erweitert worden, dux*ch deren Bau der alte runde
Glockenthurm in die Kirche hineingezogen wurde. Für das In-
nere dieses ca. 1485 ausgeführten Bautheils ist das System der
nördlichen Seitenschiffe in Pfeilern, maskenbesetzten Diensten
und Gewölben festgehalten, für das Aeufsere dagegen ein An-
schlufs an den Chorbau von St. Katharina erstrebt worden. In-
dessen ist auch dieser geräumige und wohl erhaltene Bautheil,
so wenig wie die kleineren Kapellen an der Nord- und Südseite
weder im Ganzen, noch irn Einzelnen von künstlerischer Bedeu-
tuno-. Im Gesentheile ist an allen diesen letzten kirchlichen Bau-
ten des Mittelalters ein entschiedenes Nachlassen, besonders in
der Behandlung des Details unverkennbar. Als Beispiel diene
das nüchtei’ne wirkungslose Profil des Poi’tals der Nordwestka-
pelle auf Bl. XLIX, Fig. 7.
Technisches.
In der technischen Ausführung der St. Marien-Kirche ist die
gröfste Verschiedenheit sichtbar; im Allgemeinen ist dieselbe
höchst mittelmäfsig erfolgt, nur der Chorbau macht sowohl in
seinen Resten älterer wie jüngerer Zeit eine rühmliche Ausnahme.
An der Westfront beträgt das Steinformat 10) Zoll, 4|—4| Zoll
und 3| Zoll, am Chore 10| Zoll, 5 Zoll und 3^ Zolh
Kunstwerke.
Trotz vieler Zerstörungen besitzt die Kirche noch intei’es-
sante Kunstwerke aus den verschiedensten Epochen des Mittel-
alters. Das älteste Kunstwerk ist ein in Eichenholz geschnitZ'
tes auf den Altar zu stellendes Lesepult, dessen hochalterthüiT'
liche Foi’men — Thierfiguren von Ranken umschlungen, — ein e
Arbeit aus der Mitte des XII. Jahrh. erkennen lassen.
Dann ragt an Gröfse, Schönheit und trefflicher Ei’haltung
der fiir drei Sitzplätze eingerichtete sogenannte „Markgrafenstuhl“
hei’vor — eine in den reichsten und edelsten gothischen Foi’mßü
durchgeführte Schnitzai’beit, deren Behandlung einen ausgezeich-
neten Meister in einer der blühendsten Kunstepochen (Mitte deS
XIV. Jahrh.) bekundet.
Ueber ein Jahi’hundert später, ca. 1470—1480 sind zwei
andere Schnitzwerke, der Propststuhl und der dreiflügelige pracffl'
volle Hochaltar, welcher Darstellungen aus dem Leben Jesu iü
31 Feldern enthält und mit der lebensgrofsen, vortrefflichen
Bildsäule der Maria mit dem Kinde auf der Mondsichel aus-
gestattet ist *). Auch das unter dem Triumphbogen auf einein
Querbalken stehende nxit prachtvollem spätgothischem Maafs-
werke geschmückte Krucifix mit Maria und Johannes vei’dient
eine besondere Erwähnung, weil die Behandlung der Figuren
und die selten schöne Gliederung der Architekturfornxen mit def
entsprechenden Bildung an dem Hochaltare zu Dambeck so g e'
näu übereinstimmen, dafs man die Empfindungsweise und die si'
chere Technik desselben Künstlers sofort erkennt * 2). Mit RücksicU
auf das inschriftliche Datum von 1474 für den Altar zu DaiC'
beck und die Vollendungszeit des Choi’es von St. Maria um 146^
wird das grofse Krucifix ca. 1470 angefertigt sein.
Der letzten Kunstepoche des Mittelalters gehört das reich-
gestaltete Taufbecken an, welches unter einem von vier zierli'
lichen Säulchen getragenen Baldachine steht, und von eineiü
bronzenen Gitter umschlossen wird. Die üppigen spätgothisch erJ
Kunstformen, unter welche sich bereits Renaissancedetails i»i'
schen, lassen die Zeit der Herstellung deutlich erkennen 3 * * * * 8). Di e
Inschriften an dem Taufbecken und dem mit bürgei’lichen Wap'
pen geschmückten Gitter lehren, dafs Meister Hans von CölD
zu Nürnbei’g die Taufe und Krone 1520, das Gitter 1522 gegos-
sen hat.
Die Chorfenster besitzen noch grofse Bruchstücke schönd’
und vortrefflicher Glasmalereien, die abex% ohxxe Sorsfalt eriränA
und zusammengestellt, eine sichere Beurtheilung über künstlei’ 1'
schen Werth und Herstellungszeit nicht verstatten.
Resultat.
Die noch vorhandenen Bautheile der Kirche entstamm el1
folgenden Bauzeiten:
1) um 1110 Unterbau des Westthurmes;
2) um ca. 1225—40 Obertheile des Thurmes, Mittelscbifl s'
pfeiler, Umfassungsmauern des Chores und Querschiff eS’
3) um 1340 Arkaden und Obermauern des Mittelschiffes;
4) um 1450 — 68 Seitenschiffe, Choi’polygon und sämnJ'
liche Gewölbe;
5) unx 1485 Westhaus und Sakristei;
6) uxn 1500 Nebenkapellen.
*) Vergl. die Beschreib. und Abb. dieses ausgezeichnoten Kunstwerkes in dem J'
Jahresber. d. Altmärk. Vereins. 1839. S. 38 und Danneil a. a. O. S. 28.
2) Da der Altar zu Dambeck inschriftlich mit „Johannes Verdem.ann praepositus • • *'
struxit hunc (altare) ornatum.“ und dem Datum 1474 bezeichnet ist, so liegt ^ 1®
Vermuthung nahe, dafs dieser Propst der St. Marienkirche zu Salzwedel, welcher auch
das Propsteigebäude erbaut hat, der Künstler selbst gewesen ist, — indessen sind and el
zwingendere Gründe nieht vorhanden und man wird daher den Propst Verdemann nur
einen kunstliebenden Beförderer aller baulichen Unternehmungen der Stadt und benaohb* 11
ter Örte aufzufassen haben.
8) Eine Abbild. in v. Minutoli a. a. O. Heft I.