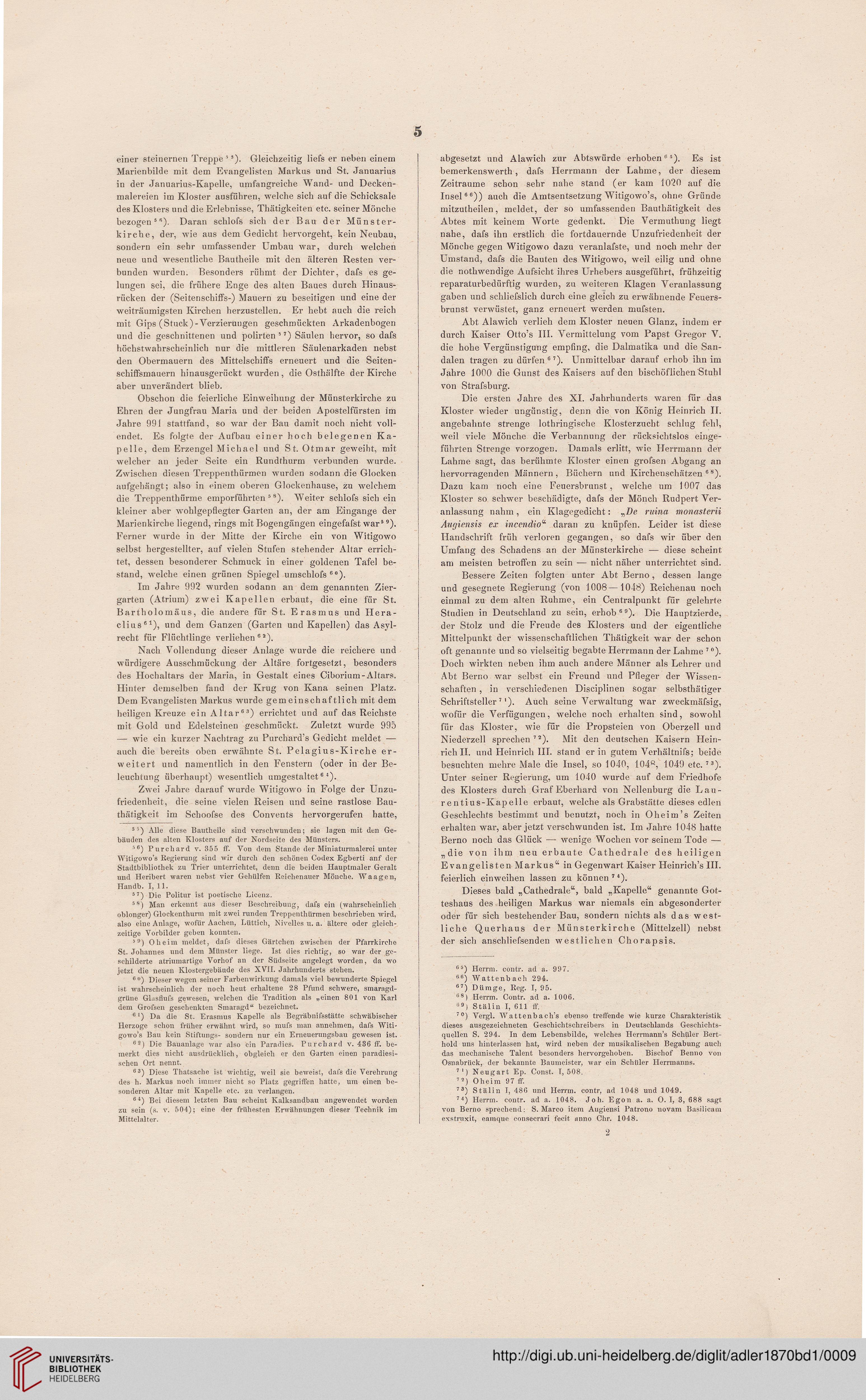5
einer steinernen Treppe 5'). Gleichzeitig liefs er neben einem
Marienbilde mit dem Evangelisten Markus und St. Januarius
in der Januarius-Kapelle, umfangreiche Wand- und Decken-
malereien im Kloster ausführen, welche sich auf die Schicksale
des Klosters und die Erlebnisse, Thätigkeiten etc. seiner Mönche
bezogen56). Daran schlofs sich der Bau der Münster-
kirche, der, wie aus dem Gedicht hervorgeht, kein Neubau,
sondern ein sehr umfassender Umbau war, durch welchen
neue und wesentliche Bautheile mit den älteren Resten ver-
bunden wurden. Besonders rühmt der Dichter, dafs es ge-
lungen sei, die frühere Enge des alten Baues durch Hinaus-
rücken der (Seitenschiffs-) Mauern zu beseitigen und eine der
weiträumigsten Kirchen herzustellen. Er hebt auch die reich
mit Gips (Stuck)-Verzierungen geschmückten Arkadenbogen
und die geschnittenen und polirten '') Säulen hervor, so dafs
höchstwahrscheinlich nur die mittleren Säulenarkaden nebst
den Obermauern des Mittelschiffs erneuert und die Seiten-
schiffsmauern hinausgerückt wurden , die Osthälfte der Kirche
aber unverändert blieb.
Obschon die feierliche Einweihung der Münsterkirche zu
Ehren der Jungfrau Maria und der beiden Apostelfürsten im
Jahre 991 stattfand, so war der Bau damit noch nicht voll-
endet. Es folgte der Aufbau einer hoch belegenen Ka-
pelle, dem Erzengel Michael und St. Otmar geweiht, mit
welcher an jeder Seite ein Rundthurm verbunden wurde.
Zwischen diesen Treppenthürmen wurden sodann die Glocken
aufgehängt; also in einem oberen Glockenhause, zu welchem
die Treppenthürme emporführten 5 8). Weiter schlofs sich ein
kleiner aber wohlgepflegter Garten an, der am Eingange der
Marienkirche liegend, rings mit Bogengängen eingefafst war5 9).
Ferner wurde in der Mitte der Kirche ein von Witigowo
selbst hergestellter, auf vielen Stufen stehender Altar errich-
tet, dessen besonderer Schmuck in einer goldenen Tafel be-
stand, welche einen grünen Spiegel umschlofs 6°).
Im Jahre 992 wurden sodann an dem genannten Zier-
garten (Atrium) zwei Kapellen erbaut, die eine für St.
Bartholomäus, die andere für St. Erasmus und Hera-
clius61), und dem Ganzen (Garten und Kapellen) das Asyl-
recht für Flüchtlinge verliehen62).
Nach Vollendung dieser Anlage wurde die reichere und
würdigere Ausschmückung der Altäre fortgesetzt, besonders
des Hochaltars der Maria, in Gestalt eines Ciborium-Altars.
Hinter demselben fand der Krug von Kana seinen Platz.
Dem Evangelisten Markus wurde gemeinschaftlich mit dem
heiligen Kreuze ein Altar63) errichtet und auf das Reichste
mit Gold und Edelsteinen geschmückt. Zuletzt wurde 995
— wie ein kurzer Nachtrag zu Purchard's Gedicht meldet —
auch die bereits oben erwähnte St. Pelagius-Kirche er-
weitert und namentlich in den Fenstern (oder in der Be-
leuchtung überhaupt) wesentlich umgestaltet64).
Zwei Jahre darauf wurde Witigowo in Folge der Unzu-
friedenheit, die seine vielen Reisen und seine rastlose Bau-
tätigkeit im Schoofse des Convents hervorgerufen hatte,
5i) Alle diese Bautheile sind verschwunden; sie lagen mit den Ge-
bäuden des alten Klosters auf der Nordseite des Münsters.
'•) Purchard v. 355 ff. Von dem Stande der Miniaturmalerei unter
Witigowo'« Regierung sind wir durch den schönen Codex Egberti anf der
Stadtbibliothek zu Trier unterrichtet, denn die beiden Hauptmaler Geralt
und Heribert waren nebst vier Gehülfen Reichenauer Mönche. Waagen,
Handb. I, 11.
57) Die Politur ist poetische Licenz.
58) Man erkennt aus dieser Beschreibung, dafs ein (wahrscheinlich
oblonger) Glockenthurm mit zwei runden Treppenthürmen besehrieben wird,
also eine Anlage, wofür Aachen, Lüttich, Nivelles u. a. ältere oder gleich-
zeitige Vorbilder geben konnten.
s9) Oheim meldet, dafs dieses Gärtchcn zwischen der Pfarrkirche
St. Johannes und dem Münster liege. Ist dies richtig, so war der ge-
schilderte atriumartige Vorhof an der Südseite angelegt worden, da wo
jetzt die neuen Klostergebäude des XVII. Jahrhunderts stehen.
6 °) Dieser wegen seiner Farbenwirkung damals viel bewunderte Spiegel
ist wahrscheinlich der noch heut erhaltene 28 Pfund schwere, smaragd-
grüne Ghisflufs gewesen, welchen die Tradition als „einen 801 von Karl
dem Grofsen geschenkten Smaragd" bezeichnet.
61) Da die St. Erasmus Kapelle als Begräbnifsstätte schwäbischer
Herzoge schon früher erwähnt wird, so mufs man annehmen, dafs Witi-
gowo's Bau kein Stiftungs- sondern nur ein Erneuerungsbau gewesen ist.
62) Die Bauanlage war also ein Paradies. Purchard v. 436 ff. be-
merkt dies nicht ausdrücklich, obgleich er den Garten einen paradiesi-
schen Ort nennt.
63) Diese Thatsache ist wichtig, weil sie beweist, dafs die Verehrung
des h. Markus noch immer nicht so Platz gegriffen hatte, um einen be-
sonderen Altar mit Kapelle etc. zu verlangen.
64) Bei diesem letzten Bau scheint Kalksandbau angewendet worden
zu sein (s. v. 504); eine der frühesten Erwähnungen dieser Technik im
Mittelalter.
abgesetzt und Alawich zur Abtswürde erhoben65). Es ist
bemerkenswert , dafs Herrmann der Lahme, der diesem
Zeiträume schon sehr nahe stand (er kam 1020 auf die
Insel66)) auch die Amtsentsetzung Witigowo's, ohne Gründe
mitzutheilen, meldet, der so umfassenden Bauthätigkeit des
Abtes mit keinem Worte gedenkt. Die Vermuthung liegt
nahe, dafs ihn erstlich die fortdauernde Unzufriedenheit der
Mönche gegen Witigowo dazu veranlafste, und noch mehr der
Umstand, dafs die Bauten des Witigowo, weil eilig und ohne
die nothwendige Aufsicht ihres Urhebers ausgeführt, frühzeitig
reparaturbedürftig wurden, zu weiteren Klagen Veranlassung
gaben und schliefslich durch eine gleich zu erwähnende Feuers-
brunst verwüstet, ganz erneuert werden mufsten.
Abt Alawich verlieh dem Kloster neuen Glanz, indem er
durch Kaiser Otto's III. Vermittelung vom Papst Gregor V.
die hohe Vergünstigung empfing, die Dalmatika und die San-
dalen tragen zu dürfen67). Unmittelbar darauf erhob ihn im
Jahre 1000 die Gunst des Kaisers auf den bischöflichen Stuhl
von Strafsburg.
Die ersten Jahre des XI. Jahrhunderts waren für das
Kloster wieder ungünstig, denn die von König Heinrich II.
angebahnte strenge lothringische Klosterzucht schlug fehl,
weil viele Mönche die Verbannung der rücksichtslos einge-
führten Strenge vorzogen. Damals erlitt, wie Herrmann der
Lahme sagt, das berühmte Kloster einen grofsen Abgang an
hervorragenden Männern, Büchern und Kirchenschätzen68).
Dazu kam noch eine Feuersbrunst, welche um 1007 das
Kloster so schwer beschädigte, dafs der Mönch Rudpert Ver-
anlassung nahm, ein Klagegedicht: „De ruina monasterii
Augiensis ex incendio" daran zu knüpfen. Leider ist diese
Handschrift früh verloren gegangen, so dafs wir über den
Umfang des Schadens an der Münsterkirche — diese scheint
am meisten betroffen zu sein — nicht näher unterrichtet sind.
Bessere Zeiten folgten unter Abt Berno, dessen lange
und gesegnete Regierung (von 1008— 1048) Reichenau noch
einmal zu dem alten Ruhme, ein Centraipunkt für gelehrte
Studien in Deutschland zu sein, erhob69). Die Hauptzierde,
der Stolz und die Freude des Klosters und der eigentliche
Mittelpunkt der wissenschaftlichen Thätigkeit war der schon
oft genannte und so vielseitig begabte Herrmann der Lahme 7 n).
Doch wirkten neben ihm auch andere Männer als Lehrer und
Abt Berno war selbst ein Freund und Pfleger der Wissen-
schaften , in verschiedenen Disciplinen sogar selbsthätiger
Schriftsteller71). Auch seine Verwaltung war zweckmäfsig,
wofür die Verfügungen, welche noch erhalten sind, sowohl
für das Kloster, wie für die Propsteien von Oberzell und
Niederzell sprechen 7 2). Mit den deutschen Kaisern Hein-
rich II. und Heinrich III. stand er in gutem Verhältnifs; beide
besuchten mehre Male die Insel, so 1040, 104S, 1049 etc. 73).
Unter seiner Regierung, um 1040 wurde auf dem Friedhofe
des Klosters durch Graf Eberhard von Nellenburg die Lau-
rentius-Kapelle erbaut, welche als Grabstätte dieses edlen
Geschlechts bestimmt und benutzt, noch in Oheim's Zeiten
erhalten war, aber jetzt verschwunden ist. Im Jahre 1048 hatte
Berno noch das Glück — wenige Wochen vor seinem Tode —
„die von ihm neu erbaute Cathedrale des heiligen
Evangelisten Markus" in Gegenwart Kaiser Heinrich's III.
feierlich einweihen lassen zu können74).
Dieses bald „Cathedrale", bald „Kapelle" genannte Got-
teshaus des heiligen Markus war niemals ein abgesonderter
oder für sich bestehender Bau, sondern nichts als das west-
liche Querhaus der Münsterkirche (Mittelzell) nebst
der sich anschliefsenden westlichen Chorapsis.
65) Herrm. contr. ad a. 997.
8<i) Wattenbach 294.
67) Dümge, Reg. I, 95.
68) Herrm. Contr. ad a. 1006.
69| Stttlin I, 611 ff.
7°) Vergl. YVattenbach's ebenso treffende wie kurze Charakteristik
dieses ausgezeichneten Geschichtschreibers in Deutschlands Geschichts-
quellen S. 294. In dem Lebensbilde, welches Herrmann's Schüler Bert-
hold uns hinterlassen hat, wird neben der musikalischen Begabung auch
das mechanische Talent besonders hervorgehoben. Bischof Benno von
Osnabrück, der bekannte Baumeister, war ein Schüler Herrmanns.
71) Neugart Ep. Const. 1,508.
72) Oheim 97 ff.
73) Stälin I, 486 und Herrin, contr, ad 1048 und 1049.
74) Herrm. contr. ad a. 1048. Job. Egon a. a. O. 1, 3, 688 sagt
von Berno sprechend: S.Marco item Augiensi Patrono novam Basiiicam
exstruxit, eamque consecrari feeit anno Chr. 1048.
einer steinernen Treppe 5'). Gleichzeitig liefs er neben einem
Marienbilde mit dem Evangelisten Markus und St. Januarius
in der Januarius-Kapelle, umfangreiche Wand- und Decken-
malereien im Kloster ausführen, welche sich auf die Schicksale
des Klosters und die Erlebnisse, Thätigkeiten etc. seiner Mönche
bezogen56). Daran schlofs sich der Bau der Münster-
kirche, der, wie aus dem Gedicht hervorgeht, kein Neubau,
sondern ein sehr umfassender Umbau war, durch welchen
neue und wesentliche Bautheile mit den älteren Resten ver-
bunden wurden. Besonders rühmt der Dichter, dafs es ge-
lungen sei, die frühere Enge des alten Baues durch Hinaus-
rücken der (Seitenschiffs-) Mauern zu beseitigen und eine der
weiträumigsten Kirchen herzustellen. Er hebt auch die reich
mit Gips (Stuck)-Verzierungen geschmückten Arkadenbogen
und die geschnittenen und polirten '') Säulen hervor, so dafs
höchstwahrscheinlich nur die mittleren Säulenarkaden nebst
den Obermauern des Mittelschiffs erneuert und die Seiten-
schiffsmauern hinausgerückt wurden , die Osthälfte der Kirche
aber unverändert blieb.
Obschon die feierliche Einweihung der Münsterkirche zu
Ehren der Jungfrau Maria und der beiden Apostelfürsten im
Jahre 991 stattfand, so war der Bau damit noch nicht voll-
endet. Es folgte der Aufbau einer hoch belegenen Ka-
pelle, dem Erzengel Michael und St. Otmar geweiht, mit
welcher an jeder Seite ein Rundthurm verbunden wurde.
Zwischen diesen Treppenthürmen wurden sodann die Glocken
aufgehängt; also in einem oberen Glockenhause, zu welchem
die Treppenthürme emporführten 5 8). Weiter schlofs sich ein
kleiner aber wohlgepflegter Garten an, der am Eingange der
Marienkirche liegend, rings mit Bogengängen eingefafst war5 9).
Ferner wurde in der Mitte der Kirche ein von Witigowo
selbst hergestellter, auf vielen Stufen stehender Altar errich-
tet, dessen besonderer Schmuck in einer goldenen Tafel be-
stand, welche einen grünen Spiegel umschlofs 6°).
Im Jahre 992 wurden sodann an dem genannten Zier-
garten (Atrium) zwei Kapellen erbaut, die eine für St.
Bartholomäus, die andere für St. Erasmus und Hera-
clius61), und dem Ganzen (Garten und Kapellen) das Asyl-
recht für Flüchtlinge verliehen62).
Nach Vollendung dieser Anlage wurde die reichere und
würdigere Ausschmückung der Altäre fortgesetzt, besonders
des Hochaltars der Maria, in Gestalt eines Ciborium-Altars.
Hinter demselben fand der Krug von Kana seinen Platz.
Dem Evangelisten Markus wurde gemeinschaftlich mit dem
heiligen Kreuze ein Altar63) errichtet und auf das Reichste
mit Gold und Edelsteinen geschmückt. Zuletzt wurde 995
— wie ein kurzer Nachtrag zu Purchard's Gedicht meldet —
auch die bereits oben erwähnte St. Pelagius-Kirche er-
weitert und namentlich in den Fenstern (oder in der Be-
leuchtung überhaupt) wesentlich umgestaltet64).
Zwei Jahre darauf wurde Witigowo in Folge der Unzu-
friedenheit, die seine vielen Reisen und seine rastlose Bau-
tätigkeit im Schoofse des Convents hervorgerufen hatte,
5i) Alle diese Bautheile sind verschwunden; sie lagen mit den Ge-
bäuden des alten Klosters auf der Nordseite des Münsters.
'•) Purchard v. 355 ff. Von dem Stande der Miniaturmalerei unter
Witigowo'« Regierung sind wir durch den schönen Codex Egberti anf der
Stadtbibliothek zu Trier unterrichtet, denn die beiden Hauptmaler Geralt
und Heribert waren nebst vier Gehülfen Reichenauer Mönche. Waagen,
Handb. I, 11.
57) Die Politur ist poetische Licenz.
58) Man erkennt aus dieser Beschreibung, dafs ein (wahrscheinlich
oblonger) Glockenthurm mit zwei runden Treppenthürmen besehrieben wird,
also eine Anlage, wofür Aachen, Lüttich, Nivelles u. a. ältere oder gleich-
zeitige Vorbilder geben konnten.
s9) Oheim meldet, dafs dieses Gärtchcn zwischen der Pfarrkirche
St. Johannes und dem Münster liege. Ist dies richtig, so war der ge-
schilderte atriumartige Vorhof an der Südseite angelegt worden, da wo
jetzt die neuen Klostergebäude des XVII. Jahrhunderts stehen.
6 °) Dieser wegen seiner Farbenwirkung damals viel bewunderte Spiegel
ist wahrscheinlich der noch heut erhaltene 28 Pfund schwere, smaragd-
grüne Ghisflufs gewesen, welchen die Tradition als „einen 801 von Karl
dem Grofsen geschenkten Smaragd" bezeichnet.
61) Da die St. Erasmus Kapelle als Begräbnifsstätte schwäbischer
Herzoge schon früher erwähnt wird, so mufs man annehmen, dafs Witi-
gowo's Bau kein Stiftungs- sondern nur ein Erneuerungsbau gewesen ist.
62) Die Bauanlage war also ein Paradies. Purchard v. 436 ff. be-
merkt dies nicht ausdrücklich, obgleich er den Garten einen paradiesi-
schen Ort nennt.
63) Diese Thatsache ist wichtig, weil sie beweist, dafs die Verehrung
des h. Markus noch immer nicht so Platz gegriffen hatte, um einen be-
sonderen Altar mit Kapelle etc. zu verlangen.
64) Bei diesem letzten Bau scheint Kalksandbau angewendet worden
zu sein (s. v. 504); eine der frühesten Erwähnungen dieser Technik im
Mittelalter.
abgesetzt und Alawich zur Abtswürde erhoben65). Es ist
bemerkenswert , dafs Herrmann der Lahme, der diesem
Zeiträume schon sehr nahe stand (er kam 1020 auf die
Insel66)) auch die Amtsentsetzung Witigowo's, ohne Gründe
mitzutheilen, meldet, der so umfassenden Bauthätigkeit des
Abtes mit keinem Worte gedenkt. Die Vermuthung liegt
nahe, dafs ihn erstlich die fortdauernde Unzufriedenheit der
Mönche gegen Witigowo dazu veranlafste, und noch mehr der
Umstand, dafs die Bauten des Witigowo, weil eilig und ohne
die nothwendige Aufsicht ihres Urhebers ausgeführt, frühzeitig
reparaturbedürftig wurden, zu weiteren Klagen Veranlassung
gaben und schliefslich durch eine gleich zu erwähnende Feuers-
brunst verwüstet, ganz erneuert werden mufsten.
Abt Alawich verlieh dem Kloster neuen Glanz, indem er
durch Kaiser Otto's III. Vermittelung vom Papst Gregor V.
die hohe Vergünstigung empfing, die Dalmatika und die San-
dalen tragen zu dürfen67). Unmittelbar darauf erhob ihn im
Jahre 1000 die Gunst des Kaisers auf den bischöflichen Stuhl
von Strafsburg.
Die ersten Jahre des XI. Jahrhunderts waren für das
Kloster wieder ungünstig, denn die von König Heinrich II.
angebahnte strenge lothringische Klosterzucht schlug fehl,
weil viele Mönche die Verbannung der rücksichtslos einge-
führten Strenge vorzogen. Damals erlitt, wie Herrmann der
Lahme sagt, das berühmte Kloster einen grofsen Abgang an
hervorragenden Männern, Büchern und Kirchenschätzen68).
Dazu kam noch eine Feuersbrunst, welche um 1007 das
Kloster so schwer beschädigte, dafs der Mönch Rudpert Ver-
anlassung nahm, ein Klagegedicht: „De ruina monasterii
Augiensis ex incendio" daran zu knüpfen. Leider ist diese
Handschrift früh verloren gegangen, so dafs wir über den
Umfang des Schadens an der Münsterkirche — diese scheint
am meisten betroffen zu sein — nicht näher unterrichtet sind.
Bessere Zeiten folgten unter Abt Berno, dessen lange
und gesegnete Regierung (von 1008— 1048) Reichenau noch
einmal zu dem alten Ruhme, ein Centraipunkt für gelehrte
Studien in Deutschland zu sein, erhob69). Die Hauptzierde,
der Stolz und die Freude des Klosters und der eigentliche
Mittelpunkt der wissenschaftlichen Thätigkeit war der schon
oft genannte und so vielseitig begabte Herrmann der Lahme 7 n).
Doch wirkten neben ihm auch andere Männer als Lehrer und
Abt Berno war selbst ein Freund und Pfleger der Wissen-
schaften , in verschiedenen Disciplinen sogar selbsthätiger
Schriftsteller71). Auch seine Verwaltung war zweckmäfsig,
wofür die Verfügungen, welche noch erhalten sind, sowohl
für das Kloster, wie für die Propsteien von Oberzell und
Niederzell sprechen 7 2). Mit den deutschen Kaisern Hein-
rich II. und Heinrich III. stand er in gutem Verhältnifs; beide
besuchten mehre Male die Insel, so 1040, 104S, 1049 etc. 73).
Unter seiner Regierung, um 1040 wurde auf dem Friedhofe
des Klosters durch Graf Eberhard von Nellenburg die Lau-
rentius-Kapelle erbaut, welche als Grabstätte dieses edlen
Geschlechts bestimmt und benutzt, noch in Oheim's Zeiten
erhalten war, aber jetzt verschwunden ist. Im Jahre 1048 hatte
Berno noch das Glück — wenige Wochen vor seinem Tode —
„die von ihm neu erbaute Cathedrale des heiligen
Evangelisten Markus" in Gegenwart Kaiser Heinrich's III.
feierlich einweihen lassen zu können74).
Dieses bald „Cathedrale", bald „Kapelle" genannte Got-
teshaus des heiligen Markus war niemals ein abgesonderter
oder für sich bestehender Bau, sondern nichts als das west-
liche Querhaus der Münsterkirche (Mittelzell) nebst
der sich anschliefsenden westlichen Chorapsis.
65) Herrm. contr. ad a. 997.
8<i) Wattenbach 294.
67) Dümge, Reg. I, 95.
68) Herrm. Contr. ad a. 1006.
69| Stttlin I, 611 ff.
7°) Vergl. YVattenbach's ebenso treffende wie kurze Charakteristik
dieses ausgezeichneten Geschichtschreibers in Deutschlands Geschichts-
quellen S. 294. In dem Lebensbilde, welches Herrmann's Schüler Bert-
hold uns hinterlassen hat, wird neben der musikalischen Begabung auch
das mechanische Talent besonders hervorgehoben. Bischof Benno von
Osnabrück, der bekannte Baumeister, war ein Schüler Herrmanns.
71) Neugart Ep. Const. 1,508.
72) Oheim 97 ff.
73) Stälin I, 486 und Herrin, contr, ad 1048 und 1049.
74) Herrm. contr. ad a. 1048. Job. Egon a. a. O. 1, 3, 688 sagt
von Berno sprechend: S.Marco item Augiensi Patrono novam Basiiicam
exstruxit, eamque consecrari feeit anno Chr. 1048.