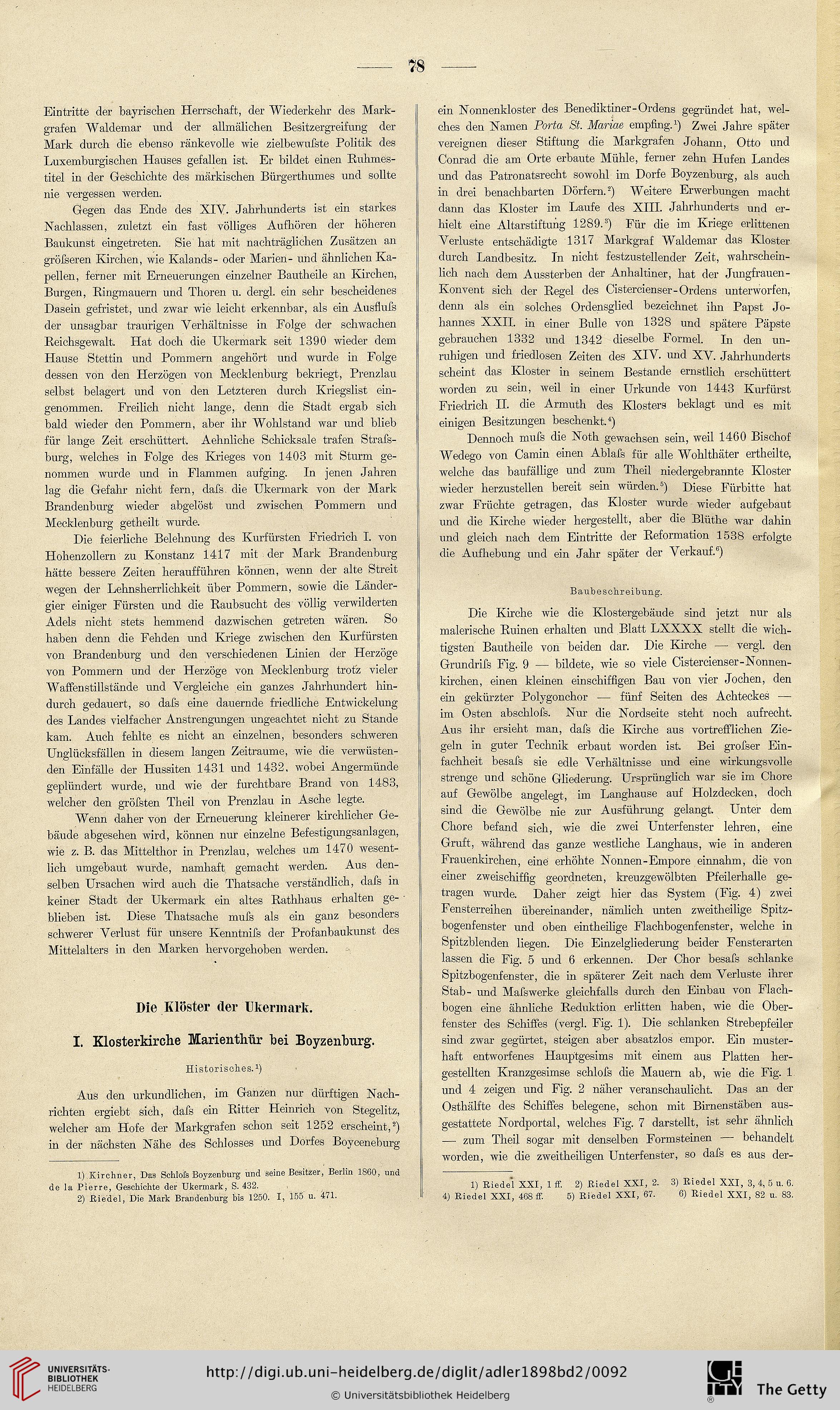78
Eintritte der bayrischen Herrschaft, der Wiederkehr des Mark-
grafen Waldemar und der allmälichen Besitzergreifung der
Mark durch die ebenso ränkevolle wie zielbewufste Politik des
Luxemburgischen Hauses gefallen ist. Er bildet einen Buhmes-
titel in der Geschichte des märkischen Bürgerthumes und sollte
nie vergessen werden.
Gegen das Ende des XIV. Jahrlnmderts ist ein starkes
Xaclilassen, zuletzt ein fast völliges Aufhören der höheren
Baukunst eingetreten. Sie hat mit nachträglichen Zusätzen an
gröfseren Kirchen, wie Kalands- oder Marien- und ähnlichen Ka-
pellen, ferner mit Erneuerungen einzelner Bautheile an Ivirchen,
Burgen, Bingmauern und Thoren u. dergl. ein selir bescheidenes
Dasein gefristet, und zwar wie leicht erkennbar, als ein Ausflufs
der unsagbar traurigen Verhältnisse in Folge der scliwaclien
Beichsgewalt. Hat docli die Ukermark seit 1390 wieder dem
Hause Stettin und Pommern angehört und wurde in Folge
dessen von den Herzögen von Mecklenburg bekriegt, Prenzlau
selbst belagert und von den Letzteren durch Kriegslist ein-
genonnnen. Freilich nicht lange, denn die Stadt ergab sicli
bald wieder den Pommern, aber ihr Wohlstand war und blieb
für lange Zeit erschüttert. Aelmliche Schicksale trafen Strafs-
burg, welclies in Folge des Krieges von 1403 mit Sturm ge-
nommen wurde und in Flammen aufging. In jenen Jahren
lag die Gefahr nicht fern, dafs. die Ukermark von der Mark
Brandenbiu'g wieder abgelöst und zwischen Pommern und
Mecklenbui'g getheilt wurde.
Die feierliclie Belehnung des Kurfürsten Friedrich I. von
Hohenzollern zu Konstanz 1417 mit der Mark Brandenburg
hätte bessere Zeiten heraufführen können, wenn der alte Streit
wegen der Lehnsherrlichkeit über Pommern, sowie die Länder-
gier einiger Fürsten und die Baubsucht des völlig verwilderten
Adels nicht stets liemmend dazwischen getreten wären. So
haben denn die Fehden und Kriege zwischen den Kurfürsten
von Brandenburg und den verschiedenen Linien der Herzöge
von Pommern und der Herzöge von Mecklenburg trotz vieler
Waflenstillstände und Vergleiclie ein ganzes Jahrhundert hin-
durch gedauert, so dafs eine dauernde friedliche Entwickelung
des Landes vielfaclier Anstrengungen ungeachtet nicht zu Stande
kam. Auch fehlte es nicht an einzelnen, besonders schweren
Unglücksfällen in diesem langen Zeitraume, wie die verwüsten-
den Einfälle der Hussiten 1431 und 1432, wobei Angermünde
geplündert wurde, und wie der furchtbare Brand von 1483,
welcher den gröfsten Theil von Prenzlau in Asche legte.
Wenn daher von der Erneuerung kleinerer kirchlicher Ge-
bäude abgesehen wird, können nur einzelne Befestigungsanlagen,
wie z. B. das Mittelthor in Prenzlau, welches um 1470 wesent-
lich umgebaut wurde, namhaft gemaclit wei'den. Aus den-
selben Ursachen wird auch die Thatsache verständlich, dafs in
keiner Stadt der Ukermark ein altes Bathhaus erhalten ge-
blieben ist. Diese Thatsache mufs als ein ganz besonders
schwerer Verlust für unsere Kenntnifs der Profanbaukunst des
Mittelalters in den Marken hervorgehoben werden.
Die Klöster (ler Ukermark.
I. Klosterkirche Marienthür hei Boyzenhurg.
Historisches. 1)
Aus den urkundlichen, im Ganzen nur dürftigen Nach-
richten ergiebt sich, dafs ein Bitter Fleinricli von Stegelitz,
welcher am Hofe der Markgrafen schon seit 1252 erscheint, 2)
in der nächsten Nähe des Schlosses und Dorfes Boyceneburg
1) Itirchner, Das Schlofs Boyzenburg und seine Besitzer, Berlin 1860, und
de la Pierre, Geschichte der Ukermark, S. 432.
2) ßiedel, Die Mark Brandenburg bis 1250. I, 155 u. 471.
ein Nonnenkloster des Benediktiner-Ordens gegründet hat, wel-
ches den Namen Porta St. Mariae empfing. 1) Zwei Jahre später
vereignen dieser Stiftung die Markgrafen Johann, Otto und
Conrad die am Orte erbaute Mühle, ferner zelin Hufen Landes
und das Patronatsrecht sowohl im Dorfe Boyzenburg, als auch
in drei benachbarten Dörfern. 2) Weitere Erwerbungen macht
dann das Kloster im Laufe des XIII. Jahrhunderts und er-
hielt eine Altarstiftung 1289. 3) Für die im Kriege erlittenen
Verluste entschädigte 1317 Markgraf Waldemar das Ivloster
durch Landbesitz. In nicht festzustellender Zeit, wahrschein-
lich nach dem Aussterben der Anhaltiner, hat der Jungfrauen-
Konvent sich der Begel des Cistercienser-Ordens unterworfen,
denn als ein solches Ordensglied bezeichnet ihn Papst Jo-
hannes XXII. in einer Bulle von 1328 und spätere Päpste
gebrauchen 1332 und 1342 dieselbe Formel. In den un-
ruhigen und friedlosen Zeiten des XIV. und XV. Jahrhunderts
scheint das Kloster in seinem Bestande ernstlich erschüttert
woi'den zu sein, weil in einer Urkunde von 1443 Kurfürst
Friedricli II. die Armuth des Klosters beklagt und es mit
einigen Besitzungen beschenkt. 4)
Dennoch mufs die Noth gewachsen sein, weil 1400 Bischof
Wedego von Camin einen Ablafs für alle Wohlthäter ei'theilte,
welclie das baufällige und zum Theil niedergebrannte Kloster
wieder herzustellen bereit sein würden. 6) Diese Fiirbitte hat
zwar Früchte getragen, das Kloster wurde wieder aufgebaut
und die Kirche wieder hergestellt, aber die Blüthe war dahin
und gleicli nach dem Eintritte der Beformation 1538 erfolgte
die Aufhebung und ein Jahr später der Verkauf. 6)
Baubesclireibnng.
Die Kirche wie die Klostergebäude sind jetzt nur als
malerische Buinen erhalten und Blatt LXXXX stellt die wich-
tigsten Bautheile von beiden dar. Die Kirche — vergl. den
Grundrifs Fig. 9 — bildete, wie so viele Cistercienser-Nonnen-
kirchen, einen kleinen einschiffigen Bau von vier Jochen, den
ein gekürzter Polygonchor — fünf Seiten des Acliteckes —
im Osten abschlofs. Nur die Nordseite steht noch aufrecht.
Aus ihr ersieht man, dafs die Kirche aus vortrefflichen Zie-
geln in guter Technik erbaut worden ist. Bei grofser Ein-
fachheit besafs sie edle Verhältnisse und eine wirkungsvolle
strenge und schöne Gliederung. Ursprünglich war sie im Chore
auf Gewölbe angelegt, im Langhause auf Holzdecken, docli
sind die Gewölbe nie zur Ausfiihrung gelangt. Unter dem
Chore befand sich, wie die zwei Unterfenster lehren, eine
Gruft, während das ganze westliche Langhaus, wie in anderen
Frauenkirchen, eine erhöhte Nonnen-Empore einnahm, die von
einer zweischiffig geordneten, kreuzgewölbten Pfeilerhalle ge-
tragen wurde. Daher zeigt hier das System (Fig. 4) zwei
Fensterreihen übereinander, nämlich unten zweitheilige Spitz-
bogenfenster und oben eintheilige Flachbogenfenster, welche in
Spitzblenden liegen. Die Einzelgliederung beider Fensterarten
lassen die Fig. 5 imd 6 erkennen. Der Chor besafs schlanke
Spitzbogenfenster, die in späterer Zeit nach dem Verluste ihrer
Stab- und Mafswerke gleichfalls durch den Einbau von Flach-
bogen eine ähnliche Beduktion erlitten haben, wie die Ober-
fenster des Schiffes (vergl. Fig. 1). Die schlanken Strebepfeiler
sind zwar gegürtet, steigen aber absatzlos empor. Ein muster-
haft entworfenes Hanptgesims mit einem aus Platten her-
gestellten Kranzgesimse schlofs die Mauern ab, wie die Fig. 1
und 4 zeigen und Fig. 2 näher veranschaulicht. Das an der
Osthälfte des Schiffes belegene, schon mit Birnenstäben aus-
gestattete Nordportal, welches Fig. 7 darstellt, ist selir ähnlich
— zum Tlieil sogar mit denselben Formsteinen — behandelt
worden, wie die zweitheiligen Unterfenster, so dafs es aus der-
1) Eiedel XXI, 1 ff. 2) ßiedel XXI, 2. 3) Eiedel XXI, 3, 4, 5 u. 6.
4) Eiedel XXI, 468 ff. 5) Eiedel XXI, 67. 6) Eiedel XXI, 82 u. 83.
Eintritte der bayrischen Herrschaft, der Wiederkehr des Mark-
grafen Waldemar und der allmälichen Besitzergreifung der
Mark durch die ebenso ränkevolle wie zielbewufste Politik des
Luxemburgischen Hauses gefallen ist. Er bildet einen Buhmes-
titel in der Geschichte des märkischen Bürgerthumes und sollte
nie vergessen werden.
Gegen das Ende des XIV. Jahrlnmderts ist ein starkes
Xaclilassen, zuletzt ein fast völliges Aufhören der höheren
Baukunst eingetreten. Sie hat mit nachträglichen Zusätzen an
gröfseren Kirchen, wie Kalands- oder Marien- und ähnlichen Ka-
pellen, ferner mit Erneuerungen einzelner Bautheile an Ivirchen,
Burgen, Bingmauern und Thoren u. dergl. ein selir bescheidenes
Dasein gefristet, und zwar wie leicht erkennbar, als ein Ausflufs
der unsagbar traurigen Verhältnisse in Folge der scliwaclien
Beichsgewalt. Hat docli die Ukermark seit 1390 wieder dem
Hause Stettin und Pommern angehört und wurde in Folge
dessen von den Herzögen von Mecklenburg bekriegt, Prenzlau
selbst belagert und von den Letzteren durch Kriegslist ein-
genonnnen. Freilich nicht lange, denn die Stadt ergab sicli
bald wieder den Pommern, aber ihr Wohlstand war und blieb
für lange Zeit erschüttert. Aelmliche Schicksale trafen Strafs-
burg, welclies in Folge des Krieges von 1403 mit Sturm ge-
nommen wurde und in Flammen aufging. In jenen Jahren
lag die Gefahr nicht fern, dafs. die Ukermark von der Mark
Brandenbiu'g wieder abgelöst und zwischen Pommern und
Mecklenbui'g getheilt wurde.
Die feierliclie Belehnung des Kurfürsten Friedrich I. von
Hohenzollern zu Konstanz 1417 mit der Mark Brandenburg
hätte bessere Zeiten heraufführen können, wenn der alte Streit
wegen der Lehnsherrlichkeit über Pommern, sowie die Länder-
gier einiger Fürsten und die Baubsucht des völlig verwilderten
Adels nicht stets liemmend dazwischen getreten wären. So
haben denn die Fehden und Kriege zwischen den Kurfürsten
von Brandenburg und den verschiedenen Linien der Herzöge
von Pommern und der Herzöge von Mecklenburg trotz vieler
Waflenstillstände und Vergleiclie ein ganzes Jahrhundert hin-
durch gedauert, so dafs eine dauernde friedliche Entwickelung
des Landes vielfaclier Anstrengungen ungeachtet nicht zu Stande
kam. Auch fehlte es nicht an einzelnen, besonders schweren
Unglücksfällen in diesem langen Zeitraume, wie die verwüsten-
den Einfälle der Hussiten 1431 und 1432, wobei Angermünde
geplündert wurde, und wie der furchtbare Brand von 1483,
welcher den gröfsten Theil von Prenzlau in Asche legte.
Wenn daher von der Erneuerung kleinerer kirchlicher Ge-
bäude abgesehen wird, können nur einzelne Befestigungsanlagen,
wie z. B. das Mittelthor in Prenzlau, welches um 1470 wesent-
lich umgebaut wurde, namhaft gemaclit wei'den. Aus den-
selben Ursachen wird auch die Thatsache verständlich, dafs in
keiner Stadt der Ukermark ein altes Bathhaus erhalten ge-
blieben ist. Diese Thatsache mufs als ein ganz besonders
schwerer Verlust für unsere Kenntnifs der Profanbaukunst des
Mittelalters in den Marken hervorgehoben werden.
Die Klöster (ler Ukermark.
I. Klosterkirche Marienthür hei Boyzenhurg.
Historisches. 1)
Aus den urkundlichen, im Ganzen nur dürftigen Nach-
richten ergiebt sich, dafs ein Bitter Fleinricli von Stegelitz,
welcher am Hofe der Markgrafen schon seit 1252 erscheint, 2)
in der nächsten Nähe des Schlosses und Dorfes Boyceneburg
1) Itirchner, Das Schlofs Boyzenburg und seine Besitzer, Berlin 1860, und
de la Pierre, Geschichte der Ukermark, S. 432.
2) ßiedel, Die Mark Brandenburg bis 1250. I, 155 u. 471.
ein Nonnenkloster des Benediktiner-Ordens gegründet hat, wel-
ches den Namen Porta St. Mariae empfing. 1) Zwei Jahre später
vereignen dieser Stiftung die Markgrafen Johann, Otto und
Conrad die am Orte erbaute Mühle, ferner zelin Hufen Landes
und das Patronatsrecht sowohl im Dorfe Boyzenburg, als auch
in drei benachbarten Dörfern. 2) Weitere Erwerbungen macht
dann das Kloster im Laufe des XIII. Jahrhunderts und er-
hielt eine Altarstiftung 1289. 3) Für die im Kriege erlittenen
Verluste entschädigte 1317 Markgraf Waldemar das Ivloster
durch Landbesitz. In nicht festzustellender Zeit, wahrschein-
lich nach dem Aussterben der Anhaltiner, hat der Jungfrauen-
Konvent sich der Begel des Cistercienser-Ordens unterworfen,
denn als ein solches Ordensglied bezeichnet ihn Papst Jo-
hannes XXII. in einer Bulle von 1328 und spätere Päpste
gebrauchen 1332 und 1342 dieselbe Formel. In den un-
ruhigen und friedlosen Zeiten des XIV. und XV. Jahrhunderts
scheint das Kloster in seinem Bestande ernstlich erschüttert
woi'den zu sein, weil in einer Urkunde von 1443 Kurfürst
Friedricli II. die Armuth des Klosters beklagt und es mit
einigen Besitzungen beschenkt. 4)
Dennoch mufs die Noth gewachsen sein, weil 1400 Bischof
Wedego von Camin einen Ablafs für alle Wohlthäter ei'theilte,
welclie das baufällige und zum Theil niedergebrannte Kloster
wieder herzustellen bereit sein würden. 6) Diese Fiirbitte hat
zwar Früchte getragen, das Kloster wurde wieder aufgebaut
und die Kirche wieder hergestellt, aber die Blüthe war dahin
und gleicli nach dem Eintritte der Beformation 1538 erfolgte
die Aufhebung und ein Jahr später der Verkauf. 6)
Baubesclireibnng.
Die Kirche wie die Klostergebäude sind jetzt nur als
malerische Buinen erhalten und Blatt LXXXX stellt die wich-
tigsten Bautheile von beiden dar. Die Kirche — vergl. den
Grundrifs Fig. 9 — bildete, wie so viele Cistercienser-Nonnen-
kirchen, einen kleinen einschiffigen Bau von vier Jochen, den
ein gekürzter Polygonchor — fünf Seiten des Acliteckes —
im Osten abschlofs. Nur die Nordseite steht noch aufrecht.
Aus ihr ersieht man, dafs die Kirche aus vortrefflichen Zie-
geln in guter Technik erbaut worden ist. Bei grofser Ein-
fachheit besafs sie edle Verhältnisse und eine wirkungsvolle
strenge und schöne Gliederung. Ursprünglich war sie im Chore
auf Gewölbe angelegt, im Langhause auf Holzdecken, docli
sind die Gewölbe nie zur Ausfiihrung gelangt. Unter dem
Chore befand sich, wie die zwei Unterfenster lehren, eine
Gruft, während das ganze westliche Langhaus, wie in anderen
Frauenkirchen, eine erhöhte Nonnen-Empore einnahm, die von
einer zweischiffig geordneten, kreuzgewölbten Pfeilerhalle ge-
tragen wurde. Daher zeigt hier das System (Fig. 4) zwei
Fensterreihen übereinander, nämlich unten zweitheilige Spitz-
bogenfenster und oben eintheilige Flachbogenfenster, welche in
Spitzblenden liegen. Die Einzelgliederung beider Fensterarten
lassen die Fig. 5 imd 6 erkennen. Der Chor besafs schlanke
Spitzbogenfenster, die in späterer Zeit nach dem Verluste ihrer
Stab- und Mafswerke gleichfalls durch den Einbau von Flach-
bogen eine ähnliche Beduktion erlitten haben, wie die Ober-
fenster des Schiffes (vergl. Fig. 1). Die schlanken Strebepfeiler
sind zwar gegürtet, steigen aber absatzlos empor. Ein muster-
haft entworfenes Hanptgesims mit einem aus Platten her-
gestellten Kranzgesimse schlofs die Mauern ab, wie die Fig. 1
und 4 zeigen und Fig. 2 näher veranschaulicht. Das an der
Osthälfte des Schiffes belegene, schon mit Birnenstäben aus-
gestattete Nordportal, welches Fig. 7 darstellt, ist selir ähnlich
— zum Tlieil sogar mit denselben Formsteinen — behandelt
worden, wie die zweitheiligen Unterfenster, so dafs es aus der-
1) Eiedel XXI, 1 ff. 2) ßiedel XXI, 2. 3) Eiedel XXI, 3, 4, 5 u. 6.
4) Eiedel XXI, 468 ff. 5) Eiedel XXI, 67. 6) Eiedel XXI, 82 u. 83.