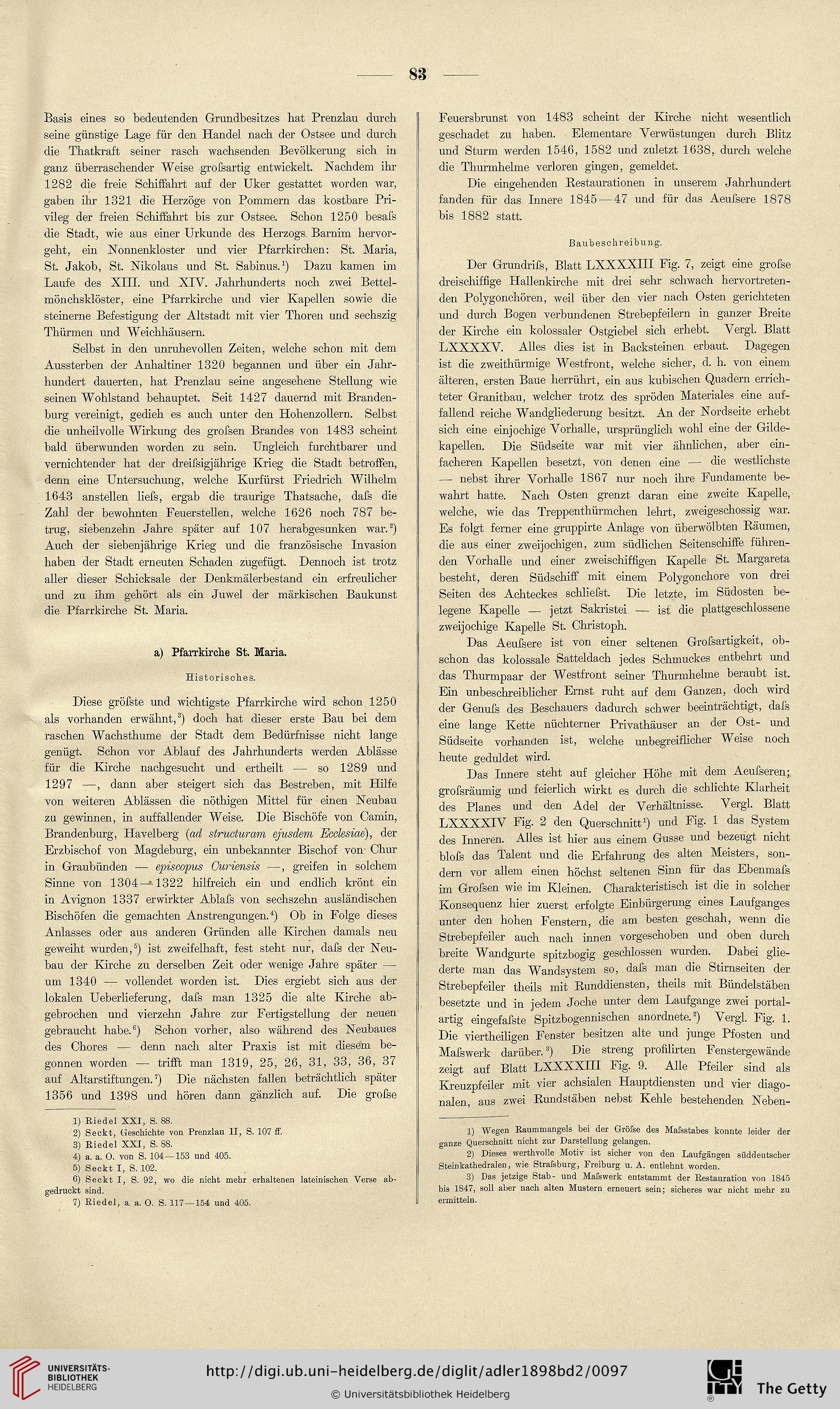88
Basis eines so bedeutenden Grundbesitzes hat Prenzlau durch
seine günstige Lage für den Handel nach der Ostsee und durch
die Thatkraft seiner rascli waclisenden Bevölkerung sich in
ganz überraschender Weise grofsartig entwickelt. Nachdcm ihr
1282 die freie Schiffahrt auf der Uker gestattet worden war,
gaben ihr 1321 die IPerzöge von Pommern das kostbare Pri-
vileg der freien Schiffahrt bis zur Ostsee. Schon 1250 besafs
die Stadt, wie aus einer Urkunde des Herzogs. Barnim hervor-
geht, ein Nonnenkloster und vier Pfarrkirehen: St. Maria,
St, Jakoh, St. Nikolaus und St. Sabinus. 1) Dazu kamen im
Laufe des XIII. und XIV. Jahrhunderts noch zwei Bettel-
mönchsklöster, eine Pfarrkirche und vier Kapellen sowie die
steinerne Bd'estigung der Altstadt mit vier Thoren und sechszig
Thürmen und Weichhäusern.
Selbst in den unruhevollen Zeiten, welche schon mit dem
Aussterben der Anlialtiner 1320 begannen und iiber ein Jahr-
hundert dauerten, hat Prenzlau seine angesehene Stellung wie
seinen Wolilstand behauptet, Seit 1427 dauernd mit Branden-
burg vereinigt, gedieh es auch unter den Hohenzollern. Selbst
die unheilvolle Wirkung des grofsen Brandes von 1483 scheint
bald überwunden worden zu sein. Ungleicli furchtbarer und
vernichtender hat der dreifsigjährige Krieg die Stadt betroffen,
denn eine Untersuchung, welche Kurfürst Friedrich Wilhelm
1643 anstellen liefs, ergab die traurige Thatsache, dafs die
Zahl der bewolmten Feuerstellen, welche 1626 noch 787 be-
trug, siebenzehn Jahre später auf 107 herabgesunken war. 2)
Auch der siebenjährige Krieg und die französische Invasion
haben der Stadt erneuten Schaden zugefügt. Dennoch ist trotz
aller dieser Schicksale der Denkmälerbestand ein erfreulicher
und zu ilim gehört als ein Juwel der märkischen Baukunst
die Pfarrkirche St. Maria.
a) Pfarrkirche St. Maria.
Historisches.
Diese gröfste und wichtigste Pfarrkirche wird schon 1250
als vorhanden erwähnt, 3) doch hat dieser erste Bau bei clem
raschen Wachsthume der Stadt dem Bedürfnisse nicht lange
genügt. Schon vor Ablauf des Jahrhunderts werden Ablässe
für die Kirche nacligesucht und ertheilt — so 1289 und
1297 —, dann aber steigert sich das Bestreben, mit Hilfe
von weiteren Ablässen die nöthigen Mittel für einen Neubau
zu gewinnen, in auffallender Weise. Die Bischöfe von Camin,
Brandenburg, Havelberg (ad structuram ejusdem Ecclesiae), der
Erzbischof von Magdeburg, ein unbekannter Biscliof von Chur
in Graubiinden — episcopus Curiensis —, greifen in solchem
Sinne von 1304—1322 hilfreich ein und endlich krönt ein
in Avignon 1337 erwirkter Ablafs von sechszehn ausländischen
Bischöfen die gemachten Anstrengungen. 4) Ob in Folge dieses
Anlasses oder aus anderen Griinden alle Kirchen damals neu
geweiht wurden, 5 *) ist zweifelhaft, fest steht nur, dafs der Neu-
bau der Ivirclie zu derselben Zeit oder Avenige Jahre später —
um 1340 — vollendet worden ist. Dies ergiebt sich aus der
lokalen Ueberlieferung, dafs man 1325 die alte Kirche ab-
gebrochen und vierzehn Jahre zur Fertigstellung der neuen
gebraucht liabe. 5) Schon vorher, also während des Neubaues
des Chores — denn nach alter Praxis ist mit diesem be-
gonnen worden — trifft man 1319, 25, 26, 31, 33, 36, 37
auf Altarstiftungen. 7) Die nächsten fallen beträchtlich später
1356 und 1398 und hören dann gänzlicli auf. Die grofse
1) Riedel XXI, S. 88.
2) Seckt, (ieschiclite von Prenzlau II, S. 107 ff.
3) Eiedel XXI, S. 88.
4) a. a. O. von S. 104 —153 und 405.
5) Seckt I, S. 102.
0) Seckt I, S. 92, wo die nicht mehr erhaltenen lateinischen Yerse ab-
gedruckt sind.
7) Riedel, a. a. O. S. 117 —154 und 405.
Feuersbrunst von 1483 scheint der Kirche nicht wesentlich
geschadet zu haben. Elementare Verwüstungen durch Blitz
und Sturm werden 1546, 1582 und zuletzt 1638, durch welche
die Thurmhelme verloren gingen, gemeldet,
Die einffehenden Bestaurationen in unserem Jahrhundert
o
fanden für das Innere 1845 — 47 und für das Aeufsere 1878
bis 1882 statt.
Bauheschreibung.
Der Grundrifs, Blatt LXXXXIII Fig. 7, zeigt eine grofse
dreischiffige Hallenkirche mit drei sehr scliwach hervortreten-
den Polygonchören, weil iiber den vier nach Osten gerichteten
und durch Bogen verbnndenen Strebepfeilern in ganzer Breite
der Kirche ein kolossaler Ostgiebel sich erhebt. Vergl. Blatt
LXXXXV. Alles dies ist in Backsteinen erbaut. Dagegen
ist die zweitliürmige Westfront, welche siclier, d. h. von einem
älteren, ersten Baue herrührt, ein aus kubischen Quadern erricli-
teter Granitbau, ivelcher trotz des spröden Materiales eine auf-
fallend reiche Wandgliederung besitzt. An der Nordseite erliebt
sich eine einjochige Vorhalle, ursprünglicli wohl eine der Gilde-
kapellen. Die Südseite war mit vier ähulichen, aber ein-
facheren Kapellen besetzt, von denen eine — die westlichste
— nebst ihrer Vorhalle 1867 nur noch ihre Fundamente be-
wahrt hatte. Nach Osten grenzt daran eine zweite Ivapelle,
welche, wie das Treppenthürmchen lelirt, zweigescliossig war.
Es folgt ferner eine gruppirte Anlage von überwölbten Käumen,
die aus einer zweijochigen, zum südlichen Seitenschiffe führen-
den Vorhalle und einer zweischiffigen Kapelle St. Margareta
besteht, deren Südschiff mit einem Polygonchore von drei
Seiten des Achteckes schliefst. Die letzte, im Südosten be-
legene Kapelle — jetzt Sakristei — ist' die plattgeschlossene
zweijochige Kapelle St. Christoph.
Das Aeufsere ist von einer seltenen Grofsartigkeit, ob-
schon das kolossale Satteldach jedes Schmuckes entbehrt und
das Thurmpaar der Westfront seiner Tliurmhelme beraubt ist.
Ein unbesclueiblicher Ernst ruht auf dem Ganzen, doch wird
der Genufs des Beschauers dadurch schwer beeinträchtigt, daf’s
eine lange Kette nüchterner Privathäuser an der Ost- und
Südseite vorhanden ist, welche unbegreifhcher Weise noch
heute geduldet wird.
Das Innere steht auf gleicher Höhe mit dem Aeufseren;
grofsräumig und feierlich wirkt es durch die schlichte Klarheit
des Planes und den Adel der Verhältnisse. Vergl. Blatt
LXXXXIV Fig. 2 den Querschnitt 1) und Fig. 1 das System
des Inneren. Alles ist hier aus einem Gusse und bezeugt nicht
blofs das Talent und die Erfalirung des alten Meisters, son-
dern vor allem einen höchst seltenen Sinn für das Ebenmafs
im Grofsen wie im Kleinen. Charakteristisch ist die in solcher
Konsequenz liier zuerst erfolgte Einbürgerung eines Laufganges
unter den hohen Fenstern, die am besten geschah, wenn die
Strebepfeiler auch nach innen vorgeschoben und oben durch
breite Wandgurte spitzbogig geschlossen wurden. Dabei glie-
derte man das Wandsystem so, dafs man die Stirnseiten der
Strebepfeiler tlieils mit Runddiensten, theils mit Bündelstäben
besetzte und in jedem Joche unter dem Laufgange zwei portal-
artig eingefafste Spitzbogennischen anordnete. 2) Vergl. Fig. 1.
Die viertheiligen Fenster besitzen alte und junge Pfosten und
Mafswerk darüber. 3) Die streng profilirten Fenstergewände
zeigt auf Blatt LXXXXIII Fig. 9. Alle Pfeiler sind als
Kreuzpfeiler mit vier achsialen Hauptdiensten und vier diago-
nalen, aus zwei Bundstäben nebst Kelile bestelienden Neben-
1) Wegen Raummangels bei der Gröfse des Mafsstabes konnte leider der
ganze Querschnitt niclit zur Darstellung gelangen.
2) Dieses werthvolle Motiv ist sicher von den Laufgängen süddeutscher
Steinkathedralen, wie Strafsburg, Freiburg u. A. entlehnt worden.
3) Das jetzige Stab- und Mafswerk entstammt der Restauration von 1845
bis 1847, soll aber nach alten Mustern erneuert seinj sicheres war nicht mehr zu
ermitteln.
Basis eines so bedeutenden Grundbesitzes hat Prenzlau durch
seine günstige Lage für den Handel nach der Ostsee und durch
die Thatkraft seiner rascli waclisenden Bevölkerung sich in
ganz überraschender Weise grofsartig entwickelt. Nachdcm ihr
1282 die freie Schiffahrt auf der Uker gestattet worden war,
gaben ihr 1321 die IPerzöge von Pommern das kostbare Pri-
vileg der freien Schiffahrt bis zur Ostsee. Schon 1250 besafs
die Stadt, wie aus einer Urkunde des Herzogs. Barnim hervor-
geht, ein Nonnenkloster und vier Pfarrkirehen: St. Maria,
St, Jakoh, St. Nikolaus und St. Sabinus. 1) Dazu kamen im
Laufe des XIII. und XIV. Jahrhunderts noch zwei Bettel-
mönchsklöster, eine Pfarrkirche und vier Kapellen sowie die
steinerne Bd'estigung der Altstadt mit vier Thoren und sechszig
Thürmen und Weichhäusern.
Selbst in den unruhevollen Zeiten, welche schon mit dem
Aussterben der Anlialtiner 1320 begannen und iiber ein Jahr-
hundert dauerten, hat Prenzlau seine angesehene Stellung wie
seinen Wolilstand behauptet, Seit 1427 dauernd mit Branden-
burg vereinigt, gedieh es auch unter den Hohenzollern. Selbst
die unheilvolle Wirkung des grofsen Brandes von 1483 scheint
bald überwunden worden zu sein. Ungleicli furchtbarer und
vernichtender hat der dreifsigjährige Krieg die Stadt betroffen,
denn eine Untersuchung, welche Kurfürst Friedrich Wilhelm
1643 anstellen liefs, ergab die traurige Thatsache, dafs die
Zahl der bewolmten Feuerstellen, welche 1626 noch 787 be-
trug, siebenzehn Jahre später auf 107 herabgesunken war. 2)
Auch der siebenjährige Krieg und die französische Invasion
haben der Stadt erneuten Schaden zugefügt. Dennoch ist trotz
aller dieser Schicksale der Denkmälerbestand ein erfreulicher
und zu ilim gehört als ein Juwel der märkischen Baukunst
die Pfarrkirche St. Maria.
a) Pfarrkirche St. Maria.
Historisches.
Diese gröfste und wichtigste Pfarrkirche wird schon 1250
als vorhanden erwähnt, 3) doch hat dieser erste Bau bei clem
raschen Wachsthume der Stadt dem Bedürfnisse nicht lange
genügt. Schon vor Ablauf des Jahrhunderts werden Ablässe
für die Kirche nacligesucht und ertheilt — so 1289 und
1297 —, dann aber steigert sich das Bestreben, mit Hilfe
von weiteren Ablässen die nöthigen Mittel für einen Neubau
zu gewinnen, in auffallender Weise. Die Bischöfe von Camin,
Brandenburg, Havelberg (ad structuram ejusdem Ecclesiae), der
Erzbischof von Magdeburg, ein unbekannter Biscliof von Chur
in Graubiinden — episcopus Curiensis —, greifen in solchem
Sinne von 1304—1322 hilfreich ein und endlich krönt ein
in Avignon 1337 erwirkter Ablafs von sechszehn ausländischen
Bischöfen die gemachten Anstrengungen. 4) Ob in Folge dieses
Anlasses oder aus anderen Griinden alle Kirchen damals neu
geweiht wurden, 5 *) ist zweifelhaft, fest steht nur, dafs der Neu-
bau der Ivirclie zu derselben Zeit oder Avenige Jahre später —
um 1340 — vollendet worden ist. Dies ergiebt sich aus der
lokalen Ueberlieferung, dafs man 1325 die alte Kirche ab-
gebrochen und vierzehn Jahre zur Fertigstellung der neuen
gebraucht liabe. 5) Schon vorher, also während des Neubaues
des Chores — denn nach alter Praxis ist mit diesem be-
gonnen worden — trifft man 1319, 25, 26, 31, 33, 36, 37
auf Altarstiftungen. 7) Die nächsten fallen beträchtlich später
1356 und 1398 und hören dann gänzlicli auf. Die grofse
1) Riedel XXI, S. 88.
2) Seckt, (ieschiclite von Prenzlau II, S. 107 ff.
3) Eiedel XXI, S. 88.
4) a. a. O. von S. 104 —153 und 405.
5) Seckt I, S. 102.
0) Seckt I, S. 92, wo die nicht mehr erhaltenen lateinischen Yerse ab-
gedruckt sind.
7) Riedel, a. a. O. S. 117 —154 und 405.
Feuersbrunst von 1483 scheint der Kirche nicht wesentlich
geschadet zu haben. Elementare Verwüstungen durch Blitz
und Sturm werden 1546, 1582 und zuletzt 1638, durch welche
die Thurmhelme verloren gingen, gemeldet,
Die einffehenden Bestaurationen in unserem Jahrhundert
o
fanden für das Innere 1845 — 47 und für das Aeufsere 1878
bis 1882 statt.
Bauheschreibung.
Der Grundrifs, Blatt LXXXXIII Fig. 7, zeigt eine grofse
dreischiffige Hallenkirche mit drei sehr scliwach hervortreten-
den Polygonchören, weil iiber den vier nach Osten gerichteten
und durch Bogen verbnndenen Strebepfeilern in ganzer Breite
der Kirche ein kolossaler Ostgiebel sich erhebt. Vergl. Blatt
LXXXXV. Alles dies ist in Backsteinen erbaut. Dagegen
ist die zweitliürmige Westfront, welche siclier, d. h. von einem
älteren, ersten Baue herrührt, ein aus kubischen Quadern erricli-
teter Granitbau, ivelcher trotz des spröden Materiales eine auf-
fallend reiche Wandgliederung besitzt. An der Nordseite erliebt
sich eine einjochige Vorhalle, ursprünglicli wohl eine der Gilde-
kapellen. Die Südseite war mit vier ähulichen, aber ein-
facheren Kapellen besetzt, von denen eine — die westlichste
— nebst ihrer Vorhalle 1867 nur noch ihre Fundamente be-
wahrt hatte. Nach Osten grenzt daran eine zweite Ivapelle,
welche, wie das Treppenthürmchen lelirt, zweigescliossig war.
Es folgt ferner eine gruppirte Anlage von überwölbten Käumen,
die aus einer zweijochigen, zum südlichen Seitenschiffe führen-
den Vorhalle und einer zweischiffigen Kapelle St. Margareta
besteht, deren Südschiff mit einem Polygonchore von drei
Seiten des Achteckes schliefst. Die letzte, im Südosten be-
legene Kapelle — jetzt Sakristei — ist' die plattgeschlossene
zweijochige Kapelle St. Christoph.
Das Aeufsere ist von einer seltenen Grofsartigkeit, ob-
schon das kolossale Satteldach jedes Schmuckes entbehrt und
das Thurmpaar der Westfront seiner Tliurmhelme beraubt ist.
Ein unbesclueiblicher Ernst ruht auf dem Ganzen, doch wird
der Genufs des Beschauers dadurch schwer beeinträchtigt, daf’s
eine lange Kette nüchterner Privathäuser an der Ost- und
Südseite vorhanden ist, welche unbegreifhcher Weise noch
heute geduldet wird.
Das Innere steht auf gleicher Höhe mit dem Aeufseren;
grofsräumig und feierlich wirkt es durch die schlichte Klarheit
des Planes und den Adel der Verhältnisse. Vergl. Blatt
LXXXXIV Fig. 2 den Querschnitt 1) und Fig. 1 das System
des Inneren. Alles ist hier aus einem Gusse und bezeugt nicht
blofs das Talent und die Erfalirung des alten Meisters, son-
dern vor allem einen höchst seltenen Sinn für das Ebenmafs
im Grofsen wie im Kleinen. Charakteristisch ist die in solcher
Konsequenz liier zuerst erfolgte Einbürgerung eines Laufganges
unter den hohen Fenstern, die am besten geschah, wenn die
Strebepfeiler auch nach innen vorgeschoben und oben durch
breite Wandgurte spitzbogig geschlossen wurden. Dabei glie-
derte man das Wandsystem so, dafs man die Stirnseiten der
Strebepfeiler tlieils mit Runddiensten, theils mit Bündelstäben
besetzte und in jedem Joche unter dem Laufgange zwei portal-
artig eingefafste Spitzbogennischen anordnete. 2) Vergl. Fig. 1.
Die viertheiligen Fenster besitzen alte und junge Pfosten und
Mafswerk darüber. 3) Die streng profilirten Fenstergewände
zeigt auf Blatt LXXXXIII Fig. 9. Alle Pfeiler sind als
Kreuzpfeiler mit vier achsialen Hauptdiensten und vier diago-
nalen, aus zwei Bundstäben nebst Kelile bestelienden Neben-
1) Wegen Raummangels bei der Gröfse des Mafsstabes konnte leider der
ganze Querschnitt niclit zur Darstellung gelangen.
2) Dieses werthvolle Motiv ist sicher von den Laufgängen süddeutscher
Steinkathedralen, wie Strafsburg, Freiburg u. A. entlehnt worden.
3) Das jetzige Stab- und Mafswerk entstammt der Restauration von 1845
bis 1847, soll aber nach alten Mustern erneuert seinj sicheres war nicht mehr zu
ermitteln.