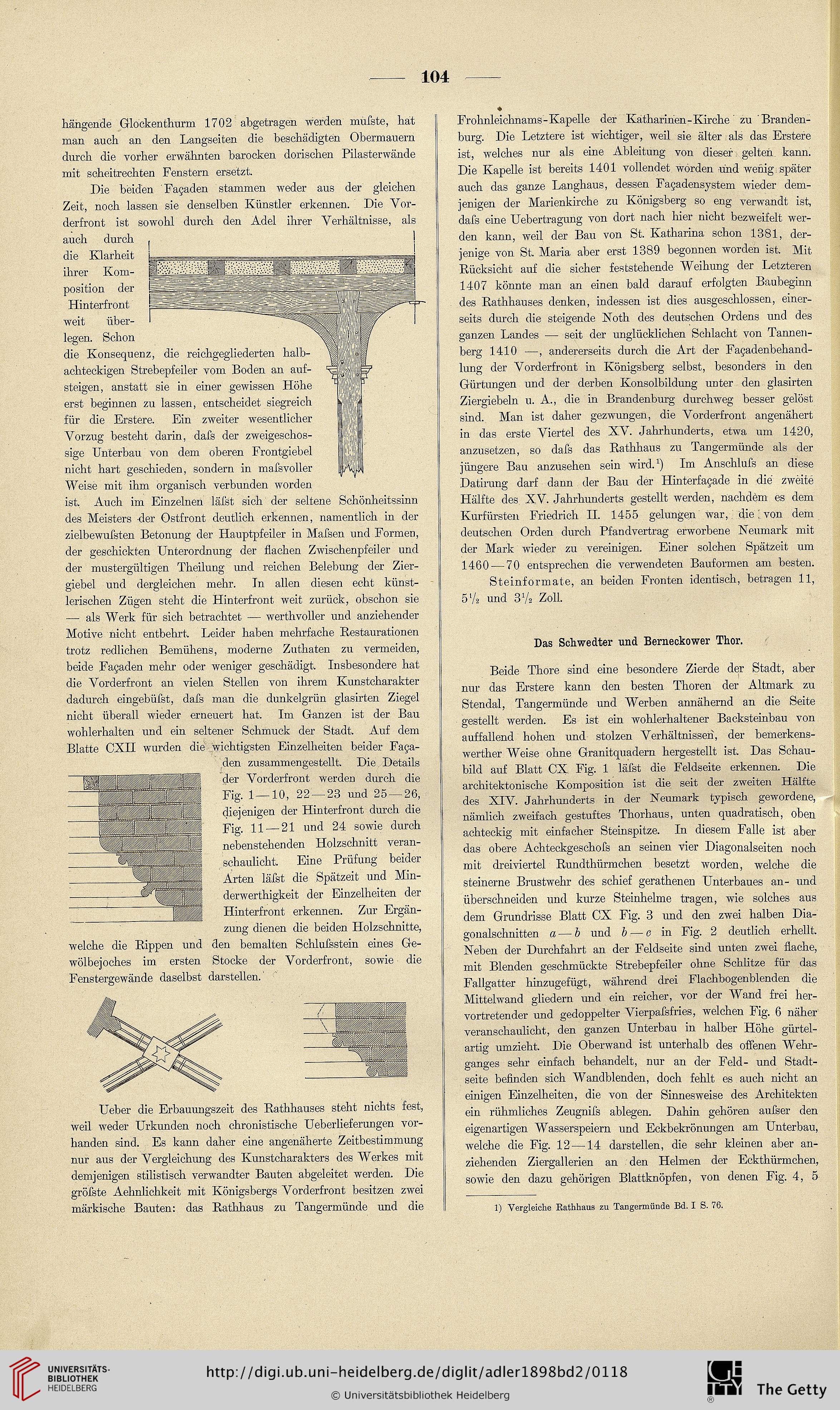104
hängencle Glockenthurm 1702 abgetragen werden mufste, hat
man auch an den Langseiten die beschädigten Obermauern
durch die vorher erwähnten barocken dorischen Pilasterwände
mit scheitrechten Fenstern ersetzt.
Die beiden Facaden stammen weder aus der gleichen
Zeit, noch lassen sie denselben Künstler erkennen. Die Yor-
derfront ist sowohl clurch den Adel ihrer Verhältnisse, als
auch durch ,
die Klarheit L.^___ . __ ,,, _—
ihrer Kom- Üh’-X'.'L-
M ®
i
position der
Hinterfront,
weit übei'-
legen. Schon
die Konsequenz, die reichgegliederten lialb-
achteckigen Strebepfeiler vom Boden an auf-
steigen, anstatt sie in einer gewissen Höhe
erst beginnen zu lassen, entscheidet siegreich
für die Erstere. Ein zweiter wesentlicher
Vorzug besteht darin, dafs der zweigeschos-
sige Unterbau von dem oberen Frontgiebel
nicht hart geschieden, sondern in mafsvoller
Weise mit ihm organisch verbunden worden
ist. Auch im Einzelnen läfst sich der seltene Schönheitssinn
des Meisters der Ostfront deutlich erkennen, namentlicli in der
zielbewufsten Betonung der Hauptpfeiler in Mafsen und Formen,
der geschickten Unterordnung der fiachen Zwischenpfeiler und
der mustergültigen Theilung und reichen Belebung der Zier-
giebel und dergleichen mehr. Tn allen diesen echt künst-
lerischen Ziigen steht die Hinterfront weit zurück, obschon sie
— als Werk für sich betrachtet — werthvoller und anziehender
Motive nicht entbehrt,. Leider haben mehrfaclie Bestaurationen
trotz redlichen Bemühens, moderne Zutliaten zu vermeiden,
beide Facaden melir oder weniger geschädigt. Insbesondere hat
die Vorderfront an vielen Stellen von ihrem Kunstcharakter
dadurch eingebüfst, dafs man die dunkelgrün glasirten Ziegel
nicht überall wieder erneuert hat. Im Ganzen ist der Bau
wohlerhalten und ein seltener Schmuck der Stadt. Auf dem
Blatte CXII wurden die wichtigsten Einzelheiten beider Fa§a-
den zusammengestellt. Die Details
der Vorderfront werden durch die
Fig. 1 — 10, 22 — 23 und 25 — 26,
diejenigen der Hinterfront durch die
Fig. 11 — 21 und 24 sowie durch
nebenstehenden ITolzschnitt veran-
schaulicht. Eine Prüfung beider
Arten läfst die Spätzeit und Min-
derwerthigkeit der Einzelheiten der
Hinterfront erkennen. Zur Ergän-
zung dienen die beiden Holzschnitte,
welche die Rippen und den bemalten Schlufsstein eines Ge-
wölbejoches im ersten Stocke der Vorderfront, sowie die
Fenstergewände daselbst darstellen.
Ueber die Erbauungszeit des Bathhauses steht nichts fest,
weil weder Urkunden noch chronistische Ueberlieferungen vor-
handen sind. Es kann daher eine angenäherte Zeitbestimmung
nur aus der Vergleichung des Kunstcharakters des Werkes mit
demjenigen stilistisch verwandter Bauten abgeleitet werden. Die
grölste Aehnlichkeit mit Königsbergs Vorderfront besitzen zwei
märkische Bauten: das Rathhaus zu Tangermtinde und die
♦
Frohnleichnams-Kapelle der Katharinen-Kirclie zu 'Branden-
burg. Die Letztere ist wichtiger, weil sie älter als das Erstere
ist, welches nur als eine Ableitung von dieser gelten kann.
Die Kapelle ist bereits 1401 vollendet worden und wenig später
auch das ganze Langhaus, dessen Fagadensjstem wieder dem-
jenigen der Marienkirche zu Königsberg so eng verwandt ist,
dafs eine Uebertragung von dort nach liier nicht bezweifelt wer-
den kann, weil der Bau von St. Katharina schon 1381, der-
jenige von St. Maria aber erst 1389 begonnen worden ist. Mit
Rücksicht auf die sicher feststeliende Weihung der Letzteren
1407 könnte man an einen bald darauf erfolgten Baubeginn
des Rathhauses denken, indessen ist dies ausgeschlossen, einer-
seits durch die steigende Xoth des deutschen Ordens und des
ganzen Landes — seit der unglücklichen Schlacht von Tannen-
berg 1410 —, andererseits durch die Art der Fagadenbehand-
lung der Vorderfront in Königsberg selbst, besonders in den
Gürtungen und der derben Konsolbildung unter den glasirten
Ziergiebeln u. A., die in Brandenburg durchweg besser gelöst
sind. Man ist daher gezwungen, die Vorderfront angenähert
in das erste Viertel des XV. Jahrhunderts, etwa um 1420,
anzusetzen, so dafs das Rathhaus zu Tangermünde als der
jüngere Bau anzusehen sein wird. 1) Im Anschlufs an diese
Datirung darf dann der Bau der Hinterfagade in die zweite
Hälfte des XV. Jahrhunderts gestellt werden, naclidem es dem
Kurfürsten Friedrich II. 1455 gelungen war, die von dem
deutschen Orden durch Pfandvertrag erworbene Neumark mit
der Mark wieder zu vereinigen. Einer solchen Spätzeit um
1460 — 70 entsprechen die verwendeten Bauformen am besten.
Steinformate, an beiden Fronten identisch, betragen 11,
5 V* und 37« Zoll.
Das Schwedter und Berneckower Thor.
Beide Thore sind eine besondere Zierde der Stadt, aber
nur das Erstere kann den besten Thoren der Altmark zu
Stendal, Tangermünde und Werben annähernd an die Seite
gestellt werden. Es ist ein wohlerhaltener Backsteinbau von
auffallend hohen und stolzen Verhältnissen, der bemerkens-
werther Weise ohne Granitquadern hergestellt ist. Das Schau-
bild auf Blatt CX Fig. 1 läfst die Feldseite erkennen. Die
architektonische Komposition ist die seit der zweiten Hälfte
des XIV. Jahrhunderts in der Neumark typisch gewordene,
nämlich zweifach gestuftes Thorhaus, unten quadratisch, ohen
achteckig mit einfacher Steinspitze. In diesem Falle ist aber
das obere Achteckgeschofs an seinen vier Diagonalseiten noch
mit dreiviertel Rundthürmchen besetzt worden, welche die
steinerne Brustwehr des schief gerathenen Unterbaues an- und
überschneiden und kurze Steinhelme tragen, wie solches aus
dem Grundrisse Blatt CX Fig. 3 und den zwei halben Dia-
gonalschnitten a — b und b —■ c in Fig. 2 deutlich erhellt.
Neben der Durchfahrt an der Feldseite sind unten zwei flache,
mit Blenden geschmückte Strebepfeiler ohne Schlitze für das
Fallgatter hinzugefügt, während drei Flachbogenblenden die
Mittelwand gliedern und ein reicher, vor der Wand frei her-
vortretender und gedoppelter Vierpafsfries, welchen Fig. 6 näher
veranschaulicht, den ganzen Unterbau in lialber Höhe gürtel-
artig umzieht. Die Oberwand ist unterhalb des offenen Wehr-
ganges sehr einfach behandelt, nur an der Feld- und Stadt-
seite befinden sich Wandblenden, doch feldt es auch nicht an
einigen Einzelheiten, die von der Sinnesweise des Architekten
ein rühmliches Zeugnifs ablegen. Dahin gehören aufser den
eigenartigen Wasserspeiern und Eckbekrönungen am Unterbau,
welche die Fig. 12 —14 darstellen, die sehr kleinen aber an-
ziehenden Ziergallerien an den Helmen der Eckthürmchen,
sowie den dazu gehörigen Blattknöpfen, von denen Fig. 4, 5
1) Vergleiche Rathhaus zu Tangermünde Bd. I S. 76.
hängencle Glockenthurm 1702 abgetragen werden mufste, hat
man auch an den Langseiten die beschädigten Obermauern
durch die vorher erwähnten barocken dorischen Pilasterwände
mit scheitrechten Fenstern ersetzt.
Die beiden Facaden stammen weder aus der gleichen
Zeit, noch lassen sie denselben Künstler erkennen. Die Yor-
derfront ist sowohl clurch den Adel ihrer Verhältnisse, als
auch durch ,
die Klarheit L.^___ . __ ,,, _—
ihrer Kom- Üh’-X'.'L-
M ®
i
position der
Hinterfront,
weit übei'-
legen. Schon
die Konsequenz, die reichgegliederten lialb-
achteckigen Strebepfeiler vom Boden an auf-
steigen, anstatt sie in einer gewissen Höhe
erst beginnen zu lassen, entscheidet siegreich
für die Erstere. Ein zweiter wesentlicher
Vorzug besteht darin, dafs der zweigeschos-
sige Unterbau von dem oberen Frontgiebel
nicht hart geschieden, sondern in mafsvoller
Weise mit ihm organisch verbunden worden
ist. Auch im Einzelnen läfst sich der seltene Schönheitssinn
des Meisters der Ostfront deutlich erkennen, namentlicli in der
zielbewufsten Betonung der Hauptpfeiler in Mafsen und Formen,
der geschickten Unterordnung der fiachen Zwischenpfeiler und
der mustergültigen Theilung und reichen Belebung der Zier-
giebel und dergleichen mehr. Tn allen diesen echt künst-
lerischen Ziigen steht die Hinterfront weit zurück, obschon sie
— als Werk für sich betrachtet — werthvoller und anziehender
Motive nicht entbehrt,. Leider haben mehrfaclie Bestaurationen
trotz redlichen Bemühens, moderne Zutliaten zu vermeiden,
beide Facaden melir oder weniger geschädigt. Insbesondere hat
die Vorderfront an vielen Stellen von ihrem Kunstcharakter
dadurch eingebüfst, dafs man die dunkelgrün glasirten Ziegel
nicht überall wieder erneuert hat. Im Ganzen ist der Bau
wohlerhalten und ein seltener Schmuck der Stadt. Auf dem
Blatte CXII wurden die wichtigsten Einzelheiten beider Fa§a-
den zusammengestellt. Die Details
der Vorderfront werden durch die
Fig. 1 — 10, 22 — 23 und 25 — 26,
diejenigen der Hinterfront durch die
Fig. 11 — 21 und 24 sowie durch
nebenstehenden ITolzschnitt veran-
schaulicht. Eine Prüfung beider
Arten läfst die Spätzeit und Min-
derwerthigkeit der Einzelheiten der
Hinterfront erkennen. Zur Ergän-
zung dienen die beiden Holzschnitte,
welche die Rippen und den bemalten Schlufsstein eines Ge-
wölbejoches im ersten Stocke der Vorderfront, sowie die
Fenstergewände daselbst darstellen.
Ueber die Erbauungszeit des Bathhauses steht nichts fest,
weil weder Urkunden noch chronistische Ueberlieferungen vor-
handen sind. Es kann daher eine angenäherte Zeitbestimmung
nur aus der Vergleichung des Kunstcharakters des Werkes mit
demjenigen stilistisch verwandter Bauten abgeleitet werden. Die
grölste Aehnlichkeit mit Königsbergs Vorderfront besitzen zwei
märkische Bauten: das Rathhaus zu Tangermtinde und die
♦
Frohnleichnams-Kapelle der Katharinen-Kirclie zu 'Branden-
burg. Die Letztere ist wichtiger, weil sie älter als das Erstere
ist, welches nur als eine Ableitung von dieser gelten kann.
Die Kapelle ist bereits 1401 vollendet worden und wenig später
auch das ganze Langhaus, dessen Fagadensjstem wieder dem-
jenigen der Marienkirche zu Königsberg so eng verwandt ist,
dafs eine Uebertragung von dort nach liier nicht bezweifelt wer-
den kann, weil der Bau von St. Katharina schon 1381, der-
jenige von St. Maria aber erst 1389 begonnen worden ist. Mit
Rücksicht auf die sicher feststeliende Weihung der Letzteren
1407 könnte man an einen bald darauf erfolgten Baubeginn
des Rathhauses denken, indessen ist dies ausgeschlossen, einer-
seits durch die steigende Xoth des deutschen Ordens und des
ganzen Landes — seit der unglücklichen Schlacht von Tannen-
berg 1410 —, andererseits durch die Art der Fagadenbehand-
lung der Vorderfront in Königsberg selbst, besonders in den
Gürtungen und der derben Konsolbildung unter den glasirten
Ziergiebeln u. A., die in Brandenburg durchweg besser gelöst
sind. Man ist daher gezwungen, die Vorderfront angenähert
in das erste Viertel des XV. Jahrhunderts, etwa um 1420,
anzusetzen, so dafs das Rathhaus zu Tangermünde als der
jüngere Bau anzusehen sein wird. 1) Im Anschlufs an diese
Datirung darf dann der Bau der Hinterfagade in die zweite
Hälfte des XV. Jahrhunderts gestellt werden, naclidem es dem
Kurfürsten Friedrich II. 1455 gelungen war, die von dem
deutschen Orden durch Pfandvertrag erworbene Neumark mit
der Mark wieder zu vereinigen. Einer solchen Spätzeit um
1460 — 70 entsprechen die verwendeten Bauformen am besten.
Steinformate, an beiden Fronten identisch, betragen 11,
5 V* und 37« Zoll.
Das Schwedter und Berneckower Thor.
Beide Thore sind eine besondere Zierde der Stadt, aber
nur das Erstere kann den besten Thoren der Altmark zu
Stendal, Tangermünde und Werben annähernd an die Seite
gestellt werden. Es ist ein wohlerhaltener Backsteinbau von
auffallend hohen und stolzen Verhältnissen, der bemerkens-
werther Weise ohne Granitquadern hergestellt ist. Das Schau-
bild auf Blatt CX Fig. 1 läfst die Feldseite erkennen. Die
architektonische Komposition ist die seit der zweiten Hälfte
des XIV. Jahrhunderts in der Neumark typisch gewordene,
nämlich zweifach gestuftes Thorhaus, unten quadratisch, ohen
achteckig mit einfacher Steinspitze. In diesem Falle ist aber
das obere Achteckgeschofs an seinen vier Diagonalseiten noch
mit dreiviertel Rundthürmchen besetzt worden, welche die
steinerne Brustwehr des schief gerathenen Unterbaues an- und
überschneiden und kurze Steinhelme tragen, wie solches aus
dem Grundrisse Blatt CX Fig. 3 und den zwei halben Dia-
gonalschnitten a — b und b —■ c in Fig. 2 deutlich erhellt.
Neben der Durchfahrt an der Feldseite sind unten zwei flache,
mit Blenden geschmückte Strebepfeiler ohne Schlitze für das
Fallgatter hinzugefügt, während drei Flachbogenblenden die
Mittelwand gliedern und ein reicher, vor der Wand frei her-
vortretender und gedoppelter Vierpafsfries, welchen Fig. 6 näher
veranschaulicht, den ganzen Unterbau in lialber Höhe gürtel-
artig umzieht. Die Oberwand ist unterhalb des offenen Wehr-
ganges sehr einfach behandelt, nur an der Feld- und Stadt-
seite befinden sich Wandblenden, doch feldt es auch nicht an
einigen Einzelheiten, die von der Sinnesweise des Architekten
ein rühmliches Zeugnifs ablegen. Dahin gehören aufser den
eigenartigen Wasserspeiern und Eckbekrönungen am Unterbau,
welche die Fig. 12 —14 darstellen, die sehr kleinen aber an-
ziehenden Ziergallerien an den Helmen der Eckthürmchen,
sowie den dazu gehörigen Blattknöpfen, von denen Fig. 4, 5
1) Vergleiche Rathhaus zu Tangermünde Bd. I S. 76.