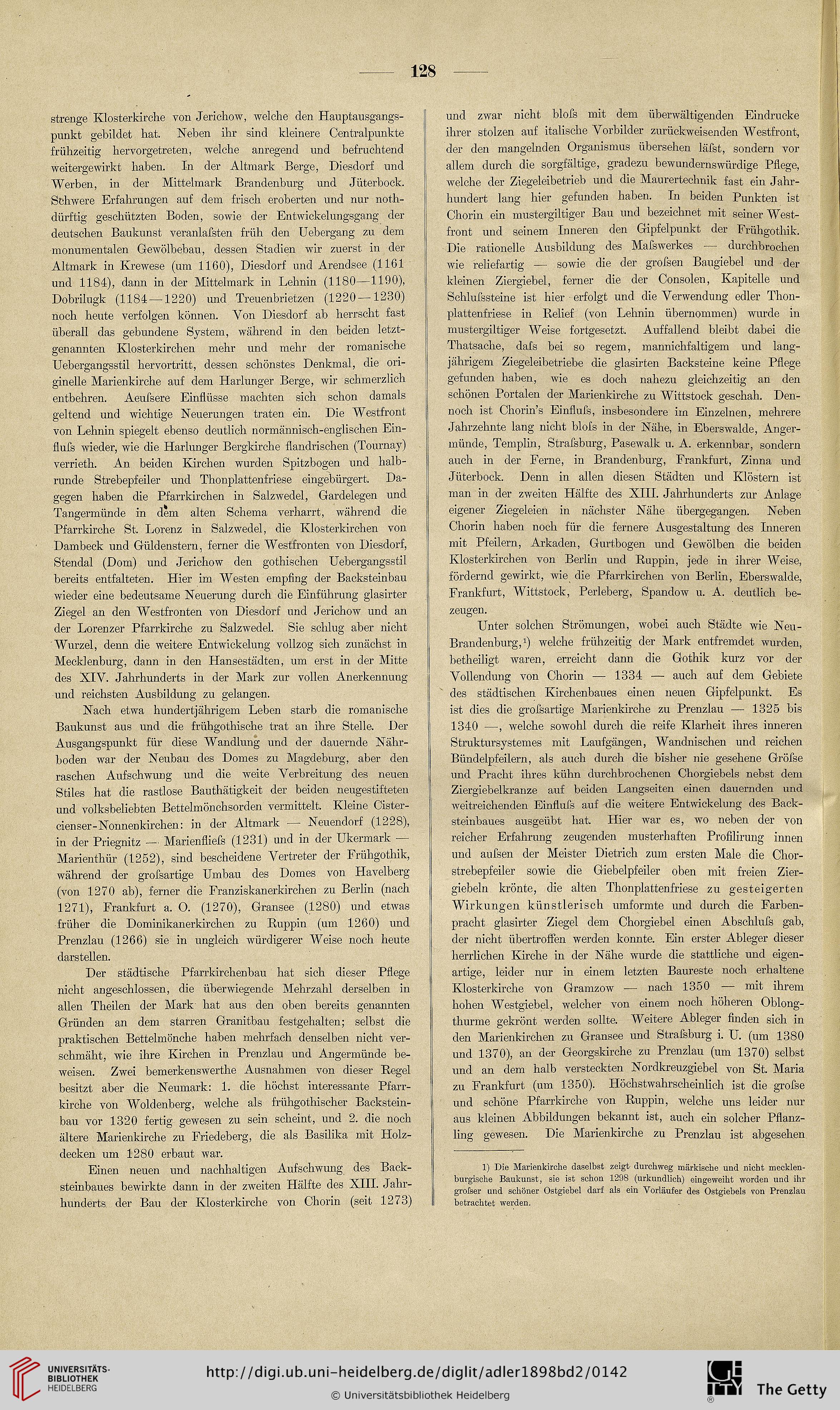128
strenge Klosterkirche von Jerichow, welche den Hauptausgangs-
punkt gebildet liat. Neben ihr sind kleinere Centralpunkte
frühzeitig hervorgetreten, welche anregend und befruchtend
weitergewirkt haben. In der Altmark Berge, Diesdorf und
Werben, in der Mittelmark Brandenburg und Jüterbock.
Scliwere Erfahrungen auf dem frisch eroberten und nur noth-
dürftig geschützten Boden, sowie der Entwickelungsgang der
deutschen Baukunst veranlafsten friih den Uebergang zu dem
monumentalen Gewölbebau, dessen Stadien wir zuerst in der
Altmark in Krewese (um 1160), Diesdorf und Arendsee (1161
und 1184), dann in der Mittelmark in Lehnin (1180—1190),
Dobrilugk (1184 —1220) und Treuenbrietzen (1220 —1230)
noch lieute verfolgen können. Yon Diesdorf ab herrscht fast
iiberall das gebundene System, während in den beiden letzt-
genannten Klosterkirchen mehr und melir der romanische
Uebergangsstil liervortritt, dessen schönstes Denkmal, die ori-
ginelle Marienkirche auf dem Harlunger Berge, wir schmerzlich
entbeliren. Aeufsere Einflüsse machten sicli schon danials
geltend und wichtige Neuerungen traten ein. Die Westfront
von Lehnin spiegelt ebenso deutlich normännisch-englisclien Ein-
flufs wieder, wie die Harlunger Bergkirche flandrischen (Tournay)
verrieth. An beiden Kirchen wurden Spitzbogen und halb-
runde Strebepfeiler und Thonplattenfriese eingebürgert. Da-
gegen haben die Pfarrkirchen in Salzwedel, Gardelegen und
Tangermünde in dem alten Schema verharrt, während die
Pfarrkirche St. Lorenz in Salzwedel, die Klosterkirclien von
Dambeck und Güldenstern, ferner die Westfronten von Diesdorf,
Stendal (Dom) und Jerichow den gothisclien Uebergangsstil
bereits entfalteten. Hier im Westen empfing der Backsteinbau
wieder eine bedeutsame Neuerung durch die Einfülirung glasirter
Ziegel an den Westfronten von Diesdorf und Jerichow und an
der Lorenzer Pfarrkirche zu Salzwedel. Sie schlug aber nicht
Wurzel, denn die weitere Entwickelung vollzog sich zunächst in
Mecklenburg, dann in den Hansestädten, um erst in der Mitte
des XIV. Jahrhunderts in der Mark zur voilen Anerkennung
und reichsten Ausbildung zu gelangen.
Nach etwa hundertjährigem Leben starb die romanisclie
Baukunst aus und die frühgothische trat an ihre Stelle. Der
Ausgangspunkt für diese Wandlung und der dauernde Nähr-
boden war der Neubau des Domes zu Magdeburg, aber den
raschen Aufschwung und die weite Yerbreitung des neuen
Stiles hat die rastlose Bauthätigkeit der beiden neugestifteten
und volksbeliebten Bettelmönchsorden vermittelt. Kleine Cister-
cienser-Nonnenkirchen: in der Altmark — Neuendorf (1228),
in der Priegnitz — Marienfliefs (1231) und in der Ukermark
Marienthür (1252), sind bescheidene Yertreter der Frühgothik,
während der grofsartige Umbau des Domes von Havelberg
(von 1270 ab), ferner die Franziskanerkirchen zu Berlin (nach
1271), Frankfurt a. O. (1270), Gransee (1280) und etwas
früher die Dominikanerkirchen zu Ruppin (um 1260) und
Prenzlau (1266) sie in ungleich würdigerer Weise nocli heute
darstellen.
Der städtisclie Pfarrkirchenbau hat sich dieser Pflege
nicht angeschlossen, die überwiegende Mehrzahl derselben in
allen Theilen der Mark hat aus den oben bereits genannten
Gründen an dem starren Granitbau festgehalten; selbst die
praktischen Bettelmönche haben mehrfach denselben nicht ver-
schmäht, wie ihre Kirchen in Prenzlau und Angermünde be-
weisen. Zwei bemerkenswerthe Ausnahmen von dieser Begel
besitzt aber die Neumark: 1. die liöchst interessante Pfarr-
kirclie von Woldenberg, welche als frühgothischer Backstein-
bau vor 1320 fertig gewesen zu sein scheint, und 2. die nocli
ältere Marienkirclie zu Friedeberg, die als Basilika mit Holz-
decken um 1280 erbaut war.
Einen neuen und nachhaltigen Aufscliwung des Back-
steinbaues bewirlcte dann in der zweiten Hälfte des XIII. Jahr-
hunderts der Bau der Klosterkirche von Chorin (seit 1273)
und zwar nicht blofs mit dem überwältigenden Eindrucke
ihrer stolzen auf italisclie Yorbilder zurückweisenden Westfront,
der den mangelnden Organismus übersehen läfst, sondern vor
allem durcli die soi'gfältige, gradezu bewundernswiirdige Pflege,
welclie der Ziegeleibetrieb und die Maurertechnik fast ein Jahr-
hundert lang hier gefunden haben. In beiden Punkten ist
Chorin ein mustergiltiger Bau und bezeichnet mit seiner AVest-
front und seinem Innereu den Gipfelpunkt der Frühgotliik.
Die rationelle Ausbildung des Mafswerkes — durchbrochen
wie reliefartig — sowie die der grofsen Baugiebel und der
kleinen Ziergiebel, ferner die der Consolen, Kapitelle und
Schlufssteine ist hier erfolgt und die Verwendung edler Thon-
plattenfriese in Belief (von Lehnin übernommen) wurde in
mustergiltiger Weise fortgesetzt. Auffallend bleibt dabei die
Thatsache, dafs bei so regem, mannichfaltigem und lang-
jährigem Ziegeleibetriebe die glasirten Backsteine keine Pflege
gefunden haben, wie es docli nahezu gleiclizeitig an den
schönen Portalen der Marienkirche zu Wittstock geschah. Den-
noch ist Chorin’s Einflufs, insbesondere iin Einzelnen, melirere
Jahrzehnte lang nicht blofs in der Nähe, in Eberswalde, Anger-
münde, Templin, Strafsburg, Pasewalk u. A. erkennbar, sondern
auch in der Ferne, in Brandenburg, Frankfurt, Zinna und
Jüterbock. Denn in allen diesen Städten und Klöstern ist
man in der zweiten Hälfte des XIII. Jahrhunderts zur Anlage
o
eigener Ziegeleien in nächster Nähe übergegangen. Neben
Cliorin haben noch fiir die fernere Ausgestaltung des Inneren
mit Pfeilern, Arkaden, Gurtbogen und Gewölben die beiden
Klosterkirchen von Berlin und Ruppin, jede in ihrer Weise,
fördernd gewirkt, wie die Pfarrkirchen von Berlin, Eberswalde,
Frankfurt, Wittstock, Perleberg, Spandow u. A. deutlich be-
zeugen.
Unter solchen Strömungen, wobei auch Städte wie Neu-
Brandenburg, 1) welche frühzeitig der Mark entfremdet wurden,
betheiligt waren, erreicht dann die Gotliik kurz vor der
Vollendung von Chorin — 1334 — aucli auf dem Gebiete
des städtischen Kirchenbaues einen neuen Gipfelpunkt. Es
ist dies die grofsartige Marienkirche zu Prenzlau — 1325 bis
1340 —, welclie sowolil durch die reife Klarheit ihres inneren
Struktursystemes mit Laufgängen, Wandnischen und reichen
Bündelpfeilern, als auch durch die bisher nie gesehene Gröfse
und Pracht ilires kühn durchbrochenen Chorgiebels nebst dem
Ziergiebelkranze auf beiclen Langseiten einen dauernden und
weitreichenden Einflufs auf die weitere Entwickelung des Back-
steinbaues ausgeiibt hat. Hier war es, wo neben der von
reicher Erfahrung zeugenden musterhaften Profilirung innen
und aufsen der Meister Dietrich zum ersten Male die Clior-
strebepfeiler sowie die Giebelpfeiler oben mit freien Zier-
giebeln krönte, die alten Thonplattenfriese zu gesteigerten
Wirkungen künstlerisch umformte und durch die Farben-
pracht glasirter Ziegel dem Chorgiebel einen Abschlufs gab,
der nicht iibertroffen werden konnte. Ein erster Ableger dieser
herrlichen Kirclie in der Nähe wurde die stattliche und eigen-
artige, leider nur in einem letzten Baureste nocli erhaltene
Klosterkirche von Gramzow — naeh 1350 — mit ihrem
liolien Westgiebel, welcher von einem nocli höheren Oblong-
thurme gekrönt werden sollte. Weitere Ableger finden sich in
clen Marienkirchen zu Gransee und Strafsburg i. U. (um 1380
und 1370), an der Georgskirche zu Prenzlau (um 1370) selbst
und an dem halb versteckten Nördkreuzgiebel von St. Maria
zu Frankfurt (um 1350). Höchstwahrscheinlich ist die grofse
und schöne Pfarrkirche von Ruppin, welche uns leider nur
aus kleinen Abbildungen bekannt ist, auch ein solcher Pflanz-
ling gewesen. Die Marienkirche zu Prenzlau ist abgesehen
1) Die Marienkirche daselbst zeigt durchweg märkische und nicht mecklen-
burgische Baukunst, sie ist schon 1298 (urkundlich) eingeweiht worden und ihr
grofser und schöner Ostgiebel darf als ein Vorläufer des Ostgiebels von Prenzlau
betrachtet werden.
strenge Klosterkirche von Jerichow, welche den Hauptausgangs-
punkt gebildet liat. Neben ihr sind kleinere Centralpunkte
frühzeitig hervorgetreten, welche anregend und befruchtend
weitergewirkt haben. In der Altmark Berge, Diesdorf und
Werben, in der Mittelmark Brandenburg und Jüterbock.
Scliwere Erfahrungen auf dem frisch eroberten und nur noth-
dürftig geschützten Boden, sowie der Entwickelungsgang der
deutschen Baukunst veranlafsten friih den Uebergang zu dem
monumentalen Gewölbebau, dessen Stadien wir zuerst in der
Altmark in Krewese (um 1160), Diesdorf und Arendsee (1161
und 1184), dann in der Mittelmark in Lehnin (1180—1190),
Dobrilugk (1184 —1220) und Treuenbrietzen (1220 —1230)
noch lieute verfolgen können. Yon Diesdorf ab herrscht fast
iiberall das gebundene System, während in den beiden letzt-
genannten Klosterkirchen mehr und melir der romanische
Uebergangsstil liervortritt, dessen schönstes Denkmal, die ori-
ginelle Marienkirche auf dem Harlunger Berge, wir schmerzlich
entbeliren. Aeufsere Einflüsse machten sicli schon danials
geltend und wichtige Neuerungen traten ein. Die Westfront
von Lehnin spiegelt ebenso deutlich normännisch-englisclien Ein-
flufs wieder, wie die Harlunger Bergkirche flandrischen (Tournay)
verrieth. An beiden Kirchen wurden Spitzbogen und halb-
runde Strebepfeiler und Thonplattenfriese eingebürgert. Da-
gegen haben die Pfarrkirchen in Salzwedel, Gardelegen und
Tangermünde in dem alten Schema verharrt, während die
Pfarrkirche St. Lorenz in Salzwedel, die Klosterkirclien von
Dambeck und Güldenstern, ferner die Westfronten von Diesdorf,
Stendal (Dom) und Jerichow den gothisclien Uebergangsstil
bereits entfalteten. Hier im Westen empfing der Backsteinbau
wieder eine bedeutsame Neuerung durch die Einfülirung glasirter
Ziegel an den Westfronten von Diesdorf und Jerichow und an
der Lorenzer Pfarrkirche zu Salzwedel. Sie schlug aber nicht
Wurzel, denn die weitere Entwickelung vollzog sich zunächst in
Mecklenburg, dann in den Hansestädten, um erst in der Mitte
des XIV. Jahrhunderts in der Mark zur voilen Anerkennung
und reichsten Ausbildung zu gelangen.
Nach etwa hundertjährigem Leben starb die romanisclie
Baukunst aus und die frühgothische trat an ihre Stelle. Der
Ausgangspunkt für diese Wandlung und der dauernde Nähr-
boden war der Neubau des Domes zu Magdeburg, aber den
raschen Aufschwung und die weite Yerbreitung des neuen
Stiles hat die rastlose Bauthätigkeit der beiden neugestifteten
und volksbeliebten Bettelmönchsorden vermittelt. Kleine Cister-
cienser-Nonnenkirchen: in der Altmark — Neuendorf (1228),
in der Priegnitz — Marienfliefs (1231) und in der Ukermark
Marienthür (1252), sind bescheidene Yertreter der Frühgothik,
während der grofsartige Umbau des Domes von Havelberg
(von 1270 ab), ferner die Franziskanerkirchen zu Berlin (nach
1271), Frankfurt a. O. (1270), Gransee (1280) und etwas
früher die Dominikanerkirchen zu Ruppin (um 1260) und
Prenzlau (1266) sie in ungleich würdigerer Weise nocli heute
darstellen.
Der städtisclie Pfarrkirchenbau hat sich dieser Pflege
nicht angeschlossen, die überwiegende Mehrzahl derselben in
allen Theilen der Mark hat aus den oben bereits genannten
Gründen an dem starren Granitbau festgehalten; selbst die
praktischen Bettelmönche haben mehrfach denselben nicht ver-
schmäht, wie ihre Kirchen in Prenzlau und Angermünde be-
weisen. Zwei bemerkenswerthe Ausnahmen von dieser Begel
besitzt aber die Neumark: 1. die liöchst interessante Pfarr-
kirclie von Woldenberg, welche als frühgothischer Backstein-
bau vor 1320 fertig gewesen zu sein scheint, und 2. die nocli
ältere Marienkirclie zu Friedeberg, die als Basilika mit Holz-
decken um 1280 erbaut war.
Einen neuen und nachhaltigen Aufscliwung des Back-
steinbaues bewirlcte dann in der zweiten Hälfte des XIII. Jahr-
hunderts der Bau der Klosterkirche von Chorin (seit 1273)
und zwar nicht blofs mit dem überwältigenden Eindrucke
ihrer stolzen auf italisclie Yorbilder zurückweisenden Westfront,
der den mangelnden Organismus übersehen läfst, sondern vor
allem durcli die soi'gfältige, gradezu bewundernswiirdige Pflege,
welclie der Ziegeleibetrieb und die Maurertechnik fast ein Jahr-
hundert lang hier gefunden haben. In beiden Punkten ist
Chorin ein mustergiltiger Bau und bezeichnet mit seiner AVest-
front und seinem Innereu den Gipfelpunkt der Frühgotliik.
Die rationelle Ausbildung des Mafswerkes — durchbrochen
wie reliefartig — sowie die der grofsen Baugiebel und der
kleinen Ziergiebel, ferner die der Consolen, Kapitelle und
Schlufssteine ist hier erfolgt und die Verwendung edler Thon-
plattenfriese in Belief (von Lehnin übernommen) wurde in
mustergiltiger Weise fortgesetzt. Auffallend bleibt dabei die
Thatsache, dafs bei so regem, mannichfaltigem und lang-
jährigem Ziegeleibetriebe die glasirten Backsteine keine Pflege
gefunden haben, wie es docli nahezu gleiclizeitig an den
schönen Portalen der Marienkirche zu Wittstock geschah. Den-
noch ist Chorin’s Einflufs, insbesondere iin Einzelnen, melirere
Jahrzehnte lang nicht blofs in der Nähe, in Eberswalde, Anger-
münde, Templin, Strafsburg, Pasewalk u. A. erkennbar, sondern
auch in der Ferne, in Brandenburg, Frankfurt, Zinna und
Jüterbock. Denn in allen diesen Städten und Klöstern ist
man in der zweiten Hälfte des XIII. Jahrhunderts zur Anlage
o
eigener Ziegeleien in nächster Nähe übergegangen. Neben
Cliorin haben noch fiir die fernere Ausgestaltung des Inneren
mit Pfeilern, Arkaden, Gurtbogen und Gewölben die beiden
Klosterkirchen von Berlin und Ruppin, jede in ihrer Weise,
fördernd gewirkt, wie die Pfarrkirchen von Berlin, Eberswalde,
Frankfurt, Wittstock, Perleberg, Spandow u. A. deutlich be-
zeugen.
Unter solchen Strömungen, wobei auch Städte wie Neu-
Brandenburg, 1) welche frühzeitig der Mark entfremdet wurden,
betheiligt waren, erreicht dann die Gotliik kurz vor der
Vollendung von Chorin — 1334 — aucli auf dem Gebiete
des städtischen Kirchenbaues einen neuen Gipfelpunkt. Es
ist dies die grofsartige Marienkirche zu Prenzlau — 1325 bis
1340 —, welclie sowolil durch die reife Klarheit ihres inneren
Struktursystemes mit Laufgängen, Wandnischen und reichen
Bündelpfeilern, als auch durch die bisher nie gesehene Gröfse
und Pracht ilires kühn durchbrochenen Chorgiebels nebst dem
Ziergiebelkranze auf beiclen Langseiten einen dauernden und
weitreichenden Einflufs auf die weitere Entwickelung des Back-
steinbaues ausgeiibt hat. Hier war es, wo neben der von
reicher Erfahrung zeugenden musterhaften Profilirung innen
und aufsen der Meister Dietrich zum ersten Male die Clior-
strebepfeiler sowie die Giebelpfeiler oben mit freien Zier-
giebeln krönte, die alten Thonplattenfriese zu gesteigerten
Wirkungen künstlerisch umformte und durch die Farben-
pracht glasirter Ziegel dem Chorgiebel einen Abschlufs gab,
der nicht iibertroffen werden konnte. Ein erster Ableger dieser
herrlichen Kirclie in der Nähe wurde die stattliche und eigen-
artige, leider nur in einem letzten Baureste nocli erhaltene
Klosterkirche von Gramzow — naeh 1350 — mit ihrem
liolien Westgiebel, welcher von einem nocli höheren Oblong-
thurme gekrönt werden sollte. Weitere Ableger finden sich in
clen Marienkirchen zu Gransee und Strafsburg i. U. (um 1380
und 1370), an der Georgskirche zu Prenzlau (um 1370) selbst
und an dem halb versteckten Nördkreuzgiebel von St. Maria
zu Frankfurt (um 1350). Höchstwahrscheinlich ist die grofse
und schöne Pfarrkirche von Ruppin, welche uns leider nur
aus kleinen Abbildungen bekannt ist, auch ein solcher Pflanz-
ling gewesen. Die Marienkirche zu Prenzlau ist abgesehen
1) Die Marienkirche daselbst zeigt durchweg märkische und nicht mecklen-
burgische Baukunst, sie ist schon 1298 (urkundlich) eingeweiht worden und ihr
grofser und schöner Ostgiebel darf als ein Vorläufer des Ostgiebels von Prenzlau
betrachtet werden.