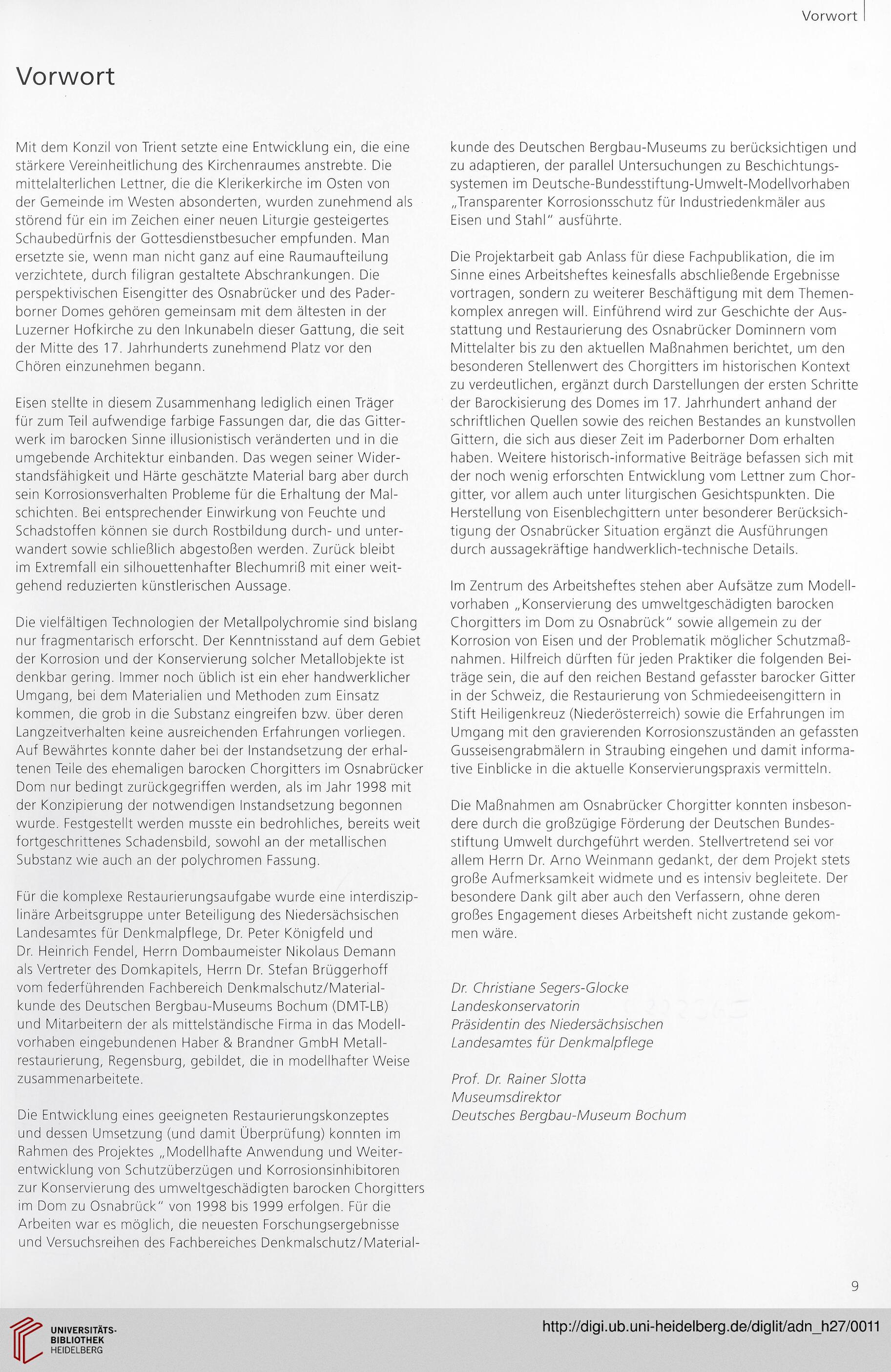Vorwort
Vorwort
Mit dem Konzil von Trient setzte eine Entwicklung ein, die eine
stärkere Vereinheitlichung des Kirchenraumes anstrebte. Die
mittelalterlichen Lettner, die die Klerikerkirche im Osten von
der Gemeinde im Westen absonderten, wurden zunehmend als
störend für ein im Zeichen einer neuen Liturgie gesteigertes
Schaubedürfnis der Gottesdienstbesucher empfunden. Man
ersetzte sie, wenn man nicht ganz auf eine Raumaufteilung
verzichtete, durch filigran gestaltete Abschrankungen. Die
perspektivischen Eisengitter des Osnabrücker und des Pader-
borner Domes gehören gemeinsam mit dem ältesten in der
Luzerner Hofkirche zu den Inkunabeln dieser Gattung, die seit
der Mitte des 17. Jahrhunderts zunehmend Platz vor den
Chören einzunehmen begann.
Eisen stellte in diesem Zusammenhang lediglich einen Träger
für zum Teil aufwendige farbige Fassungen dar, die das Gitter-
werk im barocken Sinne illusionistisch veränderten und in die
umgebende Architektur einbanden. Das wegen seiner Wider-
standsfähigkeit und Härte geschätzte Material barg aber durch
sein Korrosionsverhalten Probleme für die Erhaltung der Mal-
schichten. Bei entsprechender Einwirkung von Feuchte und
Schadstoffen können sie durch Rostbildung durch- und unter-
wandert sowie schließlich abgestoßen werden. Zurück bleibt
im Extremfall ein silhouettenhafter Blechumriß mit einer weit-
gehend reduzierten künstlerischen Aussage.
Die vielfältigen Technologien der Metallpolychromie sind bislang
nur fragmentarisch erforscht. Der Kenntnisstand auf dem Gebiet
der Korrosion und der Konservierung solcher Metallobjekte ist
denkbar gering. Immer noch üblich ist ein eher handwerklicher
Umgang, bei dem Materialien und Methoden zum Einsatz
kommen, die grob in die Substanz eingreifen bzw. über deren
Langzeitverhalten keine ausreichenden Erfahrungen vorliegen.
Auf Bewährtes konnte daher bei der Instandsetzung der erhal-
tenen Teile des ehemaligen barocken Chorgitters im Osnabrücker
Dom nur bedingt zurückgegriffen werden, als im Jahr 1998 mit
der Konzipierung der notwendigen Instandsetzung begonnen
wurde. Festgestellt werden musste ein bedrohliches, bereits weit
fortgeschrittenes Schadensbild, sowohl an der metallischen
Substanz wie auch an der polychromen Fassung.
Für die komplexe Restaurierungsaufgabe wurde eine interdiszip-
linäre Arbeitsgruppe unter Beteiligung des Niedersächsischen
Landesamtes für Denkmalpflege, Dr. Peter Königfeld und
Dr. Heinrich Fendel, Herrn Dombaumeister Nikolaus Demann
als Vertreter des Domkapitels, Herrn Dr. Stefan Brüggerhoff
vom federführenden Fachbereich Denkmalschutz/Material-
kunde des Deutschen Bergbau-Museums Bochum (DMT-LB)
und Mitarbeitern der als mittelständische Firma in das Modell-
vorhaben eingebundenen Haber & Brandner GmbH Metall-
restaurierung, Regensburg, gebildet, die in modellhafter Weise
zusammenarbeitete.
Die Entwicklung eines geeigneten Restaurierungskonzeptes
und dessen Umsetzung (und damit Überprüfung) konnten im
Rahmen des Projektes „Modellhafte Anwendung und Weiter-
entwicklung von Schutzüberzügen und Korrosionsinhibitoren
zur Konservierung des umweltgeschädigten barocken Chorgitters
im Dom zu Osnabrück" von 1998 bis 1999 erfolgen. Für die
Arbeiten war es möglich, die neuesten Forschungsergebnisse
und Versuchsreihen des Fachbereiches Denkmalschutz/Material-
kunde des Deutschen Bergbau-Museums zu berücksichtigen und
zu adaptieren, der parallel Untersuchungen zu Beschichtungs-
systemen im Deutsche-Bundesstiftung-Umwelt-Modellvorhaben
„Transparenter Korrosionsschutz für Industriedenkmäler aus
Eisen und Stahl" ausführte.
Die Projektarbeit gab Anlass für diese Fachpublikation, die im
Sinne eines Arbeitsheftes keinesfalls abschließende Ergebnisse
vortragen, sondern zu weiterer Beschäftigung mit dem Themen-
komplex anregen will. Einführend wird zur Geschichte der Aus-
stattung und Restaurierung des Osnabrücker Dominnern vom
Mittelalter bis zu den aktuellen Maßnahmen berichtet, um den
besonderen Stellenwert des Chorgitters im historischen Kontext
zu verdeutlichen, ergänzt durch Darstellungen der ersten Schritte
der Barockisierung des Domes im 17. Jahrhundert anhand der
schriftlichen Quellen sowie des reichen Bestandes an kunstvollen
Gittern, die sich aus dieser Zeit im Paderborner Dom erhalten
haben. Weitere historisch-informative Beiträge befassen sich mit
der noch wenig erforschten Entwicklung vom Lettner zum Chor-
gitter, vor allem auch unter liturgischen Gesichtspunkten. Die
Herstellung von Eisenblechgittern unter besonderer Berücksich-
tigung der Osnabrücker Situation ergänzt die Ausführungen
durch aussagekräftige handwerklich-technische Details.
Im Zentrum des Arbeitsheftes stehen aber Aufsätze zum Modell-
vorhaben „Konservierung des umweltgeschädigten barocken
Chorgitters im Dom zu Osnabrück" sowie allgemein zu der
Korrosion von Eisen und der Problematik möglicher Schutzmaß-
nahmen. Hilfreich dürften für jeden Praktiker die folgenden Bei-
träge sein, die auf den reichen Bestand gefasster barocker Gitter
in der Schweiz, die Restaurierung von Schmiedeeisengittern in
Stift Heiligenkreuz (Niederösterreich) sowie die Erfahrungen im
Umgang mit den gravierenden Korrosionszuständen an gefassten
Gusseisengrabmälern in Straubing eingehen und damit informa-
tive Einblicke in die aktuelle Konservierungspraxis vermitteln.
Die Maßnahmen am Osnabrücker Chorgitter konnten insbeson-
dere durch die großzügige Förderung der Deutschen Bundes-
stiftung Umwelt durchgeführt werden. Stellvertretend sei vor
allem Herrn Dr. Arno Weinmann gedankt, der dem Projekt stets
große Aufmerksamkeit widmete und es intensiv begleitete. Der
besondere Dank gilt aber auch den Verfassern, ohne deren
großes Engagement dieses Arbeitsheft nicht zustande gekom-
men wäre.
Dr. Christiane Segers-Glocke
Landeskonservatorin
Präsidentin des Niedersächsischen
Landesamtes für Denkmalpflege
Prof. Dr. Rainer Slotta
Museumsdirektor
Deutsches Bergbau-Museum Bochum
9
Vorwort
Mit dem Konzil von Trient setzte eine Entwicklung ein, die eine
stärkere Vereinheitlichung des Kirchenraumes anstrebte. Die
mittelalterlichen Lettner, die die Klerikerkirche im Osten von
der Gemeinde im Westen absonderten, wurden zunehmend als
störend für ein im Zeichen einer neuen Liturgie gesteigertes
Schaubedürfnis der Gottesdienstbesucher empfunden. Man
ersetzte sie, wenn man nicht ganz auf eine Raumaufteilung
verzichtete, durch filigran gestaltete Abschrankungen. Die
perspektivischen Eisengitter des Osnabrücker und des Pader-
borner Domes gehören gemeinsam mit dem ältesten in der
Luzerner Hofkirche zu den Inkunabeln dieser Gattung, die seit
der Mitte des 17. Jahrhunderts zunehmend Platz vor den
Chören einzunehmen begann.
Eisen stellte in diesem Zusammenhang lediglich einen Träger
für zum Teil aufwendige farbige Fassungen dar, die das Gitter-
werk im barocken Sinne illusionistisch veränderten und in die
umgebende Architektur einbanden. Das wegen seiner Wider-
standsfähigkeit und Härte geschätzte Material barg aber durch
sein Korrosionsverhalten Probleme für die Erhaltung der Mal-
schichten. Bei entsprechender Einwirkung von Feuchte und
Schadstoffen können sie durch Rostbildung durch- und unter-
wandert sowie schließlich abgestoßen werden. Zurück bleibt
im Extremfall ein silhouettenhafter Blechumriß mit einer weit-
gehend reduzierten künstlerischen Aussage.
Die vielfältigen Technologien der Metallpolychromie sind bislang
nur fragmentarisch erforscht. Der Kenntnisstand auf dem Gebiet
der Korrosion und der Konservierung solcher Metallobjekte ist
denkbar gering. Immer noch üblich ist ein eher handwerklicher
Umgang, bei dem Materialien und Methoden zum Einsatz
kommen, die grob in die Substanz eingreifen bzw. über deren
Langzeitverhalten keine ausreichenden Erfahrungen vorliegen.
Auf Bewährtes konnte daher bei der Instandsetzung der erhal-
tenen Teile des ehemaligen barocken Chorgitters im Osnabrücker
Dom nur bedingt zurückgegriffen werden, als im Jahr 1998 mit
der Konzipierung der notwendigen Instandsetzung begonnen
wurde. Festgestellt werden musste ein bedrohliches, bereits weit
fortgeschrittenes Schadensbild, sowohl an der metallischen
Substanz wie auch an der polychromen Fassung.
Für die komplexe Restaurierungsaufgabe wurde eine interdiszip-
linäre Arbeitsgruppe unter Beteiligung des Niedersächsischen
Landesamtes für Denkmalpflege, Dr. Peter Königfeld und
Dr. Heinrich Fendel, Herrn Dombaumeister Nikolaus Demann
als Vertreter des Domkapitels, Herrn Dr. Stefan Brüggerhoff
vom federführenden Fachbereich Denkmalschutz/Material-
kunde des Deutschen Bergbau-Museums Bochum (DMT-LB)
und Mitarbeitern der als mittelständische Firma in das Modell-
vorhaben eingebundenen Haber & Brandner GmbH Metall-
restaurierung, Regensburg, gebildet, die in modellhafter Weise
zusammenarbeitete.
Die Entwicklung eines geeigneten Restaurierungskonzeptes
und dessen Umsetzung (und damit Überprüfung) konnten im
Rahmen des Projektes „Modellhafte Anwendung und Weiter-
entwicklung von Schutzüberzügen und Korrosionsinhibitoren
zur Konservierung des umweltgeschädigten barocken Chorgitters
im Dom zu Osnabrück" von 1998 bis 1999 erfolgen. Für die
Arbeiten war es möglich, die neuesten Forschungsergebnisse
und Versuchsreihen des Fachbereiches Denkmalschutz/Material-
kunde des Deutschen Bergbau-Museums zu berücksichtigen und
zu adaptieren, der parallel Untersuchungen zu Beschichtungs-
systemen im Deutsche-Bundesstiftung-Umwelt-Modellvorhaben
„Transparenter Korrosionsschutz für Industriedenkmäler aus
Eisen und Stahl" ausführte.
Die Projektarbeit gab Anlass für diese Fachpublikation, die im
Sinne eines Arbeitsheftes keinesfalls abschließende Ergebnisse
vortragen, sondern zu weiterer Beschäftigung mit dem Themen-
komplex anregen will. Einführend wird zur Geschichte der Aus-
stattung und Restaurierung des Osnabrücker Dominnern vom
Mittelalter bis zu den aktuellen Maßnahmen berichtet, um den
besonderen Stellenwert des Chorgitters im historischen Kontext
zu verdeutlichen, ergänzt durch Darstellungen der ersten Schritte
der Barockisierung des Domes im 17. Jahrhundert anhand der
schriftlichen Quellen sowie des reichen Bestandes an kunstvollen
Gittern, die sich aus dieser Zeit im Paderborner Dom erhalten
haben. Weitere historisch-informative Beiträge befassen sich mit
der noch wenig erforschten Entwicklung vom Lettner zum Chor-
gitter, vor allem auch unter liturgischen Gesichtspunkten. Die
Herstellung von Eisenblechgittern unter besonderer Berücksich-
tigung der Osnabrücker Situation ergänzt die Ausführungen
durch aussagekräftige handwerklich-technische Details.
Im Zentrum des Arbeitsheftes stehen aber Aufsätze zum Modell-
vorhaben „Konservierung des umweltgeschädigten barocken
Chorgitters im Dom zu Osnabrück" sowie allgemein zu der
Korrosion von Eisen und der Problematik möglicher Schutzmaß-
nahmen. Hilfreich dürften für jeden Praktiker die folgenden Bei-
träge sein, die auf den reichen Bestand gefasster barocker Gitter
in der Schweiz, die Restaurierung von Schmiedeeisengittern in
Stift Heiligenkreuz (Niederösterreich) sowie die Erfahrungen im
Umgang mit den gravierenden Korrosionszuständen an gefassten
Gusseisengrabmälern in Straubing eingehen und damit informa-
tive Einblicke in die aktuelle Konservierungspraxis vermitteln.
Die Maßnahmen am Osnabrücker Chorgitter konnten insbeson-
dere durch die großzügige Förderung der Deutschen Bundes-
stiftung Umwelt durchgeführt werden. Stellvertretend sei vor
allem Herrn Dr. Arno Weinmann gedankt, der dem Projekt stets
große Aufmerksamkeit widmete und es intensiv begleitete. Der
besondere Dank gilt aber auch den Verfassern, ohne deren
großes Engagement dieses Arbeitsheft nicht zustande gekom-
men wäre.
Dr. Christiane Segers-Glocke
Landeskonservatorin
Präsidentin des Niedersächsischen
Landesamtes für Denkmalpflege
Prof. Dr. Rainer Slotta
Museumsdirektor
Deutsches Bergbau-Museum Bochum
9