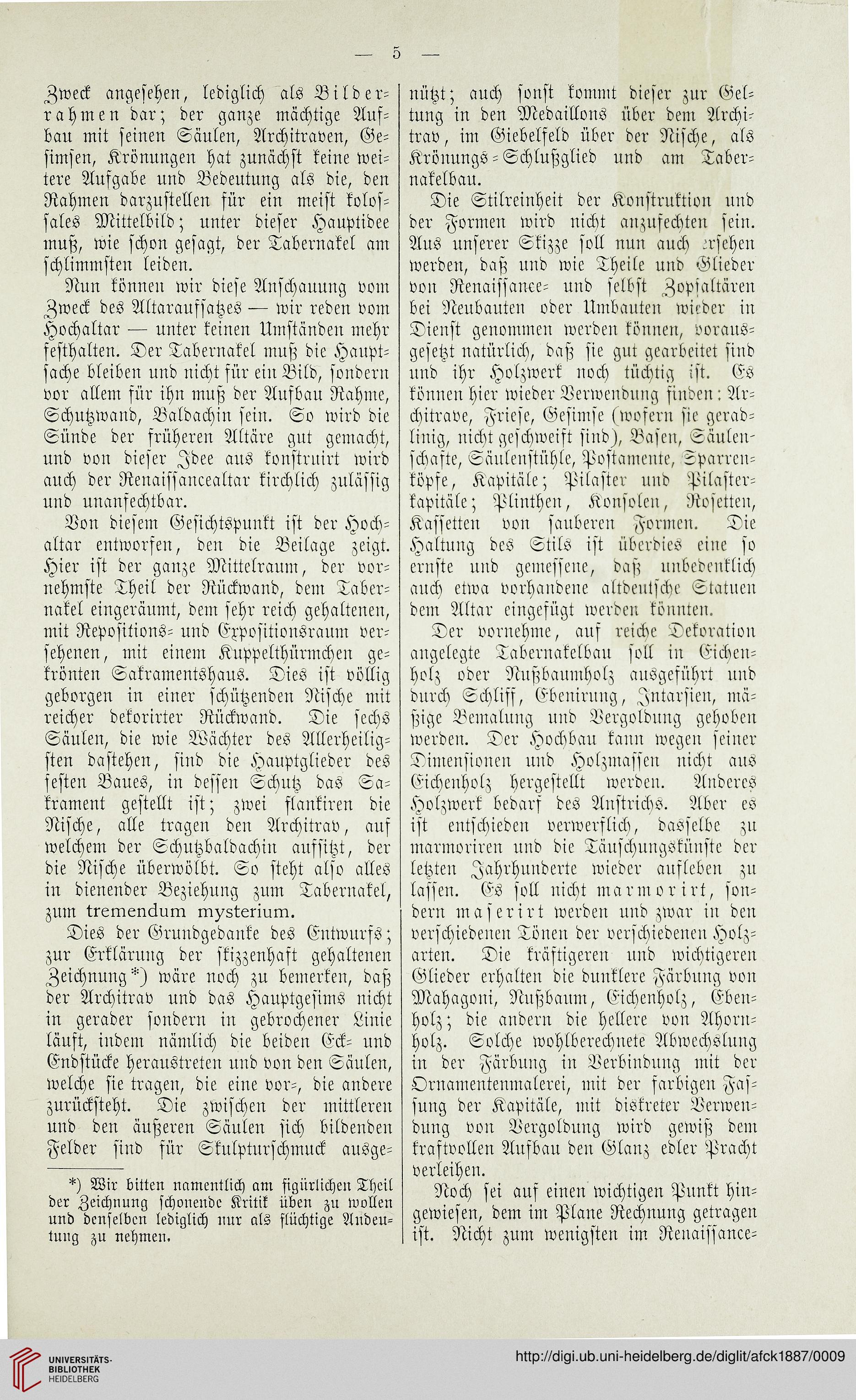0
Zweck angesehen, lediglich als Bilder-
rahmen dar; der ganze mächtige Auf-
bau mit seinen Säulen, Architraven, Ge-
simsen, Krönungen hat zunächst keine wei-
tere Ausgabe und Bedeutung als die, den
Rahmen darzustellen für ein meist kolos-
sales Mittelbild; unter dieser Hanptidee
muß, wie schon gesagt, der Tabernakel am
schlimmsten leiden.
Nun können wir diese Anschauung vom
Zweck des Altaraussatzes — wir reden vom
Hochaltar ■— unter keinen Umständen mehr
festhalten. Der Tabernakel muß die Haupt-
sache bleiben und nicht für ein Bild, sondern
vor allem für ihn muß der Aufbau Rahme,
Schutzwand, Baldachin sein. So wird die
Sünde der früheren Altäre gut gemacht,
und von dieser Idee aus konstruirt wird
auch der Renaissancealtar kirchlich zulässig
und unanfechtbar.
Bon diesem Gesichtspunkt ist der Hoch-
altar entworfen, den die Beilage zeigt.
Hier ist der ganze Mittelranm, der vor-
nehmste Theil der Rückwand, dem Taber-
nakel eingeräumt, dem sehr reich gehaltenen,
mit Repositions- und Expositionsraum ver-
sehenen, mit einem Kuppelthürmchen ge-
krönten Sakramentshaus. Dies ist völlig
geborgen in einer schützenden Nische mit
reicher dekorirter Rückwand. Die sechs
Säulen, die wie Wächter des Allerheilig-
sten dastehen, sind die Hanptglieder des
festen Baues, in dessen Schutz das Sa-
krament gestellt ist; zwei flankiren die
Nische, alle tragen den Architrav, auf
welchem der Schutzbaldachin aussitzt, der
die Nische überwölbt. So steht also alles
in dienender Beziehung zum Tabernakel,
zmn tremenclum mysterium.
Dies der Grundgedanke des Entwurfs;
zur Erklärung der skizzenhaft gehaltenen
Zeichnung*) wäre noch zu bemerken, daß
der Architrav und das Hauptgesims nicht
in gerader sondern in gebrochener Linie
läuft, indem nämlich die beiden Eck- und
Endstücke heraustreten und von den Säulen,
welche sie tragen, die eine vor-, die andere
zurücksteht. Die zwischen der mittleren
und den äußeren Säulen sich bildenden
Felder sind für Skulpturschmuck ausge-
*) Wir bitten namentlich am figürlichen Theil
der Zeichnung schonende Kritik üben zu wollen
und denselben lediglich nur als flüchtige Andeu-
tung zu nehmen.
nützt; auch sonst kommt dieser zur Gel-
tung in den Medaillons über dem Archi-
trav, im Giebelfeld über der Nische, als
Krönungs-Schlußglied und am Taber-
nakelbau.
Die Stilreinheit der Konstruktion und
der Formen wird nicht anzusechten sein.
Aus unserer Skizze soll nun auch ersehen
werden, daß und wie Theile und Glieder
von Renaissance- und selbst Zopsaltären
bei Neubauten oder Umbauten wieder in
Dienst genommen werden können, voraus-
gesetzt natürlich, daß sie gut gearbeitet sind
und ihr Holzwerk lioch tüchtig ist. Es
können hier wieder Verwendung finden: Ar-
chitrave, Friese, Gesimse (wofern sie gerad-
litiig, nicht geschweift sind), Basen, Säulen-
schaste, Säulenstühle, Postamente, Lparrcn-
köpfe, Kapitäle; Pilaster und Pilaster-
kapitäle; Plinthen, Konsolen, Rosetten,
Kassetten von sauberen Formen. Die
Haltung des Stils ist überdies eine so
ernste und gemessene, daß unbedenklich
auch etwa vorhandene altdeutsche Statuen
dem Altar eingefügt werden könnten.
Der vornehme, auf reiche Dekoration
angelegte Tabernakelbau soll in Eichen-
holz oder Nußbaumholz ausgeführt und
durch Schliff, Ebenirnng, Intarsien, mä-
ßige Bemalung und Vergoldung gehoben
werden. Der Hochbau kann wegen seiner
Dimensionen und Holzmassen nicht aus
Eichenholz hergestellt werden. Anderes
Holzwerk bedarf des Anstrichs. Aber es
ist entschieden verwerflich, dasselbe zu
marmoriren und die Täuschungskünste der
letzten Jahrhunderte wieder aufleben zu
lasten. Es soll nicht marm or irt, son-
dern maserirt werden und zwar in den
verschiedenen Tönen der verschiedenen Holz-
arten. Die kräftigeren und wichtigeren
Glieder erhalten die dunklere Färbung von
Mahagoni, Nnßbaum, Eichenholz, Eben-
holz; die andern die hellere von Ahorn-
holz. Solche wohlberechnete Abwechslung
in der Färbung in Verbindung mit der
Ornamentenmalerei, mit der farbigen Fas-
sung der Kapitäle, mit diskreter Verwen-
dung von Vergoldung wird gewiß dem
kraftvollen Ausbau den Glanz edler Pracht
verleihen.
Noch sei ans einen wichtigen Punkt hin-
gewiesen, dem im Plane Rechnung getragen
ist. Nicht zum wenigsten im Renaissance-
Zweck angesehen, lediglich als Bilder-
rahmen dar; der ganze mächtige Auf-
bau mit seinen Säulen, Architraven, Ge-
simsen, Krönungen hat zunächst keine wei-
tere Ausgabe und Bedeutung als die, den
Rahmen darzustellen für ein meist kolos-
sales Mittelbild; unter dieser Hanptidee
muß, wie schon gesagt, der Tabernakel am
schlimmsten leiden.
Nun können wir diese Anschauung vom
Zweck des Altaraussatzes — wir reden vom
Hochaltar ■— unter keinen Umständen mehr
festhalten. Der Tabernakel muß die Haupt-
sache bleiben und nicht für ein Bild, sondern
vor allem für ihn muß der Aufbau Rahme,
Schutzwand, Baldachin sein. So wird die
Sünde der früheren Altäre gut gemacht,
und von dieser Idee aus konstruirt wird
auch der Renaissancealtar kirchlich zulässig
und unanfechtbar.
Bon diesem Gesichtspunkt ist der Hoch-
altar entworfen, den die Beilage zeigt.
Hier ist der ganze Mittelranm, der vor-
nehmste Theil der Rückwand, dem Taber-
nakel eingeräumt, dem sehr reich gehaltenen,
mit Repositions- und Expositionsraum ver-
sehenen, mit einem Kuppelthürmchen ge-
krönten Sakramentshaus. Dies ist völlig
geborgen in einer schützenden Nische mit
reicher dekorirter Rückwand. Die sechs
Säulen, die wie Wächter des Allerheilig-
sten dastehen, sind die Hanptglieder des
festen Baues, in dessen Schutz das Sa-
krament gestellt ist; zwei flankiren die
Nische, alle tragen den Architrav, auf
welchem der Schutzbaldachin aussitzt, der
die Nische überwölbt. So steht also alles
in dienender Beziehung zum Tabernakel,
zmn tremenclum mysterium.
Dies der Grundgedanke des Entwurfs;
zur Erklärung der skizzenhaft gehaltenen
Zeichnung*) wäre noch zu bemerken, daß
der Architrav und das Hauptgesims nicht
in gerader sondern in gebrochener Linie
läuft, indem nämlich die beiden Eck- und
Endstücke heraustreten und von den Säulen,
welche sie tragen, die eine vor-, die andere
zurücksteht. Die zwischen der mittleren
und den äußeren Säulen sich bildenden
Felder sind für Skulpturschmuck ausge-
*) Wir bitten namentlich am figürlichen Theil
der Zeichnung schonende Kritik üben zu wollen
und denselben lediglich nur als flüchtige Andeu-
tung zu nehmen.
nützt; auch sonst kommt dieser zur Gel-
tung in den Medaillons über dem Archi-
trav, im Giebelfeld über der Nische, als
Krönungs-Schlußglied und am Taber-
nakelbau.
Die Stilreinheit der Konstruktion und
der Formen wird nicht anzusechten sein.
Aus unserer Skizze soll nun auch ersehen
werden, daß und wie Theile und Glieder
von Renaissance- und selbst Zopsaltären
bei Neubauten oder Umbauten wieder in
Dienst genommen werden können, voraus-
gesetzt natürlich, daß sie gut gearbeitet sind
und ihr Holzwerk lioch tüchtig ist. Es
können hier wieder Verwendung finden: Ar-
chitrave, Friese, Gesimse (wofern sie gerad-
litiig, nicht geschweift sind), Basen, Säulen-
schaste, Säulenstühle, Postamente, Lparrcn-
köpfe, Kapitäle; Pilaster und Pilaster-
kapitäle; Plinthen, Konsolen, Rosetten,
Kassetten von sauberen Formen. Die
Haltung des Stils ist überdies eine so
ernste und gemessene, daß unbedenklich
auch etwa vorhandene altdeutsche Statuen
dem Altar eingefügt werden könnten.
Der vornehme, auf reiche Dekoration
angelegte Tabernakelbau soll in Eichen-
holz oder Nußbaumholz ausgeführt und
durch Schliff, Ebenirnng, Intarsien, mä-
ßige Bemalung und Vergoldung gehoben
werden. Der Hochbau kann wegen seiner
Dimensionen und Holzmassen nicht aus
Eichenholz hergestellt werden. Anderes
Holzwerk bedarf des Anstrichs. Aber es
ist entschieden verwerflich, dasselbe zu
marmoriren und die Täuschungskünste der
letzten Jahrhunderte wieder aufleben zu
lasten. Es soll nicht marm or irt, son-
dern maserirt werden und zwar in den
verschiedenen Tönen der verschiedenen Holz-
arten. Die kräftigeren und wichtigeren
Glieder erhalten die dunklere Färbung von
Mahagoni, Nnßbaum, Eichenholz, Eben-
holz; die andern die hellere von Ahorn-
holz. Solche wohlberechnete Abwechslung
in der Färbung in Verbindung mit der
Ornamentenmalerei, mit der farbigen Fas-
sung der Kapitäle, mit diskreter Verwen-
dung von Vergoldung wird gewiß dem
kraftvollen Ausbau den Glanz edler Pracht
verleihen.
Noch sei ans einen wichtigen Punkt hin-
gewiesen, dem im Plane Rechnung getragen
ist. Nicht zum wenigsten im Renaissance-