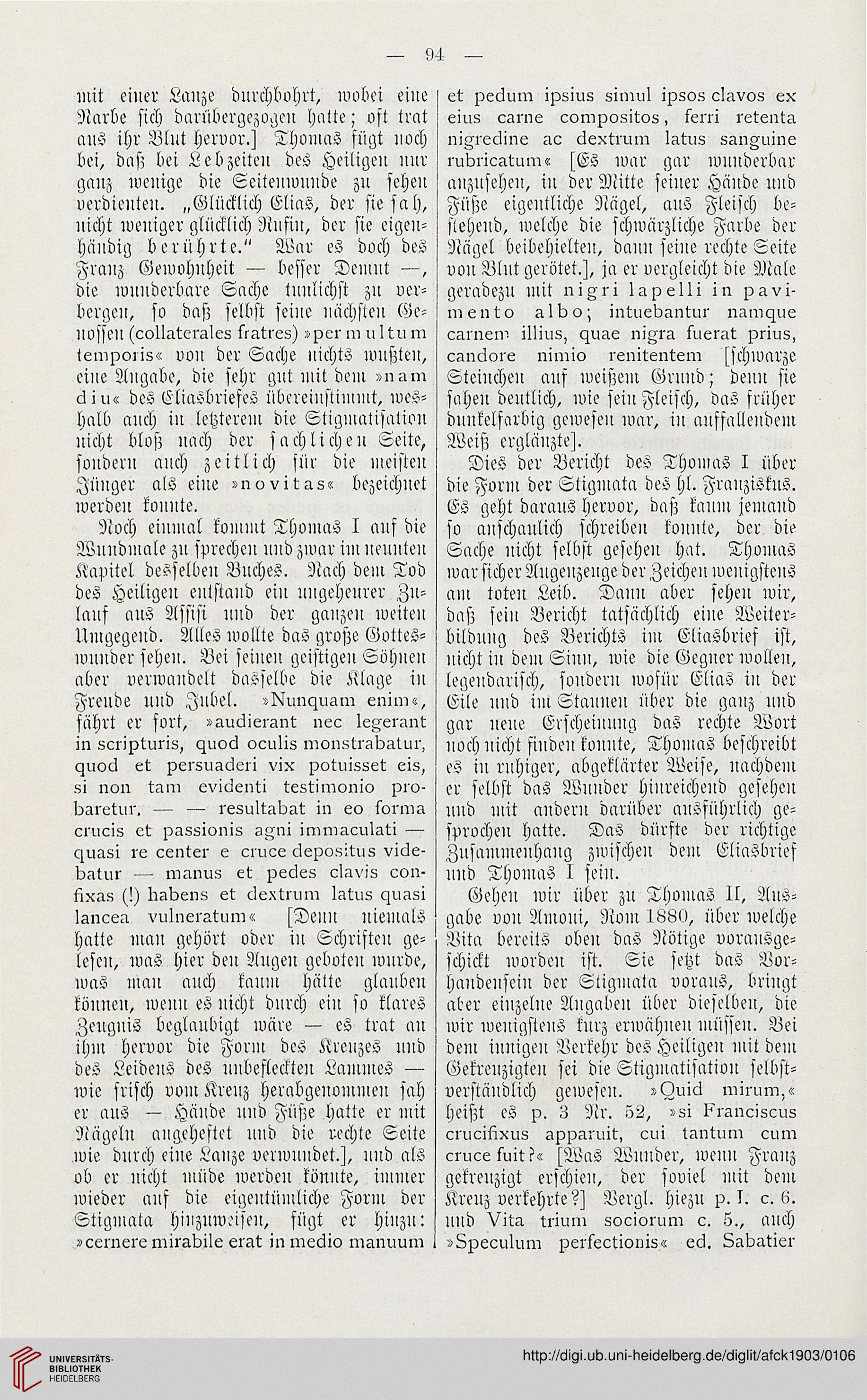94
mit einer Lanze durchbohrt, wobei eine
Narbe sich darübergezogen hatte; oft trat
ans ihr Blut hervor.) Thomas fügt noch
bei, daß bei Lebzeiten des Heiligen nur
ganz wenige die Seitenwunde zu sehen
verdienten. „Glücklich Elias, der sie sah,
nicht weniger glücklich Rnfin, der sie eigen-
händig berührte." War es doch des
Franz Gewohnheit — besser Demut —,
die wunderbare Sache tunlichst zu ver-
bergen, so daß selbst seine nächsten Ge-
nossen (collatcralcs fratres) »per m ul tu m
temporis« von der Sache nichts wußten,
eine Angabe, die sehr gut mit beut »nam
diu« des Eliasbriefes übereinstimmt, wes-
halb auch in letzterent die Stigmatisation
nicht bloß nach der sachlichen Seite,
sondern auch zeitlich für die nteisten
Jünger als eine »novitas« bezeichnet
werden konnte.
Noch einmal kommt Thomas I auf die
Wundmale zu sprechen und zwar im neunten
Kapitel desselben Buches. Nach dem Tod
des Heiligen entstand ein ungeheurer Zn-
lanf aus Assisi mtb der ganzen weiten
Umgegend. Alles wollte das große Gottcs-
wunder sehen. Bei seinen geistigen Söhnen
aber verwandelt dasselbe die Klage in
Freude und Jubel. »Nunquam enim«,
fährt er fort, »audierant nec legerant
in scripturis, quod oculis monstrabatur,
quod et persuaderi vix potuisset eis,
si non tarn evidenti testimonio pro-
baretur. — — resultabat in eo forma
crucis et passionis agni immaculati —
quasi re center e cruce depositus vide-
batur — manus et pedes clavis con-
fixas (!) habens et dextrum latus quasi
lancea vulneratum« (Denn niemals
hatte ntan gehört oder in Schriften ge-
lesen, was hier den Augen geboten wurde,
tvas mem auch kaum hätte glauben
können, wenn es nicht durch ein so klares
Zeugnis beglaubigt wäre — es trat an
ihm hervor die Form des Kreuzes und
des Leidens des unbefleckten Lammes —
wie frisch vom Kreuz herabgenommen sah
er aus — Hände und Füße hatte er mit
Nägeln angeheftet und die rechte Seite
wie durch eine Lanze verwundet.), und als
ob er nicht müde werden könnte, immer
wieder ans die eigentümliche Form der
Stigntata hinznweisen, fügt er hinzu:
»cernere mirabile erat in medio manuura
et pedum ipsius simul ipsos clavos ex
eius carne compositos, ferri retenta
nigredine ac dextrum latus sanguine
rubricatum« sEs tvar gar wunderbar
anzusehen, in der Blitte seiner Hände und
Füße eigentliche Nägel, aus Fleisch be-
stehend, welche die schwärzliche Farbe der
Nägel beibehielten, dann seine rechte Seite
voit Blut gerötet.), ja er vergleicht die Male
geradezu mit nigri lapelli in pavi-
rnento albo; intuebantur namque
carnem illius, quae nigra fuerat prius,
candore nimio renitentem sschivarze
Steinchen auf iveißent Grund; denn sie
sahen deutlich, wie sein Fleisch, das früher
dunkelfarbig gewesen war, in auffallendem
Weiß erglänzte).
Dies der Bericht des Thomas I über
die Form der Stigmata deS hl. Franziskus.
Es geht daraus hervor, daß kann, jemand
so anschaulich schreiben konnte, der die
Sache nicht selbst gesehen hat. Thonras
>var sicher Augenzeuge der Zeichen wenigstens
am toten Leib. Dann aber sehen wir,
daß sein Bericht tatsächlich eine Weiter-
bildung des Berichts im Eliasbrief ist,
nicht in bent Sinn, wie die Gegner wollen,
legendarisch, sondern wofür Elias in der
Eile und im Staunen über die ganz und
gar neue Erscheinung das rechte Wort
noch nicht finden konnte, Thomas beschreibt
es in ruhiger, abgeklärter Weise, nachdem
er selbst das Wunder hinreichend gesehen
und mit andern darüber ausführlich ge-
sprochen hatte. DaS dürfte der richtige
Zusammenhang zwischen dem Eliasbrief
und Thomas 1 sein.
Gehen wir über zu Thomas ll, Aus-
gabe von Amoui, Rom 1880, über welche
Vita bereits oben das Nötige voransge-
schickt worden ist. Sie setzt das Vor-
handensein der Stigmata voraus, bringt
aber einzelne Angaben über dieselben, die
wir wenigstens kurz erwähnen müssen. Bei
dem innigen Verkehr des Heiligen mit dein
Gekreuzigten sei die Stigmatisation selbst-
verständlich gewesen. »Quid mirum,«
heißt es p. 3 Nr. 52, »si Franciscus
crucifixus apparuit, cui tantum cum
cruce fuit?« sWas Wunder, wenn Franz
gekreuzigt erschien, der soviel mit dem
Kreuz verkehrte?) Vergl. hiezu p. I. c. 6.
und Vita trittrn sociorum c. 5., auch
»Speculum perfectionis« ed. Sabatier
mit einer Lanze durchbohrt, wobei eine
Narbe sich darübergezogen hatte; oft trat
ans ihr Blut hervor.) Thomas fügt noch
bei, daß bei Lebzeiten des Heiligen nur
ganz wenige die Seitenwunde zu sehen
verdienten. „Glücklich Elias, der sie sah,
nicht weniger glücklich Rnfin, der sie eigen-
händig berührte." War es doch des
Franz Gewohnheit — besser Demut —,
die wunderbare Sache tunlichst zu ver-
bergen, so daß selbst seine nächsten Ge-
nossen (collatcralcs fratres) »per m ul tu m
temporis« von der Sache nichts wußten,
eine Angabe, die sehr gut mit beut »nam
diu« des Eliasbriefes übereinstimmt, wes-
halb auch in letzterent die Stigmatisation
nicht bloß nach der sachlichen Seite,
sondern auch zeitlich für die nteisten
Jünger als eine »novitas« bezeichnet
werden konnte.
Noch einmal kommt Thomas I auf die
Wundmale zu sprechen und zwar im neunten
Kapitel desselben Buches. Nach dem Tod
des Heiligen entstand ein ungeheurer Zn-
lanf aus Assisi mtb der ganzen weiten
Umgegend. Alles wollte das große Gottcs-
wunder sehen. Bei seinen geistigen Söhnen
aber verwandelt dasselbe die Klage in
Freude und Jubel. »Nunquam enim«,
fährt er fort, »audierant nec legerant
in scripturis, quod oculis monstrabatur,
quod et persuaderi vix potuisset eis,
si non tarn evidenti testimonio pro-
baretur. — — resultabat in eo forma
crucis et passionis agni immaculati —
quasi re center e cruce depositus vide-
batur — manus et pedes clavis con-
fixas (!) habens et dextrum latus quasi
lancea vulneratum« (Denn niemals
hatte ntan gehört oder in Schriften ge-
lesen, was hier den Augen geboten wurde,
tvas mem auch kaum hätte glauben
können, wenn es nicht durch ein so klares
Zeugnis beglaubigt wäre — es trat an
ihm hervor die Form des Kreuzes und
des Leidens des unbefleckten Lammes —
wie frisch vom Kreuz herabgenommen sah
er aus — Hände und Füße hatte er mit
Nägeln angeheftet und die rechte Seite
wie durch eine Lanze verwundet.), und als
ob er nicht müde werden könnte, immer
wieder ans die eigentümliche Form der
Stigntata hinznweisen, fügt er hinzu:
»cernere mirabile erat in medio manuura
et pedum ipsius simul ipsos clavos ex
eius carne compositos, ferri retenta
nigredine ac dextrum latus sanguine
rubricatum« sEs tvar gar wunderbar
anzusehen, in der Blitte seiner Hände und
Füße eigentliche Nägel, aus Fleisch be-
stehend, welche die schwärzliche Farbe der
Nägel beibehielten, dann seine rechte Seite
voit Blut gerötet.), ja er vergleicht die Male
geradezu mit nigri lapelli in pavi-
rnento albo; intuebantur namque
carnem illius, quae nigra fuerat prius,
candore nimio renitentem sschivarze
Steinchen auf iveißent Grund; denn sie
sahen deutlich, wie sein Fleisch, das früher
dunkelfarbig gewesen war, in auffallendem
Weiß erglänzte).
Dies der Bericht des Thomas I über
die Form der Stigmata deS hl. Franziskus.
Es geht daraus hervor, daß kann, jemand
so anschaulich schreiben konnte, der die
Sache nicht selbst gesehen hat. Thonras
>var sicher Augenzeuge der Zeichen wenigstens
am toten Leib. Dann aber sehen wir,
daß sein Bericht tatsächlich eine Weiter-
bildung des Berichts im Eliasbrief ist,
nicht in bent Sinn, wie die Gegner wollen,
legendarisch, sondern wofür Elias in der
Eile und im Staunen über die ganz und
gar neue Erscheinung das rechte Wort
noch nicht finden konnte, Thomas beschreibt
es in ruhiger, abgeklärter Weise, nachdem
er selbst das Wunder hinreichend gesehen
und mit andern darüber ausführlich ge-
sprochen hatte. DaS dürfte der richtige
Zusammenhang zwischen dem Eliasbrief
und Thomas 1 sein.
Gehen wir über zu Thomas ll, Aus-
gabe von Amoui, Rom 1880, über welche
Vita bereits oben das Nötige voransge-
schickt worden ist. Sie setzt das Vor-
handensein der Stigmata voraus, bringt
aber einzelne Angaben über dieselben, die
wir wenigstens kurz erwähnen müssen. Bei
dem innigen Verkehr des Heiligen mit dein
Gekreuzigten sei die Stigmatisation selbst-
verständlich gewesen. »Quid mirum,«
heißt es p. 3 Nr. 52, »si Franciscus
crucifixus apparuit, cui tantum cum
cruce fuit?« sWas Wunder, wenn Franz
gekreuzigt erschien, der soviel mit dem
Kreuz verkehrte?) Vergl. hiezu p. I. c. 6.
und Vita trittrn sociorum c. 5., auch
»Speculum perfectionis« ed. Sabatier