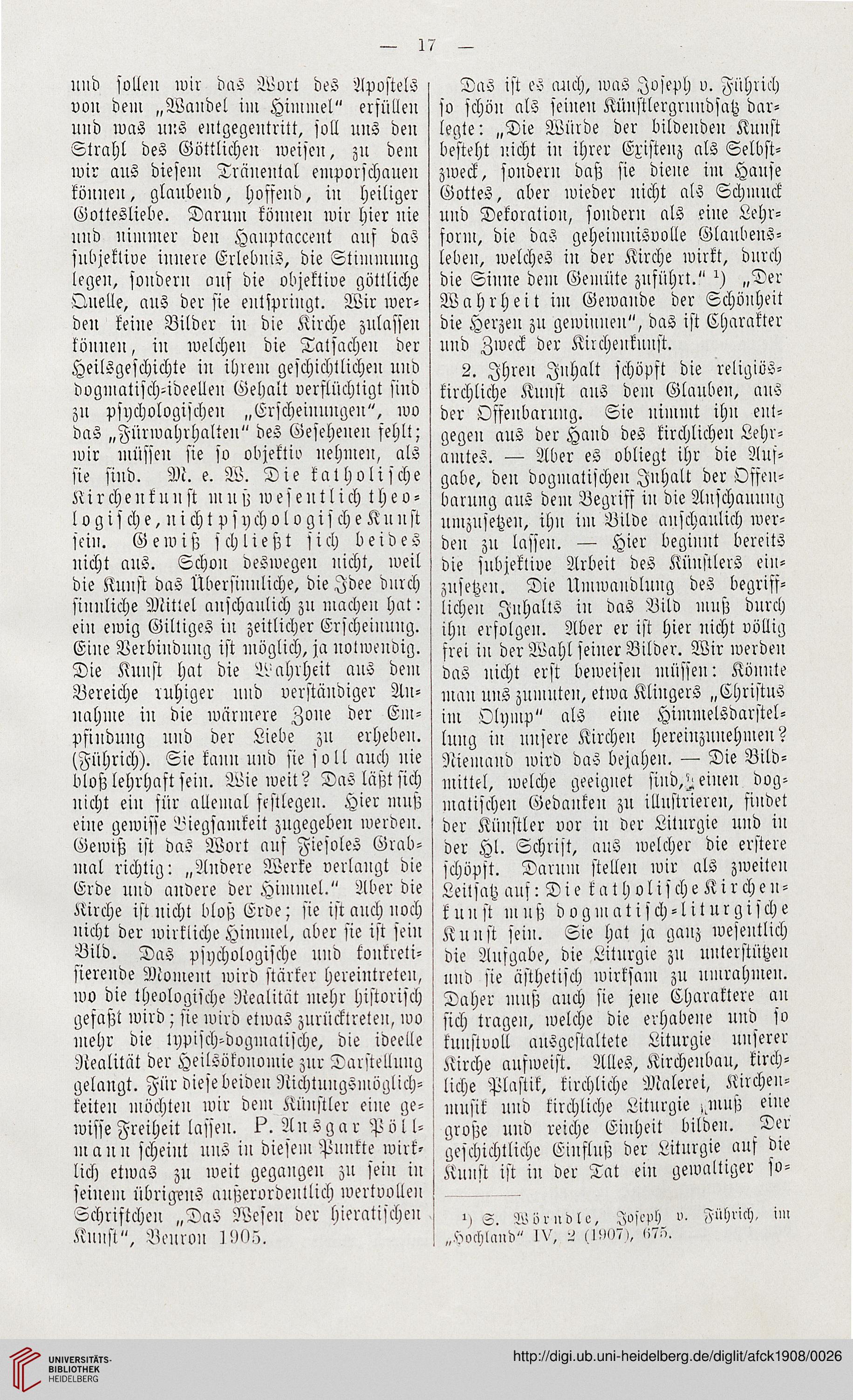17
und sollen wir das Wort deS Apostels
von dem „Wandel im Himmel" erfüllen
und was uns entgegentritt, soll uns den
Strahl des Göttlichen weisen, zu bent
wir aus diesem Tränental emporschauen
können, glaubend, hoffend, in heiliger
Gottesliebe. Darum können wir hier nie
und nimmer den Hauptaccent auf das
subjektive innere Erlebnis, die Stimmung
legen, sondern ans die objektive göttliche
Quelle, aus der sie entspringt. Wir wer-
den keine Bilder in die Kirche zulassen
können, in welchen die Tatsachen der
Heilsgeschichte in ihrem geschichtlichen und
dogmatisch-ideellen Gehalt verflüchtigt sind
zu psychologischen „Erscheinungen", wo
das „Fürwahrhalten" des Gesehenen fehlt;
rvir müssen sie so objektiv nehmen, als
sie sind. M. e. W. Die katholische
Kirchenkunst must wesentlich theo-
log i s ch e, n i ch t p s y ch o l o g i s ch e K u n st
sein. Gewiß schließt sich beides
nicht aus. Schon deswegen nicht, weil
die Kunst das Übersinnliche, die Idee durch
sinnliche Mittel anschaulich zu machen hat:
ein ewig Giltiges in zeitlicher Erscheinung.
Eine Verbindung ist möglich, ja notwendig.
Die Kunst hat die Wahrheit aus dem
Bereiche ruhiger und verständiger An-
riahine in die wärmere Zone der Em-
pfindung und der Liebe zu erheben.
sFührich). Sie kann und sie soll auch nie
bloß lehrhaft sein. Wie weit? Das läßt sich
nicht ein für allemal festlegen. Hier muß
eine gewisse Biegsamkeit zugegeben werden.
Gewiß ist das Wort auf Fiesoles Grab-
mal richtig: „Andere Werke verlangt die
Erde ilnd andere der Himmel." Aber die
Kirche ist nicht bloß Erde; sie ist auch noch
nicht der wirkliche Himmel, aber sie ist sein
Bild. Das psychologische und konkreti-
sierende Moment wird stärker hereintreten,
wo die theologische Realität mehr historisch
gefaßt wird; sie wird etwas zurücktreten, wo
mehr die typisch-dogmatische, die ideelle
Realität der Heilsökonomie zur Darstellung
gelangt. Für diese beiden Richtnngsmöglich-
keiten möchten wir dem Künstler eine ge-
wisse Freiheit lassen, ü. An s g a r P ö l l-
maun scheint uns in diesem Punkte wirk-
lich etwas zu weit gegangen zu sein in
feinem übrigens außerordentlich wertvollen
Schriftchen „Das Wesen der hieratischen
Kunst", Venron 1905.
Das ist es auch, was Joseph v. Führich
so schön als seinen Küustlergrnudsatz dar-
legte: „Die Würde der bildenden Kunst
besteht nicht in ihrer Existenz als Selbst-
zweck, sondern daß sie diene im Hause
Gottes, aber wieder nicht als Schmuck
und Dekoration, sondern als eine Lehr-
form, die das geheimnisvolle Glaubens-
leben, welches in der Kirche wirkt, durch
die Sinne dem Geinüte zuführt." Z „Der
Wahrheit im Gewände der Schönheit
die Herzen zu gewinnen", das ist Charakter
und Zweck der Kirchenkunst.
2. Ihren Inhalt schöpft die religiös-
kirchliche Kunst aus dem Glauben, aus
der Offenbarung. Sie nimmt ihn ent-
gegen aus der Hand des kirchlichen Lehr-
amtes. — Aber es obliegt ihr die Auf-
gabe, den dogmatischen Inhalt der Offen-
barung aus dem Begriff in die Anschauung
umznsetzen, ihn im Bilde anschaulich wer-
den zu lassen. — Hier beginnt bereits
die subjektive Arbeit des Künstlers ein-
zusetzen. Die Umwandlung des begriff-
lichen Inhalts in das Bild muß durch
ihn erfolgen. Aber er ist hier nicht völlig
frei in der Wahl seiner Bilder. Wir werden
das nicht erst beweisen müssen: Könnte
man uns zumute», etwa Klingers „Christus
im Olymp" als eine Himmelsdarstel-
lung in unsere Kirchen hereinzunehmen?
Niemand wird das bejahen. — Die Bild-
mittel, welche geeignet sind,seinen dog-
matischen Gedanken zu illustrieren, findet
der Künstler vor in der Liturgie und in
der HI. Schrift, ans welcher die erstere
schöpft. Darum stellen wir als zweiten
Leitsatz auf: D i e k a t h o l i s ch e K i r ch e n -
kunst muß dogmatisch-liturgische
Kunst sein. Sie hat ja ganz wesentlich
die Aufgabe, die Liturgie zu unterstützen
und sie ästhetisch wirksam zu umrahmen.
Daher muß auch sie jene Charaktere an
sich tragen, welche die erhabene und so
kunstvoll ausgcstaltete Liturgie unserer
Kirche answeist. Alles, Kirchenbau, kirch-
liche Plastik, kirchliche Malerei, Kirchen-
musik und kirchliche Liturgie ..muß eine
große und reiche Einheit bilden. Der
geschichtliche Einfluß der Liturgie ans die
Kunst ist in der Tat ein gewaltiger so-
l) S. Söörnble, Josephs v. Führich, im
„Hochland" IV, ■> (1907), 075.
und sollen wir das Wort deS Apostels
von dem „Wandel im Himmel" erfüllen
und was uns entgegentritt, soll uns den
Strahl des Göttlichen weisen, zu bent
wir aus diesem Tränental emporschauen
können, glaubend, hoffend, in heiliger
Gottesliebe. Darum können wir hier nie
und nimmer den Hauptaccent auf das
subjektive innere Erlebnis, die Stimmung
legen, sondern ans die objektive göttliche
Quelle, aus der sie entspringt. Wir wer-
den keine Bilder in die Kirche zulassen
können, in welchen die Tatsachen der
Heilsgeschichte in ihrem geschichtlichen und
dogmatisch-ideellen Gehalt verflüchtigt sind
zu psychologischen „Erscheinungen", wo
das „Fürwahrhalten" des Gesehenen fehlt;
rvir müssen sie so objektiv nehmen, als
sie sind. M. e. W. Die katholische
Kirchenkunst must wesentlich theo-
log i s ch e, n i ch t p s y ch o l o g i s ch e K u n st
sein. Gewiß schließt sich beides
nicht aus. Schon deswegen nicht, weil
die Kunst das Übersinnliche, die Idee durch
sinnliche Mittel anschaulich zu machen hat:
ein ewig Giltiges in zeitlicher Erscheinung.
Eine Verbindung ist möglich, ja notwendig.
Die Kunst hat die Wahrheit aus dem
Bereiche ruhiger und verständiger An-
riahine in die wärmere Zone der Em-
pfindung und der Liebe zu erheben.
sFührich). Sie kann und sie soll auch nie
bloß lehrhaft sein. Wie weit? Das läßt sich
nicht ein für allemal festlegen. Hier muß
eine gewisse Biegsamkeit zugegeben werden.
Gewiß ist das Wort auf Fiesoles Grab-
mal richtig: „Andere Werke verlangt die
Erde ilnd andere der Himmel." Aber die
Kirche ist nicht bloß Erde; sie ist auch noch
nicht der wirkliche Himmel, aber sie ist sein
Bild. Das psychologische und konkreti-
sierende Moment wird stärker hereintreten,
wo die theologische Realität mehr historisch
gefaßt wird; sie wird etwas zurücktreten, wo
mehr die typisch-dogmatische, die ideelle
Realität der Heilsökonomie zur Darstellung
gelangt. Für diese beiden Richtnngsmöglich-
keiten möchten wir dem Künstler eine ge-
wisse Freiheit lassen, ü. An s g a r P ö l l-
maun scheint uns in diesem Punkte wirk-
lich etwas zu weit gegangen zu sein in
feinem übrigens außerordentlich wertvollen
Schriftchen „Das Wesen der hieratischen
Kunst", Venron 1905.
Das ist es auch, was Joseph v. Führich
so schön als seinen Küustlergrnudsatz dar-
legte: „Die Würde der bildenden Kunst
besteht nicht in ihrer Existenz als Selbst-
zweck, sondern daß sie diene im Hause
Gottes, aber wieder nicht als Schmuck
und Dekoration, sondern als eine Lehr-
form, die das geheimnisvolle Glaubens-
leben, welches in der Kirche wirkt, durch
die Sinne dem Geinüte zuführt." Z „Der
Wahrheit im Gewände der Schönheit
die Herzen zu gewinnen", das ist Charakter
und Zweck der Kirchenkunst.
2. Ihren Inhalt schöpft die religiös-
kirchliche Kunst aus dem Glauben, aus
der Offenbarung. Sie nimmt ihn ent-
gegen aus der Hand des kirchlichen Lehr-
amtes. — Aber es obliegt ihr die Auf-
gabe, den dogmatischen Inhalt der Offen-
barung aus dem Begriff in die Anschauung
umznsetzen, ihn im Bilde anschaulich wer-
den zu lassen. — Hier beginnt bereits
die subjektive Arbeit des Künstlers ein-
zusetzen. Die Umwandlung des begriff-
lichen Inhalts in das Bild muß durch
ihn erfolgen. Aber er ist hier nicht völlig
frei in der Wahl seiner Bilder. Wir werden
das nicht erst beweisen müssen: Könnte
man uns zumute», etwa Klingers „Christus
im Olymp" als eine Himmelsdarstel-
lung in unsere Kirchen hereinzunehmen?
Niemand wird das bejahen. — Die Bild-
mittel, welche geeignet sind,seinen dog-
matischen Gedanken zu illustrieren, findet
der Künstler vor in der Liturgie und in
der HI. Schrift, ans welcher die erstere
schöpft. Darum stellen wir als zweiten
Leitsatz auf: D i e k a t h o l i s ch e K i r ch e n -
kunst muß dogmatisch-liturgische
Kunst sein. Sie hat ja ganz wesentlich
die Aufgabe, die Liturgie zu unterstützen
und sie ästhetisch wirksam zu umrahmen.
Daher muß auch sie jene Charaktere an
sich tragen, welche die erhabene und so
kunstvoll ausgcstaltete Liturgie unserer
Kirche answeist. Alles, Kirchenbau, kirch-
liche Plastik, kirchliche Malerei, Kirchen-
musik und kirchliche Liturgie ..muß eine
große und reiche Einheit bilden. Der
geschichtliche Einfluß der Liturgie ans die
Kunst ist in der Tat ein gewaltiger so-
l) S. Söörnble, Josephs v. Führich, im
„Hochland" IV, ■> (1907), 075.