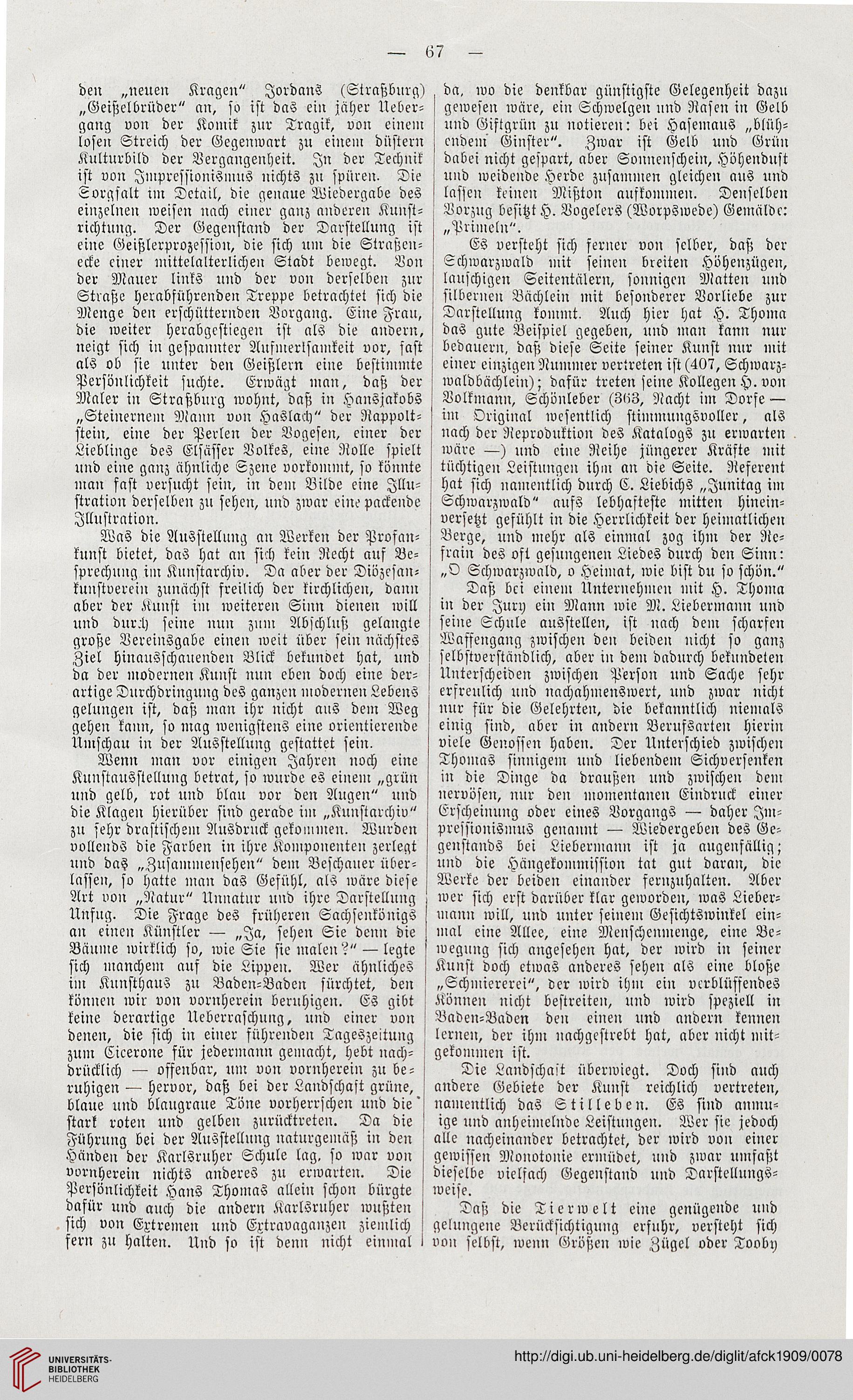67
den „neuen Kragen" Jordans (Straßburg)
„Geißelbrüder" an, so ist das ein jäher Neber-
gang von der Komik zur Tragik, von einem
losen Streich der Gegenwart zu einem düstern
Kulturbild der Vergangenheit. In der Technik
ist von Impressionismus nichts zu spüren. Die
Sorgfalt im Detail, die genaue Wiedergabe des
einzelnen weisen nach einer ganz anderen Kunst-
richtung. Der Gegenstand der Darstellung ist
eine Geißlerprozessiou, die sich um die Straßen-
ecke einer mittelalterlichen Stadt bewegt. Von
der Mauer links und der von derselben zur
Straße herabführenden Treppe betrachtet sich die
Menge beit erschütternden Vorgang. Eine Frau,
die weiter herabgestiegen ist als die andern,
neigt sich in gespannter Aufmerlsamkeit vor, säst
als ob sie unter den Geißlern eine bestimmte
Persönlichkeit suchte. Erwägt man, daß der
Maler in Straßburg wohnt, daß in Hansjakobs
„Steinerneni Mann von Haslach" der Rappolt-
stein. eine der Perlen der Vogesen, einer der
Lieblinge des Elsässer Volkes, eine Rolle spielt
und eine ganz ähnliche Szene vorkommt, so könnte
man fast versucht sein, in dem Bilde eine Illu-
stration derselben zu sehen, und zwar eine packende
Illustration.
Was die Ausstellung an Werken der Profan-
kunst bietet, daS hat an sich kein Recht auf Be-
sprechung im Kunstarchiv. Da aber der Diözesan-
kunstverein zunächst freilich der kirchlichen, dann
aber der Kunst im weiteren Sinn dienen will
und durch seine nun zum Abschluß gelangte
große Vereinsgabe einen weit über sein nächstes
Ziel hinausschauenden Blick bekundet hat, und
da der modernen Kunst nun eben doch eine der- ■
artige Durchdringung des ganzen modernen Lebens
gelungen ist, daß man ihr nicht ans dem Weg
gehen kann, so mag wenigstens eine orientierende
Umschau in der Ausstellung gestattet sein.
Wenn man vor einigen Jahren noch eine
Kunstausstellung betrat, so wurde es einem „grün
und gelb, rot und blau vor den Augen" und
die Klagen hierüber sind gerade im „Kunstarchiv"
zu sehr drastischem Ausdruck gekommen. Wurden
vollends die Farben in ihre Komponenten zerlegt
und das „Zusammensehen" dem Beschauer über-
lasse», so hatte man das Gefühl, als wäre diese
Art von „Natur" Unnatur und ihre Darstellung
Unfug. Die Frage des früheren Sachsenkönigs
an einen Künstler — „Ja, sehen Sie denn die
Bäume wirklich so, wie Sie sie malen?" — legte
sich manchem auf die Lippen. Wer ähnliches
im Kunsthaus zu Baden-Baden fürchtet, den
können wir von vornherein beruhigen. Es gibt
keine derartige Ueberraschung, und einer von
denen, die sich in einer führenden Tageszeitung
zum Cicerone für jedermann gemacht, hebt nach-
drücklich — offenbar, um von vornherein zu be-
ruhigen — hervor, daß bei der Landschaft grüne,
blaue und blaugraue Töne vorherrschen und die'
stark roten und gelben zurücktreten. Da die
Führung bei der Ausstellung naturgemäß in den
Händen der Karlsruher Schule lag, so war von
vornherein nichts anderes zu erwarten. Die
Persönlichkeit Hans Thomas allein schon bürgte
dafür und auch die andern Karlsruher wußten
sich von Extremen und Extravaganzen ziemlich
fern zu halten. Und so ist denn nicht einmal
da. wo die denkbar günstigste Gelegenheit dazu
gewesen wäre, ein Schwelgen und Rase» in Gelb
und Giftgrün zu notieren: bei Hasemaus „blüh-
endem' Ginster". Zwar ist Gelb und Grün
dabei nicht gespart, aber Sonnenschein, Höhendust
und weidende Herde zusammen gleichen aus und
lassen keinen Mißton aufkommen. Denselben
Vorzug besitzt H. Vogelers (Worpswede) Gemälde:
„Primeln".
Es versteht sich ferner von selber, daß der
Schwarzwald mit seinen breiten Höhenzügen,
lauschigen Seitentälern, sonnigen Matten und
silbernen Bächlein mit besonderer Vorliebe zur
Darstellung kommt. Auch hier hat H. Thoma
das gute Beispiel gegeben, und man kann nur
bedauern, daß diese Seite seiner Kunst nur mit
einer einzigen Nummer vertreten ist (407, Schwarz-
waldbächlein); dafür treten seine Kollegen H. von
Volkmann, Schönleber (363, Nacht im Dorfe —
im Original wesentlich stimmungsvoller, als
nach der Reproduktion des Katalogs zu erwarten
wäre —) und eine Reihe jüngerer Kräfte mit
tüchtigen Leistungen ihm an die Seite. Referent
hat sich namentlich durch C. Liebichs „Junitag im
Schwarzwald" aufs lebhafteste mitten hinein-
versetzt gefühlt in die Herrlichkeit der heimatliche»
Berge, und mehr als einmal zog ihm der Re-
frain des oft gesungenen Liedes durch den Sinn:
„O Schwarzwald, o Heimat, wie bist du so schön."
Daß bei einem Unternehmen mit H. Thoma
in der Jury ein Mann wie M. Liebermann und
seine Schule ausstellen, ist nach dem scharfen
Waffengang zwischen den beiden nicht so ganz
selbstverständlich, aber ui dem dadurch bekundeten
Unterscheiden zwischen Person und Sache sehr
erfreulich und nachahmenswert, und zwar nicht
nur für die Gelehrten, die bekanntlich niemals
einig sind, aber in andern Berufsarten hierin
viele Genossen haben. Der Unterschied zwischen
Thomas sinnigem und liebendem Sichversenken
in die Dinge da draußen und zwischen dem
nervösen, nur den momentanen Eindruck einer
Erscheinung oder eines Vorgangs — daher Im-
pressionismus genannt — Wiedergeben des Ge-
genstands bei Liebermann ist ja augenfällig;
und die Hängekommission tat gut daran, die
Werke der beiden einander sernzuhalten. Aber
wer sich erst darüber klar geworden, was Lieber-
mann will, und unter seinem Gesichtswinkel ein-
mal eine Allee, eine Menschenmenge, eine Be-
wegung sich angesehen hat, der wird in seiner
Kunst doch etwas anderes sehen als eine bloße
„Schmiererei", der wird ihm ein verblüffendes
Können nicht bestreiten, und wird speziell in
Baden-Baden den einen und andern kennen
lernen, der ihm nachgestrebt hat, aber nicht mit-
gekommen ist.
Die Landschaft überwiegt. Doch sind auch
andere Gebiete der Kunst reichlich vertreten,
namentlich das Stil leben. Es sind anmu-
ige und anheimelnde Leistungen. Wer sie jedoch
alle nacheinander betrachtet, der wird von einer
gewissen Monotonie ermüdet, und zwar umfaßt
dieselbe vielfach Gegenstand und Darstellungs-
weise.
Daß die Tierwelt eine genügende und
gelungene Berücksichtigung erfuhr, versteht sich
van selbst, wenn Größen wie Zügel oder Tooby
den „neuen Kragen" Jordans (Straßburg)
„Geißelbrüder" an, so ist das ein jäher Neber-
gang von der Komik zur Tragik, von einem
losen Streich der Gegenwart zu einem düstern
Kulturbild der Vergangenheit. In der Technik
ist von Impressionismus nichts zu spüren. Die
Sorgfalt im Detail, die genaue Wiedergabe des
einzelnen weisen nach einer ganz anderen Kunst-
richtung. Der Gegenstand der Darstellung ist
eine Geißlerprozessiou, die sich um die Straßen-
ecke einer mittelalterlichen Stadt bewegt. Von
der Mauer links und der von derselben zur
Straße herabführenden Treppe betrachtet sich die
Menge beit erschütternden Vorgang. Eine Frau,
die weiter herabgestiegen ist als die andern,
neigt sich in gespannter Aufmerlsamkeit vor, säst
als ob sie unter den Geißlern eine bestimmte
Persönlichkeit suchte. Erwägt man, daß der
Maler in Straßburg wohnt, daß in Hansjakobs
„Steinerneni Mann von Haslach" der Rappolt-
stein. eine der Perlen der Vogesen, einer der
Lieblinge des Elsässer Volkes, eine Rolle spielt
und eine ganz ähnliche Szene vorkommt, so könnte
man fast versucht sein, in dem Bilde eine Illu-
stration derselben zu sehen, und zwar eine packende
Illustration.
Was die Ausstellung an Werken der Profan-
kunst bietet, daS hat an sich kein Recht auf Be-
sprechung im Kunstarchiv. Da aber der Diözesan-
kunstverein zunächst freilich der kirchlichen, dann
aber der Kunst im weiteren Sinn dienen will
und durch seine nun zum Abschluß gelangte
große Vereinsgabe einen weit über sein nächstes
Ziel hinausschauenden Blick bekundet hat, und
da der modernen Kunst nun eben doch eine der- ■
artige Durchdringung des ganzen modernen Lebens
gelungen ist, daß man ihr nicht ans dem Weg
gehen kann, so mag wenigstens eine orientierende
Umschau in der Ausstellung gestattet sein.
Wenn man vor einigen Jahren noch eine
Kunstausstellung betrat, so wurde es einem „grün
und gelb, rot und blau vor den Augen" und
die Klagen hierüber sind gerade im „Kunstarchiv"
zu sehr drastischem Ausdruck gekommen. Wurden
vollends die Farben in ihre Komponenten zerlegt
und das „Zusammensehen" dem Beschauer über-
lasse», so hatte man das Gefühl, als wäre diese
Art von „Natur" Unnatur und ihre Darstellung
Unfug. Die Frage des früheren Sachsenkönigs
an einen Künstler — „Ja, sehen Sie denn die
Bäume wirklich so, wie Sie sie malen?" — legte
sich manchem auf die Lippen. Wer ähnliches
im Kunsthaus zu Baden-Baden fürchtet, den
können wir von vornherein beruhigen. Es gibt
keine derartige Ueberraschung, und einer von
denen, die sich in einer führenden Tageszeitung
zum Cicerone für jedermann gemacht, hebt nach-
drücklich — offenbar, um von vornherein zu be-
ruhigen — hervor, daß bei der Landschaft grüne,
blaue und blaugraue Töne vorherrschen und die'
stark roten und gelben zurücktreten. Da die
Führung bei der Ausstellung naturgemäß in den
Händen der Karlsruher Schule lag, so war von
vornherein nichts anderes zu erwarten. Die
Persönlichkeit Hans Thomas allein schon bürgte
dafür und auch die andern Karlsruher wußten
sich von Extremen und Extravaganzen ziemlich
fern zu halten. Und so ist denn nicht einmal
da. wo die denkbar günstigste Gelegenheit dazu
gewesen wäre, ein Schwelgen und Rase» in Gelb
und Giftgrün zu notieren: bei Hasemaus „blüh-
endem' Ginster". Zwar ist Gelb und Grün
dabei nicht gespart, aber Sonnenschein, Höhendust
und weidende Herde zusammen gleichen aus und
lassen keinen Mißton aufkommen. Denselben
Vorzug besitzt H. Vogelers (Worpswede) Gemälde:
„Primeln".
Es versteht sich ferner von selber, daß der
Schwarzwald mit seinen breiten Höhenzügen,
lauschigen Seitentälern, sonnigen Matten und
silbernen Bächlein mit besonderer Vorliebe zur
Darstellung kommt. Auch hier hat H. Thoma
das gute Beispiel gegeben, und man kann nur
bedauern, daß diese Seite seiner Kunst nur mit
einer einzigen Nummer vertreten ist (407, Schwarz-
waldbächlein); dafür treten seine Kollegen H. von
Volkmann, Schönleber (363, Nacht im Dorfe —
im Original wesentlich stimmungsvoller, als
nach der Reproduktion des Katalogs zu erwarten
wäre —) und eine Reihe jüngerer Kräfte mit
tüchtigen Leistungen ihm an die Seite. Referent
hat sich namentlich durch C. Liebichs „Junitag im
Schwarzwald" aufs lebhafteste mitten hinein-
versetzt gefühlt in die Herrlichkeit der heimatliche»
Berge, und mehr als einmal zog ihm der Re-
frain des oft gesungenen Liedes durch den Sinn:
„O Schwarzwald, o Heimat, wie bist du so schön."
Daß bei einem Unternehmen mit H. Thoma
in der Jury ein Mann wie M. Liebermann und
seine Schule ausstellen, ist nach dem scharfen
Waffengang zwischen den beiden nicht so ganz
selbstverständlich, aber ui dem dadurch bekundeten
Unterscheiden zwischen Person und Sache sehr
erfreulich und nachahmenswert, und zwar nicht
nur für die Gelehrten, die bekanntlich niemals
einig sind, aber in andern Berufsarten hierin
viele Genossen haben. Der Unterschied zwischen
Thomas sinnigem und liebendem Sichversenken
in die Dinge da draußen und zwischen dem
nervösen, nur den momentanen Eindruck einer
Erscheinung oder eines Vorgangs — daher Im-
pressionismus genannt — Wiedergeben des Ge-
genstands bei Liebermann ist ja augenfällig;
und die Hängekommission tat gut daran, die
Werke der beiden einander sernzuhalten. Aber
wer sich erst darüber klar geworden, was Lieber-
mann will, und unter seinem Gesichtswinkel ein-
mal eine Allee, eine Menschenmenge, eine Be-
wegung sich angesehen hat, der wird in seiner
Kunst doch etwas anderes sehen als eine bloße
„Schmiererei", der wird ihm ein verblüffendes
Können nicht bestreiten, und wird speziell in
Baden-Baden den einen und andern kennen
lernen, der ihm nachgestrebt hat, aber nicht mit-
gekommen ist.
Die Landschaft überwiegt. Doch sind auch
andere Gebiete der Kunst reichlich vertreten,
namentlich das Stil leben. Es sind anmu-
ige und anheimelnde Leistungen. Wer sie jedoch
alle nacheinander betrachtet, der wird von einer
gewissen Monotonie ermüdet, und zwar umfaßt
dieselbe vielfach Gegenstand und Darstellungs-
weise.
Daß die Tierwelt eine genügende und
gelungene Berücksichtigung erfuhr, versteht sich
van selbst, wenn Größen wie Zügel oder Tooby