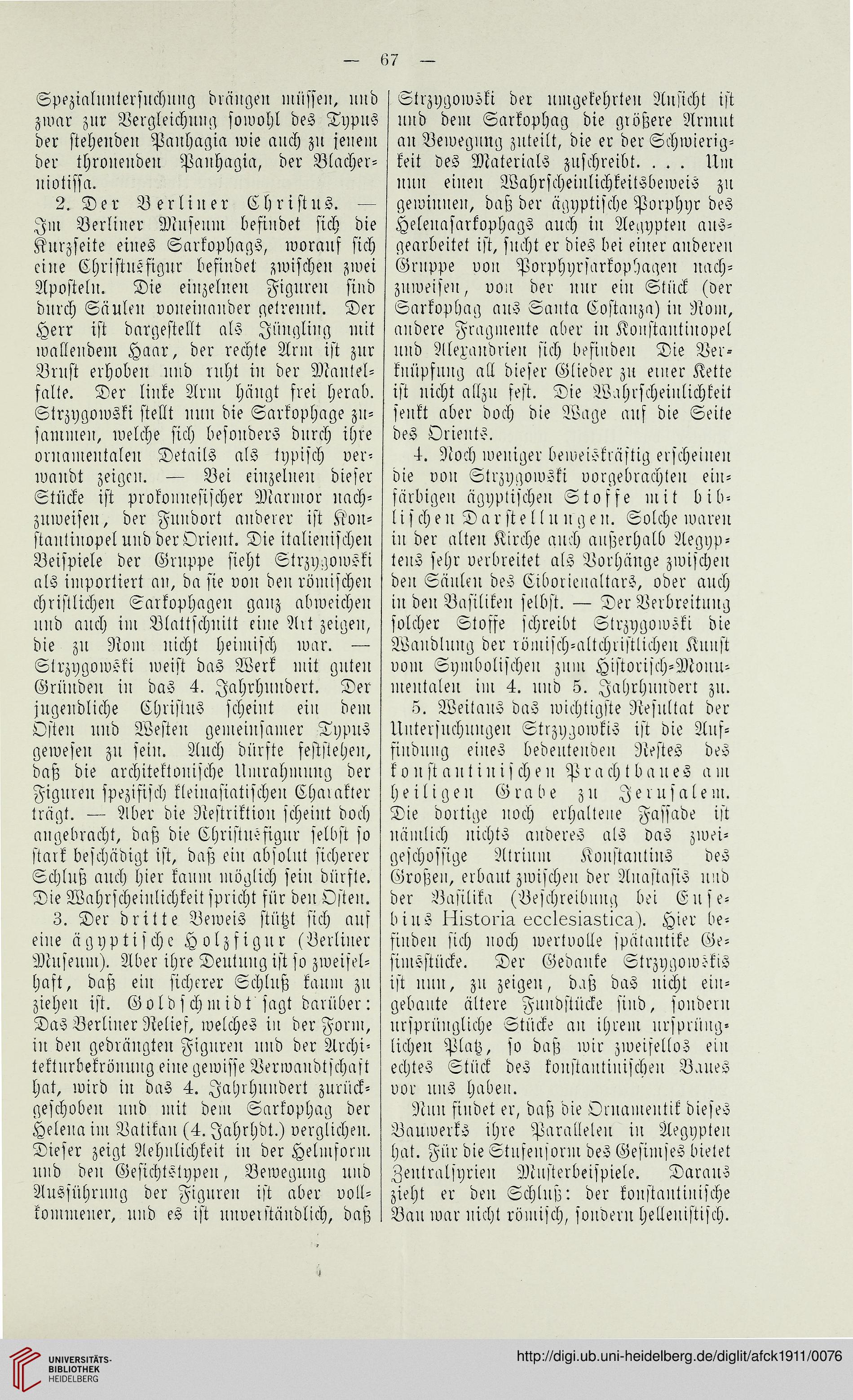67
Spezialuntersuchnng drängen müssen, nnd
zivar znr Vergleichung soivohl des Typus
der stehenden Panhagia wie anch zn jenem
der thronenden Panhagia, der Blacher-
niotissa.
2. Der Berliner Christus. —
Im Berliner Museum befindet sich die
Kurzseite eines Sarkophags, moranf sich
eine Christusfigur befindet zwischen zwei
Aposteln. Die einzelnen Figuren sind
durch Säulen voneinander getrennt. Der
Herr ist dargestellt als Jüngling mit
wallendem Haar, der rechte Arm ist zur
Brust erhoben nnd ruht in der Mantel-
falte. Der linke Arnl hängt frei herab.
Strzygowski stellt nun die Sarkophage zu-
sammen, tvelche sich besonders durch ihre
ornamentalen Details als typisch ver-
wandt zeigen. — Bei einzelnen dieser
Stücke ist prokonnesischer Marmor nnch-
zuweiseu, der Fundort anderer ist Kon-
stantinopel und der Orient. Die italienischen
Beispiele der Gruppe sieht Strzygowski
als importiert an, da sie von den römischen
christlichen Sarkophagen ganz abweichen
nnd auch im Blattschnitt eine Art zeigen,
die zn Nom nicht heimisch war. —
Strzygowski weist das Werk mit guten
Gründen in das 4. Jahrhundert. Der
jugendliche Christus scheint ein dem
Osten nnd Westen gemeinsamer Typus
gewesen zn sein. Auch dürfte feststehen,
daß die architektonische Umrahmung der
Figuren spezifisch kleinasiatischen Chaiakler
trägt. — Aber die Restriktion scheint doch
angebracht, daß die Christusfigur selbst so
stark beschädigt ist, daß ein absolut sicherer
Schluß auch hier kaum möglich sein dürfte.
Die Wahrscheinlichkeit spricht für den Osten.
3. Der dritte Beweis stützt sich auf
eine ägyptische Holzfigur (berliner
Museum). Aber ihre Deutung ist so zweifel-
haft, daß ein sicherer Schluß kauin 51t
ziehen ist. Goldschmidt sagt darüber:
Das Berliner Relief, welches in der Form,
in den gedrängten Figuren und der Archi-
tektnrbekrönung eine gewisse Verwandtschaft
hat, wird in das 4. Jahrhundert zurück-
geschoben und mit dem Sarkophag der
Helena im Vatikan (4. Jahrhdt.) verglichen.
Dieser zeigt Aehnlichkeit in der Helmform
nnd den Gesichtstypen, Bewegung uub
Ausführung der Figuren ist aber voll-
kommener, und es ist unverständlich, daß
Strzygoivski der ilmgekehrteu Ansicht ist
nnd dem Sarkophag die größere Armrrt
an Beivegnng znteilt, die er der Schwierig-
keit des Materials znschreibt. . . . Unr
nun einen Wahrscheinlichkeitsbeweis zir
gewirrnen, daß der ägyptische Porphyr des
Helenasarkophags auch in Aegypten ans-
gearbeitet ist, sucht er dies bei einer anderen
Gruppe von Porphyrsarkophageu nach-
znweisen, von der nur ein Stück (der
Sarkophag aus Santa Costanza) in Rom,
andere Fragmente aber in Konstantinopel
und Alexandrien sich befinden Die Ver-
knüpfung all dieser Glieder zn einer Kette
ist nicht nllzrr fest. Die Wahrscheinlichkeit
senkt aber doch die Wage ans die Seite
des Orients.
4. Roch weniger beiveiskräftig erscheinen
die von Strzygowski vorgebrachten ein-
färbigeu ägyptischen Stoffe mit b i b-
li schen Dar stellu n ge n. Solche waren
in der alten Kirche auch außerhalb Aegyp-
tens sehr verbreitet als Vorhänge zwischen
den Säulen des Ciborienaltars, oder auch
in den Basiliken selbst. — Der Verbreitung
solcher Stoffe schreibt Strzygoivski die
Wandlung der römisch-altchristlichen Kunst
vom Symbolischen zum Historisch-Monu-
mentalen im 4. und 5. Jahrhundert zu.
5. Weitaus das wichtigste Resultat der
Untersuchnugeu Strzygowkis ist die Auf-
findung eines bedeutenden Nestes des
k0 n st autin i s ch e n Prach t baues a m
heiligen Grabe § u Jerusalem.
Die dortige noch erhaltene Fassade ist
nämlich nichts anderes als das zwei-
geschossige Atrium Konstantins des
Großen, erbaut zwischen der Anastasis und
der Basilika (Beschreibung bei Eit se-
tz ins Historia ecclesiastica). Hier be-
finden sich twch wertvolle spätantike Ge-
simsstücke. Der Gedanke Strzygowskis
ist mm, zu zeigen, daß das nicht ein-
gebaute ältere Fundstücke sind, sondern
ursprüngliche Stücke an ihrem ursprüng-
lichen Platz, so daß wir ziveifellos ein
echtes Stück des konstantinischen Baues
vor uns haben.
Run findet er, daß die Ornamentik dieses
Bauwerks ihre Parallelen in Aegypten
hat. Für die Stnfensornr des Gesimses bietet
Zentralsyrien Mitsterbeispiele. Daraus
zieht er den Schluß: der konstantinische
Ban war nicht römisch, sondern hellenistisch.
Spezialuntersuchnng drängen müssen, nnd
zivar znr Vergleichung soivohl des Typus
der stehenden Panhagia wie anch zn jenem
der thronenden Panhagia, der Blacher-
niotissa.
2. Der Berliner Christus. —
Im Berliner Museum befindet sich die
Kurzseite eines Sarkophags, moranf sich
eine Christusfigur befindet zwischen zwei
Aposteln. Die einzelnen Figuren sind
durch Säulen voneinander getrennt. Der
Herr ist dargestellt als Jüngling mit
wallendem Haar, der rechte Arm ist zur
Brust erhoben nnd ruht in der Mantel-
falte. Der linke Arnl hängt frei herab.
Strzygowski stellt nun die Sarkophage zu-
sammen, tvelche sich besonders durch ihre
ornamentalen Details als typisch ver-
wandt zeigen. — Bei einzelnen dieser
Stücke ist prokonnesischer Marmor nnch-
zuweiseu, der Fundort anderer ist Kon-
stantinopel und der Orient. Die italienischen
Beispiele der Gruppe sieht Strzygowski
als importiert an, da sie von den römischen
christlichen Sarkophagen ganz abweichen
nnd auch im Blattschnitt eine Art zeigen,
die zn Nom nicht heimisch war. —
Strzygowski weist das Werk mit guten
Gründen in das 4. Jahrhundert. Der
jugendliche Christus scheint ein dem
Osten nnd Westen gemeinsamer Typus
gewesen zn sein. Auch dürfte feststehen,
daß die architektonische Umrahmung der
Figuren spezifisch kleinasiatischen Chaiakler
trägt. — Aber die Restriktion scheint doch
angebracht, daß die Christusfigur selbst so
stark beschädigt ist, daß ein absolut sicherer
Schluß auch hier kaum möglich sein dürfte.
Die Wahrscheinlichkeit spricht für den Osten.
3. Der dritte Beweis stützt sich auf
eine ägyptische Holzfigur (berliner
Museum). Aber ihre Deutung ist so zweifel-
haft, daß ein sicherer Schluß kauin 51t
ziehen ist. Goldschmidt sagt darüber:
Das Berliner Relief, welches in der Form,
in den gedrängten Figuren und der Archi-
tektnrbekrönung eine gewisse Verwandtschaft
hat, wird in das 4. Jahrhundert zurück-
geschoben und mit dem Sarkophag der
Helena im Vatikan (4. Jahrhdt.) verglichen.
Dieser zeigt Aehnlichkeit in der Helmform
nnd den Gesichtstypen, Bewegung uub
Ausführung der Figuren ist aber voll-
kommener, und es ist unverständlich, daß
Strzygoivski der ilmgekehrteu Ansicht ist
nnd dem Sarkophag die größere Armrrt
an Beivegnng znteilt, die er der Schwierig-
keit des Materials znschreibt. . . . Unr
nun einen Wahrscheinlichkeitsbeweis zir
gewirrnen, daß der ägyptische Porphyr des
Helenasarkophags auch in Aegypten ans-
gearbeitet ist, sucht er dies bei einer anderen
Gruppe von Porphyrsarkophageu nach-
znweisen, von der nur ein Stück (der
Sarkophag aus Santa Costanza) in Rom,
andere Fragmente aber in Konstantinopel
und Alexandrien sich befinden Die Ver-
knüpfung all dieser Glieder zn einer Kette
ist nicht nllzrr fest. Die Wahrscheinlichkeit
senkt aber doch die Wage ans die Seite
des Orients.
4. Roch weniger beiveiskräftig erscheinen
die von Strzygowski vorgebrachten ein-
färbigeu ägyptischen Stoffe mit b i b-
li schen Dar stellu n ge n. Solche waren
in der alten Kirche auch außerhalb Aegyp-
tens sehr verbreitet als Vorhänge zwischen
den Säulen des Ciborienaltars, oder auch
in den Basiliken selbst. — Der Verbreitung
solcher Stoffe schreibt Strzygoivski die
Wandlung der römisch-altchristlichen Kunst
vom Symbolischen zum Historisch-Monu-
mentalen im 4. und 5. Jahrhundert zu.
5. Weitaus das wichtigste Resultat der
Untersuchnugeu Strzygowkis ist die Auf-
findung eines bedeutenden Nestes des
k0 n st autin i s ch e n Prach t baues a m
heiligen Grabe § u Jerusalem.
Die dortige noch erhaltene Fassade ist
nämlich nichts anderes als das zwei-
geschossige Atrium Konstantins des
Großen, erbaut zwischen der Anastasis und
der Basilika (Beschreibung bei Eit se-
tz ins Historia ecclesiastica). Hier be-
finden sich twch wertvolle spätantike Ge-
simsstücke. Der Gedanke Strzygowskis
ist mm, zu zeigen, daß das nicht ein-
gebaute ältere Fundstücke sind, sondern
ursprüngliche Stücke an ihrem ursprüng-
lichen Platz, so daß wir ziveifellos ein
echtes Stück des konstantinischen Baues
vor uns haben.
Run findet er, daß die Ornamentik dieses
Bauwerks ihre Parallelen in Aegypten
hat. Für die Stnfensornr des Gesimses bietet
Zentralsyrien Mitsterbeispiele. Daraus
zieht er den Schluß: der konstantinische
Ban war nicht römisch, sondern hellenistisch.