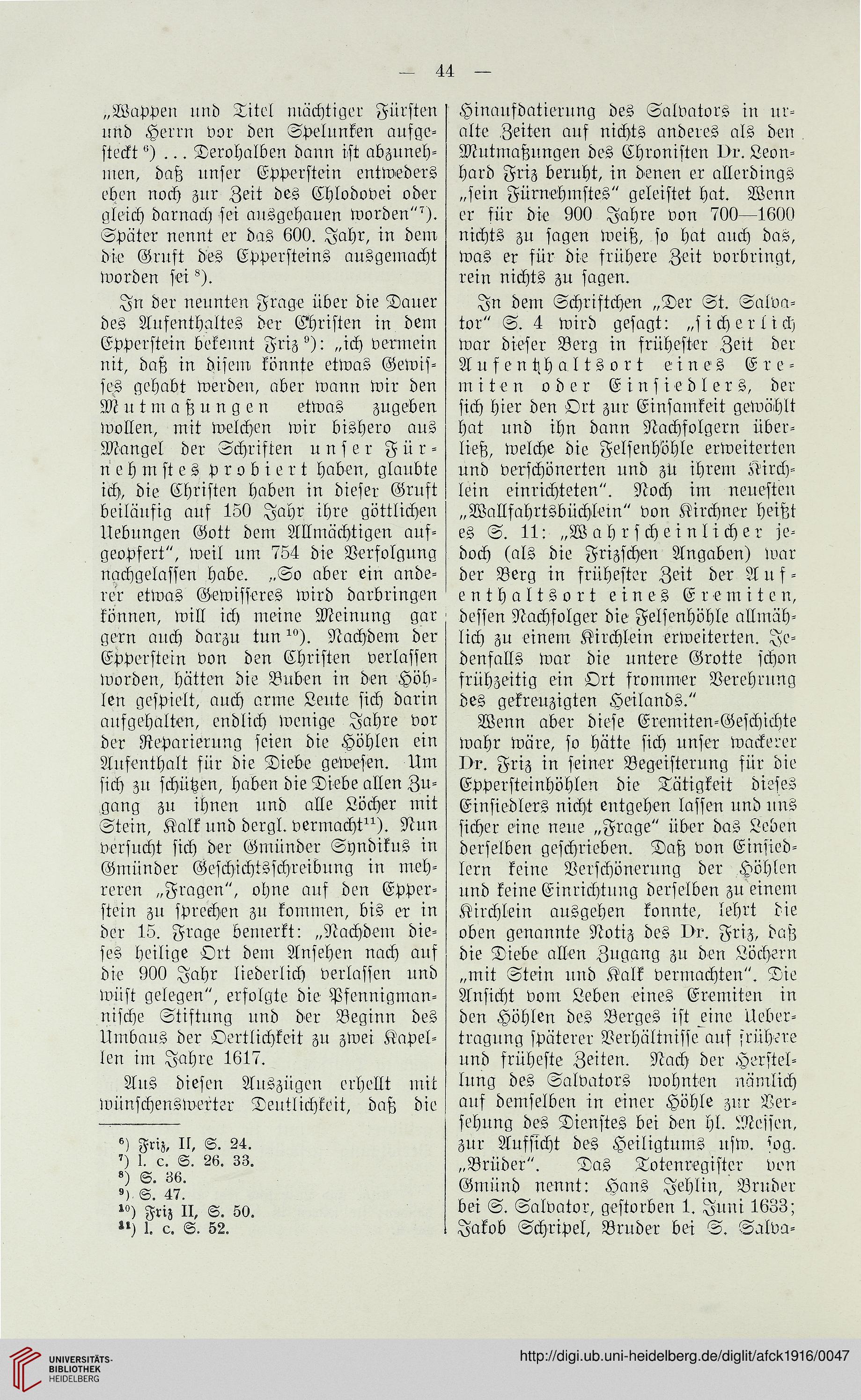44
„Wappen und Titel mächtiger Fürsten
und Herrn vor den Spelunken aufge-
steckt ch ... Derohalben dann ist abzuneh-
men, daß unser Epperstein entweders
eben noch zur Zeit des Chlodovei oder
gleich darnach sei ausgehauen worden"^).
Später nennt er das 600. Jahr, in dem
die Gruft des Eppersteins ausgemacht
worden sei * 7 8 9).
In der neunten Frage über die Dauer
des Aufenthaltes der Christen in dem
Epperstein bekennt Friz °): „ich vermein
uit, daß in disem könnte etwas Gewis-
ses gehabt werden, aber wann wir den
M u t in a ß u n g e n etwas zugeben
wollen, mit welchen wir bishero aus
Mangel der Schriften unser Für-
n e h m st e s probiert haben, glaubte
ich, die Christen haben in dieser Gruft
beiläufig aus 150 Jahr ihre göttlichen
Hebungen Gott dem Allmächtigen auf-
geopfert", weil um 764 die Verfolgung
nachgelassen habe. „So aber ein ande-
rer etwas Gewisseres wird darbringen
können, will ich meine Meinung gar
gern auch darzu tun10 11). Nachdem der
Epperstein von den Christen verlassen
worden, hätten die Buben in den Höh-
len gespielt, auch arme Leitte sich darin
aufgehalten, endlich wenige Jahre vor
der Reparierung seien die Höhlen ein
Aufenthalt für die Diebe gewesen. Um
sich zu schützen, haben die Diebe allen Zu-
gang zu ihnen und alle Löcher mit
Stein, Kalk und dergl. vermacht"). Nun
versucht sich der Gmünder Syndikus in
Gmünder Geschichtsschreibung in meh-
reren „Fragen", ohne auf den Epper-
stein zu sprechen zu kommen, bis er in
der 16. Frage bemerkt: „Nachdem die-
ses heilige Ort dem Ansehen nach aus
die 900 Jahr liederlich verlassen und
wüst gelegen", erfolgte die Pfennigman-
nische Stiftung und der Beginn des
Umbaus der Oertlichkeit zu zwei Kapel-
len im Jahre 1617.
Aus diesen Auszügen erhellt mit
wünschenswerter Deutlichkeit, daß die
e) Friz, II, S. 24.
7) 1. c. S. 26. 33.
8) S. 86.
9) S. 47.
10) Friz II, S. 50.
11) 1. c. S. 52.
Hinaufdatierung des Salvators in ur-
alte Zeiten aus nichts anderes als den
Mutmaßungen des Chronisten Dr. Leon-
hard Friz beruht, in denen er allerdings
„sein Fürnehmstes" geleistet hat. Wenn
er für die 900 Jahre von 700—1600
nichts zu sagen weiß, so hat auch das,
was er für die frühere Zeit vorbringt,
rein nichts zu sagen.
In dem Schriftchen „Der St. Salva-
tor" S. 4 wird gesagt: „s i ch e r l i ch
war dieser Berg in frühester Zeit der
Aufenh haltsort eines E r e -
m iten oder Einsiedlers, der
sich hier den Ort zur Einsamkeit gewählt
hat und ihn dann Nachfolgern über-
ließ, welche die Felsenhöhle erweiterten
und verschönerten und zu ihrem Kirch-
lein einrichteten". Noch im neuesten
„Wallsahrtsbüchlein" von Kirchner heißt
es S. 11: „W ahrscheinlicher je-
doch (als die Frizschen Angaben) war
der Berg in frühester Zeit der A u f -
enthaltsort eines Eremiten,
dessen Nachfolger die Felsenhöhle allinäh-
lich zu einem Kirchlein erweiterten. Je-
denfalls war die untere Grotte schon
frühzeitig ein Ort frommer Verehrung
des gekreuzigten Heilands."
Wenn aber diese Eremiten-Geschichte
wahr wäre, so hätte sich unser wackerer
Dr. Friz in seiner Begeisterung fiir die
Eppersteinhöhlen die Tätigkeit dieses
Einsiedlers nicht entgehen lassen und uns
sicher eine neue „Frage" über das Leben
derselben geschrieben. Daß von Einsied-
lern keine Verschönerung der Höhlen
und keine Einrichtung derselben zu einem
Kirchlein ausgehen konnte, lehrt die
oben genannte Notiz des Dr. Friz, daß
die Diebe allen Zugang zu den Löchern
„mit Stein und Kalk vermachten". Die
Ansicht vom Leben eines Eremiten in
den Höhlen des Berges ist pine Ueber-
tragung späterer Verhältnisse auf frühere
und früheste Zeiten. Nach der Herstel-
lung des Salvators wohnten nämlich
auf demselben in einer Höhle zur Ver-
sehung des Dienstes bei den hl. Messen,
zur Aufsicht des Heiligtums usw. sog.
„Brüder". Das Totenregister von
Gmünd nennt: Hans Jehlin, Bruder
bei S. Salvator, gestorben 1. Juni 1633;
Jakob Schripel, Bruder bei S. Salva-
„Wappen und Titel mächtiger Fürsten
und Herrn vor den Spelunken aufge-
steckt ch ... Derohalben dann ist abzuneh-
men, daß unser Epperstein entweders
eben noch zur Zeit des Chlodovei oder
gleich darnach sei ausgehauen worden"^).
Später nennt er das 600. Jahr, in dem
die Gruft des Eppersteins ausgemacht
worden sei * 7 8 9).
In der neunten Frage über die Dauer
des Aufenthaltes der Christen in dem
Epperstein bekennt Friz °): „ich vermein
uit, daß in disem könnte etwas Gewis-
ses gehabt werden, aber wann wir den
M u t in a ß u n g e n etwas zugeben
wollen, mit welchen wir bishero aus
Mangel der Schriften unser Für-
n e h m st e s probiert haben, glaubte
ich, die Christen haben in dieser Gruft
beiläufig aus 150 Jahr ihre göttlichen
Hebungen Gott dem Allmächtigen auf-
geopfert", weil um 764 die Verfolgung
nachgelassen habe. „So aber ein ande-
rer etwas Gewisseres wird darbringen
können, will ich meine Meinung gar
gern auch darzu tun10 11). Nachdem der
Epperstein von den Christen verlassen
worden, hätten die Buben in den Höh-
len gespielt, auch arme Leitte sich darin
aufgehalten, endlich wenige Jahre vor
der Reparierung seien die Höhlen ein
Aufenthalt für die Diebe gewesen. Um
sich zu schützen, haben die Diebe allen Zu-
gang zu ihnen und alle Löcher mit
Stein, Kalk und dergl. vermacht"). Nun
versucht sich der Gmünder Syndikus in
Gmünder Geschichtsschreibung in meh-
reren „Fragen", ohne auf den Epper-
stein zu sprechen zu kommen, bis er in
der 16. Frage bemerkt: „Nachdem die-
ses heilige Ort dem Ansehen nach aus
die 900 Jahr liederlich verlassen und
wüst gelegen", erfolgte die Pfennigman-
nische Stiftung und der Beginn des
Umbaus der Oertlichkeit zu zwei Kapel-
len im Jahre 1617.
Aus diesen Auszügen erhellt mit
wünschenswerter Deutlichkeit, daß die
e) Friz, II, S. 24.
7) 1. c. S. 26. 33.
8) S. 86.
9) S. 47.
10) Friz II, S. 50.
11) 1. c. S. 52.
Hinaufdatierung des Salvators in ur-
alte Zeiten aus nichts anderes als den
Mutmaßungen des Chronisten Dr. Leon-
hard Friz beruht, in denen er allerdings
„sein Fürnehmstes" geleistet hat. Wenn
er für die 900 Jahre von 700—1600
nichts zu sagen weiß, so hat auch das,
was er für die frühere Zeit vorbringt,
rein nichts zu sagen.
In dem Schriftchen „Der St. Salva-
tor" S. 4 wird gesagt: „s i ch e r l i ch
war dieser Berg in frühester Zeit der
Aufenh haltsort eines E r e -
m iten oder Einsiedlers, der
sich hier den Ort zur Einsamkeit gewählt
hat und ihn dann Nachfolgern über-
ließ, welche die Felsenhöhle erweiterten
und verschönerten und zu ihrem Kirch-
lein einrichteten". Noch im neuesten
„Wallsahrtsbüchlein" von Kirchner heißt
es S. 11: „W ahrscheinlicher je-
doch (als die Frizschen Angaben) war
der Berg in frühester Zeit der A u f -
enthaltsort eines Eremiten,
dessen Nachfolger die Felsenhöhle allinäh-
lich zu einem Kirchlein erweiterten. Je-
denfalls war die untere Grotte schon
frühzeitig ein Ort frommer Verehrung
des gekreuzigten Heilands."
Wenn aber diese Eremiten-Geschichte
wahr wäre, so hätte sich unser wackerer
Dr. Friz in seiner Begeisterung fiir die
Eppersteinhöhlen die Tätigkeit dieses
Einsiedlers nicht entgehen lassen und uns
sicher eine neue „Frage" über das Leben
derselben geschrieben. Daß von Einsied-
lern keine Verschönerung der Höhlen
und keine Einrichtung derselben zu einem
Kirchlein ausgehen konnte, lehrt die
oben genannte Notiz des Dr. Friz, daß
die Diebe allen Zugang zu den Löchern
„mit Stein und Kalk vermachten". Die
Ansicht vom Leben eines Eremiten in
den Höhlen des Berges ist pine Ueber-
tragung späterer Verhältnisse auf frühere
und früheste Zeiten. Nach der Herstel-
lung des Salvators wohnten nämlich
auf demselben in einer Höhle zur Ver-
sehung des Dienstes bei den hl. Messen,
zur Aufsicht des Heiligtums usw. sog.
„Brüder". Das Totenregister von
Gmünd nennt: Hans Jehlin, Bruder
bei S. Salvator, gestorben 1. Juni 1633;
Jakob Schripel, Bruder bei S. Salva-