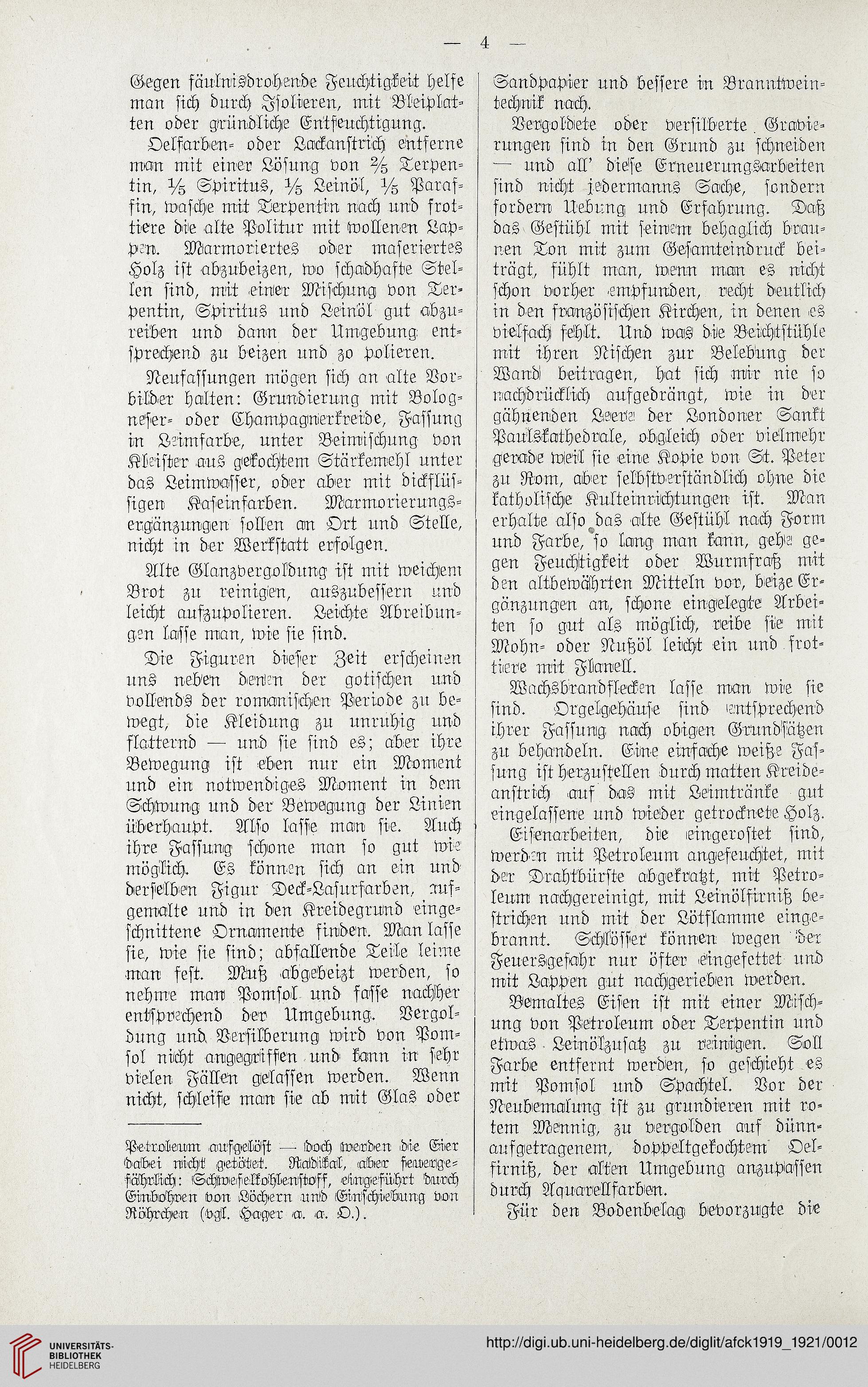4
Gegen sä ulnisd rohende Feuchtigkeit helfe
man sich durch Isolieren, mit Bleiplat-
ten oder gründliche Entseuchtigung.
Oelsarben- oder Lackanstrich entferne
man mit einer Lösung von % Terpen-
tin, % Spiritus, i/g Leinöl, sch Paraf-
fin, wasche mit Terpentin nach und frot-
tiere die alte Politur mit wollenen Lap-
pen. Marmoriertes oder maseriertes
Holz ist abzubeizen, wo schadhafte Stel-
len sind, mit einer Mischung von Ter-
pentin, Spiritus und Leinöl gut abzu-
reiben und dann der Umgebung ent-
sprechend zu beizen und zo polieren.
Neufassungen mögen sich an alte Vor-
bilder halten: Grundierung mit Bolog-
neser- oder Champagnerkreide, Fassung
in Leimfarbe, unter Beimischung von
Kleister aus gekochtem Stärkemehl unter
das Leimwasser, oder aber mit dickflüs-
sigen Kaseinfarben. Marmorierungs-
ergänzungen sollen an Ort und Stelle,
nicht in der Werkstatt erfolgen.
Alte Glanzvergoldung ist mit weichem
Brot zu reinigen, auszubessern und
leicht aufzupolieren. Leichte Abreibun-
gen lasse man, wie sie sind.
Die Figuren dieser Zeit erscheinen
uns neben denen der gotischen und
vollends der romanischen Periode zu be-
wegt, die Kleidung zu unruhig und
flatternd — und sie sind es; aber ihre
Bewegung ist eben nur ein Moment
und ein notwendiges Moment in dem
Schwung und der Bewegung der Linien
überhaupt. Also lasse man sie. Auch
ihre Fassung schone man so gut wie
möglich. Es können sich an ein und
derselben Figur Deck-Lasurfarben, auf-
gemalte und in den Kreidegrund einge-
schnittene Ornamente finden. Man lasse
sie, wie sie sind; abfallende Teile leime
man fest. Muß abgebeizt werden, so
nehme man Pomsol und fasse nachher
entsprechend der Umgebung. Vergol-
dung und Versilberung wird von Pom-
sol nicht angegriffen und kann in sehr
vielen Fällen gelassen werden. Wenn
nicht, schleife man sie ab mit Glas oder
Petroteaim.aiu'fgteiliöft — doch worden die Eier
dalxi nicht getötet. Raldiilal, ,aber seneirige-
fäihrl'.ch: Schwofelköhlenstoff, vMMsührt durch
Emböhven von Löchern und Elnschiebung von
Röhrchen (vgl. Hager a>. n. £),).
Sandpapier und bessere in Branntwein-
technik nach.
Vergoldete oder versilberte Gravie-
rungen sind in den Grund zu schneiden
und all' diese Erneuerungsarbeiten
sind nicht jedermanns Sache, sondern
fordern Uebung und Erfahrung. Daß
das Gestühl mit seinem behaglich brau-
nen Ton mit zum Gesamteindruck bei-
trägt, fühlt man, wenn man es nicht
schon vorher -empfunden, recht deutlich
in den französischen Kirchen, in denen -es
vielfach fehlt. Und was die Beichtstühle
mit ihren Nischen zur Belebung der
Wand beitragen, hat sich mir nie so
nachdrücklich aufgedrängt, wie m der
gähnenden Leere! der Londoner Sankt
Paulskathedrale, obgleich oder vielmehr
gerade weil sie eine Kopie von St. Peter
zu Rom, aber selbstverständlich ohne die
katholische Kulteinrichtungen ist. Man
erhalte also das alte Gestühl nach Form
und Farbe, so lang man kann, gehv ge-
gen Feuchtigkeit oder Wurmfraß mit
den altbewährten Mitteln vor, beize Er-
gänzungen an, schone eingelegte Arbei-
ten so gut als möglich, reibe sie mit
Mohn- oder Nußöl leicht ein und frot-
tiere mit Flanell.
Wachsbrandslecken lasse man wie sie
sind. Orgelgehäufe sind entsprechend
ihrer Fassung nach obigen Grundsätzen
zu behandeln. Eine einfache weiße Fas-
sung ist herzustellen durch matten Kreide-
anstrich lauf das mit Leimtränke gut
eingelassene und wieder getrocknete Holz.
Eisenarbeiten, die eingerostet sind,
werden mit Petroleum angeseuchtet, mit
der Drahtbürste abgekratzt, mit Petro-
leum nachgereinigt, mit Leinölsirniß be-
strichen und mit der Lötslamme einge-
brannt. Schlösset können wegen der
Feuersgesahr nur öfter le'irtgefettet und
mit Lappen gut nachgerieben werden.
Bemaltes Eisen ist mit einer Misch-
ung von Petroleum oder Terpentin und
etwas Leinölzusatz zu reinigen. Soll
Farbe entfernt werden, so geschieht es
mit Pomsol und Spachtel. Vor der
Neubemalung ist zu grundieren mit ro-
tem Mennig, zu vergolden ans dünn-
ausgetragenem, doppeltgekochtem Oel-
sirniß, der alten Umgebung anzupassen
durch Aquarellsarben.
Für den Bodenbelag bevorzirgte die
Gegen sä ulnisd rohende Feuchtigkeit helfe
man sich durch Isolieren, mit Bleiplat-
ten oder gründliche Entseuchtigung.
Oelsarben- oder Lackanstrich entferne
man mit einer Lösung von % Terpen-
tin, % Spiritus, i/g Leinöl, sch Paraf-
fin, wasche mit Terpentin nach und frot-
tiere die alte Politur mit wollenen Lap-
pen. Marmoriertes oder maseriertes
Holz ist abzubeizen, wo schadhafte Stel-
len sind, mit einer Mischung von Ter-
pentin, Spiritus und Leinöl gut abzu-
reiben und dann der Umgebung ent-
sprechend zu beizen und zo polieren.
Neufassungen mögen sich an alte Vor-
bilder halten: Grundierung mit Bolog-
neser- oder Champagnerkreide, Fassung
in Leimfarbe, unter Beimischung von
Kleister aus gekochtem Stärkemehl unter
das Leimwasser, oder aber mit dickflüs-
sigen Kaseinfarben. Marmorierungs-
ergänzungen sollen an Ort und Stelle,
nicht in der Werkstatt erfolgen.
Alte Glanzvergoldung ist mit weichem
Brot zu reinigen, auszubessern und
leicht aufzupolieren. Leichte Abreibun-
gen lasse man, wie sie sind.
Die Figuren dieser Zeit erscheinen
uns neben denen der gotischen und
vollends der romanischen Periode zu be-
wegt, die Kleidung zu unruhig und
flatternd — und sie sind es; aber ihre
Bewegung ist eben nur ein Moment
und ein notwendiges Moment in dem
Schwung und der Bewegung der Linien
überhaupt. Also lasse man sie. Auch
ihre Fassung schone man so gut wie
möglich. Es können sich an ein und
derselben Figur Deck-Lasurfarben, auf-
gemalte und in den Kreidegrund einge-
schnittene Ornamente finden. Man lasse
sie, wie sie sind; abfallende Teile leime
man fest. Muß abgebeizt werden, so
nehme man Pomsol und fasse nachher
entsprechend der Umgebung. Vergol-
dung und Versilberung wird von Pom-
sol nicht angegriffen und kann in sehr
vielen Fällen gelassen werden. Wenn
nicht, schleife man sie ab mit Glas oder
Petroteaim.aiu'fgteiliöft — doch worden die Eier
dalxi nicht getötet. Raldiilal, ,aber seneirige-
fäihrl'.ch: Schwofelköhlenstoff, vMMsührt durch
Emböhven von Löchern und Elnschiebung von
Röhrchen (vgl. Hager a>. n. £),).
Sandpapier und bessere in Branntwein-
technik nach.
Vergoldete oder versilberte Gravie-
rungen sind in den Grund zu schneiden
und all' diese Erneuerungsarbeiten
sind nicht jedermanns Sache, sondern
fordern Uebung und Erfahrung. Daß
das Gestühl mit seinem behaglich brau-
nen Ton mit zum Gesamteindruck bei-
trägt, fühlt man, wenn man es nicht
schon vorher -empfunden, recht deutlich
in den französischen Kirchen, in denen -es
vielfach fehlt. Und was die Beichtstühle
mit ihren Nischen zur Belebung der
Wand beitragen, hat sich mir nie so
nachdrücklich aufgedrängt, wie m der
gähnenden Leere! der Londoner Sankt
Paulskathedrale, obgleich oder vielmehr
gerade weil sie eine Kopie von St. Peter
zu Rom, aber selbstverständlich ohne die
katholische Kulteinrichtungen ist. Man
erhalte also das alte Gestühl nach Form
und Farbe, so lang man kann, gehv ge-
gen Feuchtigkeit oder Wurmfraß mit
den altbewährten Mitteln vor, beize Er-
gänzungen an, schone eingelegte Arbei-
ten so gut als möglich, reibe sie mit
Mohn- oder Nußöl leicht ein und frot-
tiere mit Flanell.
Wachsbrandslecken lasse man wie sie
sind. Orgelgehäufe sind entsprechend
ihrer Fassung nach obigen Grundsätzen
zu behandeln. Eine einfache weiße Fas-
sung ist herzustellen durch matten Kreide-
anstrich lauf das mit Leimtränke gut
eingelassene und wieder getrocknete Holz.
Eisenarbeiten, die eingerostet sind,
werden mit Petroleum angeseuchtet, mit
der Drahtbürste abgekratzt, mit Petro-
leum nachgereinigt, mit Leinölsirniß be-
strichen und mit der Lötslamme einge-
brannt. Schlösset können wegen der
Feuersgesahr nur öfter le'irtgefettet und
mit Lappen gut nachgerieben werden.
Bemaltes Eisen ist mit einer Misch-
ung von Petroleum oder Terpentin und
etwas Leinölzusatz zu reinigen. Soll
Farbe entfernt werden, so geschieht es
mit Pomsol und Spachtel. Vor der
Neubemalung ist zu grundieren mit ro-
tem Mennig, zu vergolden ans dünn-
ausgetragenem, doppeltgekochtem Oel-
sirniß, der alten Umgebung anzupassen
durch Aquarellsarben.
Für den Bodenbelag bevorzirgte die