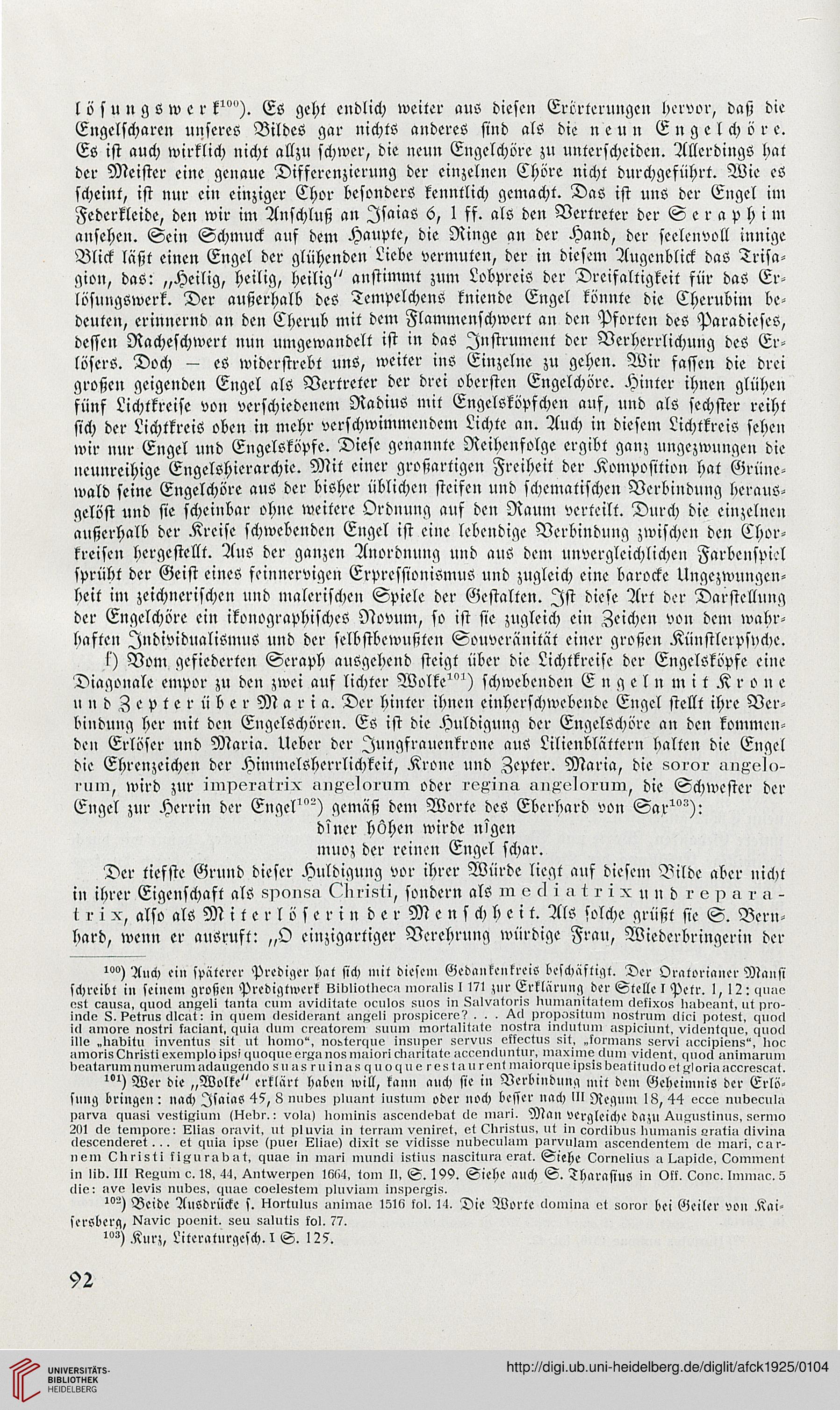lösungswer J100). Es geht endlich weiter aus diesen Erörterungen hervor, daß die
Engelscharen unseres Bildes gar nichts anderes sind als die neun E n g c l ch ö r e.
Es ist auch wirklich nicht allzu schwer, die neun Engelchöre zu unterscheiden. Allerdings hat
der Meister eine genaue Differenzierung der einzelnen Chöre nicht durchgeführt. Wie cS
scheint, ist nur ein einziger Chor besonders kenntlich gemacht. Das ist uns der Engel im
Federkleide, den wir im Anschluß an Isaias 6, I ff. als den Vertreter der Seraphim
ansehen. Sein Schmuck ans dem Haupte, die Ringe an der Hand, der seelenvoll innige
Blick laßt einen Engel der glühenden Liebe vermuten, der in diesem Augenblick das Trisa-
gion, daö: „Heilig, heilig, heilig" anstimmt zum Lobpreis der Dreifaltigkeit für das Er-
lösungswerk. Der außerhalb des TempelchenS kniende Engel könnte die Cherubim be-
deuten, erinnernd an den Cherub mit dem Flammenschwert an den Pforten des Paradieses,
dessen Racheschwcrt nun nmgewandclt ist in das Instrument der Verherrlichung des Er-
lösers. Doch - cS widerstrebt uns, weiter ins Einzelne zu gehen. Wir fassen die drei
großen geigenden Engel als Vertreter der drei obersten Engelchöre. Hinter ihnen glühen
fünf Lichtkreise von verschiedenem Radius mit Engelsköpfchen auf, und als sechster reiht
sich der Lichtkreis oben in mehr verschwimmendein Lichte an. Auch in diesem Lichtkreis sehen
wir nur Engel und Engelsköpfe. Diese genannte Reihenfolge ergibt ganz ungezwungen die
neunreihige Engelshierarchie. Mit einer großartigen Freiheit der Komposition hat Grüne-
wald seine Engelchöre aus der bisher üblichen steifen und schematischen Verbindung berans-
gelöst und sie scheinbar ohne weitere Ordnung auf den Raum verteilt. Durch die einzelnen
außerhalb der Kreise schwebenden Engel ist eine lebendige Verbindung zwischen den Chor-
kreisen hcrgestcllt. AuS der ganzen Anordnung und aus dem unvergleichlichen Farbenspiel
sprüht der Geist eines feinnervigen ErpressioniSmns und zugleich eine barocke llngczwungcn-
heit im zeichnerischen und malerischen Spiele der Gestalten. Ist diese Art der Darstellung
der Engelchöre ein ikonographischeS Novum, so ist sie zugleich ein Zeichen von dem wahr-
haften Individualismus und der selbstbewußten Souveränität einer großen Künstlerpsyche.
f) Vom gefiederten Seraph ausgehend steigt über die Lichtkreise der Engelsköpfe eine
Diagonale empor zu den zwei auf lichter WolkCH schwebenden E n g e l n m i t K r o n e
u n d Z e p t e r ü b e r M a r i a. Der hinter ihnen cinherschwebcnde Engel stellt ihre Ver-
bindung her mit den Engelschören. Es ist die Huldigung der Engelschöre an den kommen-
den Erlöser und Maria, lieber der Jungfrancnkrone aus Lilienblättern halten die Engel
die Ehrenzeichen der Himmelsherrlichkeit, Krone und Zepter. Maria, die soror angelo-
rum, wird zur imperatrix angelorum oder regina angelorum, die Schwester der
Engel zur Herrin der Engel"'") gemäß dem Worte des Eberhard von SaC°H:
d> »er hohen wirde nigcn
muoz der reinen Engel schar.
Der tiefste Grund dieser Huldigung vor ihrer Würde liegt auf diesem Bilde aber »iä>t
in ihrer Eigenschaft als sponsa Christi, sondern als m ediatrixjmbrepar a -
tri x, also als Mite r löseri n de r M e n s ch h e i t. Als solche grüßt sie S. Bern-
hard, wenn er ausruft: „O einzigartiger Verehrung würdige Frau, Wiederbringerin der
*Hud) ein späterer Prediger hat sich mit diesem Gedankenkreis beschäftigt. Der Oratorianer Man st
schreibt in seinem großen Predigtwerk Bibliotlieca moralis I 171 zur Erklärung der Stelle I Petr. I, 12: quae
est causa, quod angeli tanta cum aviditate oculos suos in Salvatoris humanitatem defixos habeant, ut pro-
indc S. Petrus dient: in quem desiderant angeli prospicere? ... Ad propositum nostrum dici potest, quod
id amore nostri faciant, quia dum creatorem suum mortalitate nosira indutum aspiciunt, videntque, quod
ille „habitu inventus sil ut liomo“, nosterque insuper servus cffectus sit, „formans servi accipiens“, hoc
amoris Christi exemplo ipsr quoque erganos maiori charitate accenduntur, maxi me dum vident, quod animarum
beatarum numerumadaugendo suasruinasquoqueresta u reut maiorqueipsisbeatitudoetgloriaaccrescat.
101) Wer die „Wolke" erklärt haben will, kann auch sie in Verbindung mit dem Geheimnis der Erlö-
sung bringen : nach IsaiaS 45, 8 nubes pluant iustum oder noch bester nach lll Regum 18, 44 ecce nubecula
parva quasi vestigium (Hebr.: vola) hominis ascendebat de mari. Man vergleiche dazu Augustinus, serrno
201 de tempore: Elias oravit, ut pluvia in terram veniret, et Christus, ut in cordibus humanis sratia divina
descenderet. .. et quia ipse (puei Eliae) dixit se vidisse nubeculam parvulam ascendentem de mari, car-
nem Christi figurabat, quae in mari mundi istius nascitura erat. Siehe Cornelius a Lapide, Comment
in lib. III Regum c. 18, 44, Antwerpen 1604, tom II, S. 199. Siehe auch S. Tharasi'uS in Off. Conc. Immac. 5
die: ave levis nubes, quae coelestem pluviam inspergis.
102) Beide Ausdrücke s. klortulus animae 1516 fol. 14. Die Worte domina et soror bei Geiler von Kai-
sersberg, hlavic poenit. seu salutis fol. 77.
10^) Kurz, Literaturgesch. 1 S. 125.
92
Engelscharen unseres Bildes gar nichts anderes sind als die neun E n g c l ch ö r e.
Es ist auch wirklich nicht allzu schwer, die neun Engelchöre zu unterscheiden. Allerdings hat
der Meister eine genaue Differenzierung der einzelnen Chöre nicht durchgeführt. Wie cS
scheint, ist nur ein einziger Chor besonders kenntlich gemacht. Das ist uns der Engel im
Federkleide, den wir im Anschluß an Isaias 6, I ff. als den Vertreter der Seraphim
ansehen. Sein Schmuck ans dem Haupte, die Ringe an der Hand, der seelenvoll innige
Blick laßt einen Engel der glühenden Liebe vermuten, der in diesem Augenblick das Trisa-
gion, daö: „Heilig, heilig, heilig" anstimmt zum Lobpreis der Dreifaltigkeit für das Er-
lösungswerk. Der außerhalb des TempelchenS kniende Engel könnte die Cherubim be-
deuten, erinnernd an den Cherub mit dem Flammenschwert an den Pforten des Paradieses,
dessen Racheschwcrt nun nmgewandclt ist in das Instrument der Verherrlichung des Er-
lösers. Doch - cS widerstrebt uns, weiter ins Einzelne zu gehen. Wir fassen die drei
großen geigenden Engel als Vertreter der drei obersten Engelchöre. Hinter ihnen glühen
fünf Lichtkreise von verschiedenem Radius mit Engelsköpfchen auf, und als sechster reiht
sich der Lichtkreis oben in mehr verschwimmendein Lichte an. Auch in diesem Lichtkreis sehen
wir nur Engel und Engelsköpfe. Diese genannte Reihenfolge ergibt ganz ungezwungen die
neunreihige Engelshierarchie. Mit einer großartigen Freiheit der Komposition hat Grüne-
wald seine Engelchöre aus der bisher üblichen steifen und schematischen Verbindung berans-
gelöst und sie scheinbar ohne weitere Ordnung auf den Raum verteilt. Durch die einzelnen
außerhalb der Kreise schwebenden Engel ist eine lebendige Verbindung zwischen den Chor-
kreisen hcrgestcllt. AuS der ganzen Anordnung und aus dem unvergleichlichen Farbenspiel
sprüht der Geist eines feinnervigen ErpressioniSmns und zugleich eine barocke llngczwungcn-
heit im zeichnerischen und malerischen Spiele der Gestalten. Ist diese Art der Darstellung
der Engelchöre ein ikonographischeS Novum, so ist sie zugleich ein Zeichen von dem wahr-
haften Individualismus und der selbstbewußten Souveränität einer großen Künstlerpsyche.
f) Vom gefiederten Seraph ausgehend steigt über die Lichtkreise der Engelsköpfe eine
Diagonale empor zu den zwei auf lichter WolkCH schwebenden E n g e l n m i t K r o n e
u n d Z e p t e r ü b e r M a r i a. Der hinter ihnen cinherschwebcnde Engel stellt ihre Ver-
bindung her mit den Engelschören. Es ist die Huldigung der Engelschöre an den kommen-
den Erlöser und Maria, lieber der Jungfrancnkrone aus Lilienblättern halten die Engel
die Ehrenzeichen der Himmelsherrlichkeit, Krone und Zepter. Maria, die soror angelo-
rum, wird zur imperatrix angelorum oder regina angelorum, die Schwester der
Engel zur Herrin der Engel"'") gemäß dem Worte des Eberhard von SaC°H:
d> »er hohen wirde nigcn
muoz der reinen Engel schar.
Der tiefste Grund dieser Huldigung vor ihrer Würde liegt auf diesem Bilde aber »iä>t
in ihrer Eigenschaft als sponsa Christi, sondern als m ediatrixjmbrepar a -
tri x, also als Mite r löseri n de r M e n s ch h e i t. Als solche grüßt sie S. Bern-
hard, wenn er ausruft: „O einzigartiger Verehrung würdige Frau, Wiederbringerin der
*Hud) ein späterer Prediger hat sich mit diesem Gedankenkreis beschäftigt. Der Oratorianer Man st
schreibt in seinem großen Predigtwerk Bibliotlieca moralis I 171 zur Erklärung der Stelle I Petr. I, 12: quae
est causa, quod angeli tanta cum aviditate oculos suos in Salvatoris humanitatem defixos habeant, ut pro-
indc S. Petrus dient: in quem desiderant angeli prospicere? ... Ad propositum nostrum dici potest, quod
id amore nostri faciant, quia dum creatorem suum mortalitate nosira indutum aspiciunt, videntque, quod
ille „habitu inventus sil ut liomo“, nosterque insuper servus cffectus sit, „formans servi accipiens“, hoc
amoris Christi exemplo ipsr quoque erganos maiori charitate accenduntur, maxi me dum vident, quod animarum
beatarum numerumadaugendo suasruinasquoqueresta u reut maiorqueipsisbeatitudoetgloriaaccrescat.
101) Wer die „Wolke" erklärt haben will, kann auch sie in Verbindung mit dem Geheimnis der Erlö-
sung bringen : nach IsaiaS 45, 8 nubes pluant iustum oder noch bester nach lll Regum 18, 44 ecce nubecula
parva quasi vestigium (Hebr.: vola) hominis ascendebat de mari. Man vergleiche dazu Augustinus, serrno
201 de tempore: Elias oravit, ut pluvia in terram veniret, et Christus, ut in cordibus humanis sratia divina
descenderet. .. et quia ipse (puei Eliae) dixit se vidisse nubeculam parvulam ascendentem de mari, car-
nem Christi figurabat, quae in mari mundi istius nascitura erat. Siehe Cornelius a Lapide, Comment
in lib. III Regum c. 18, 44, Antwerpen 1604, tom II, S. 199. Siehe auch S. Tharasi'uS in Off. Conc. Immac. 5
die: ave levis nubes, quae coelestem pluviam inspergis.
102) Beide Ausdrücke s. klortulus animae 1516 fol. 14. Die Worte domina et soror bei Geiler von Kai-
sersberg, hlavic poenit. seu salutis fol. 77.
10^) Kurz, Literaturgesch. 1 S. 125.
92