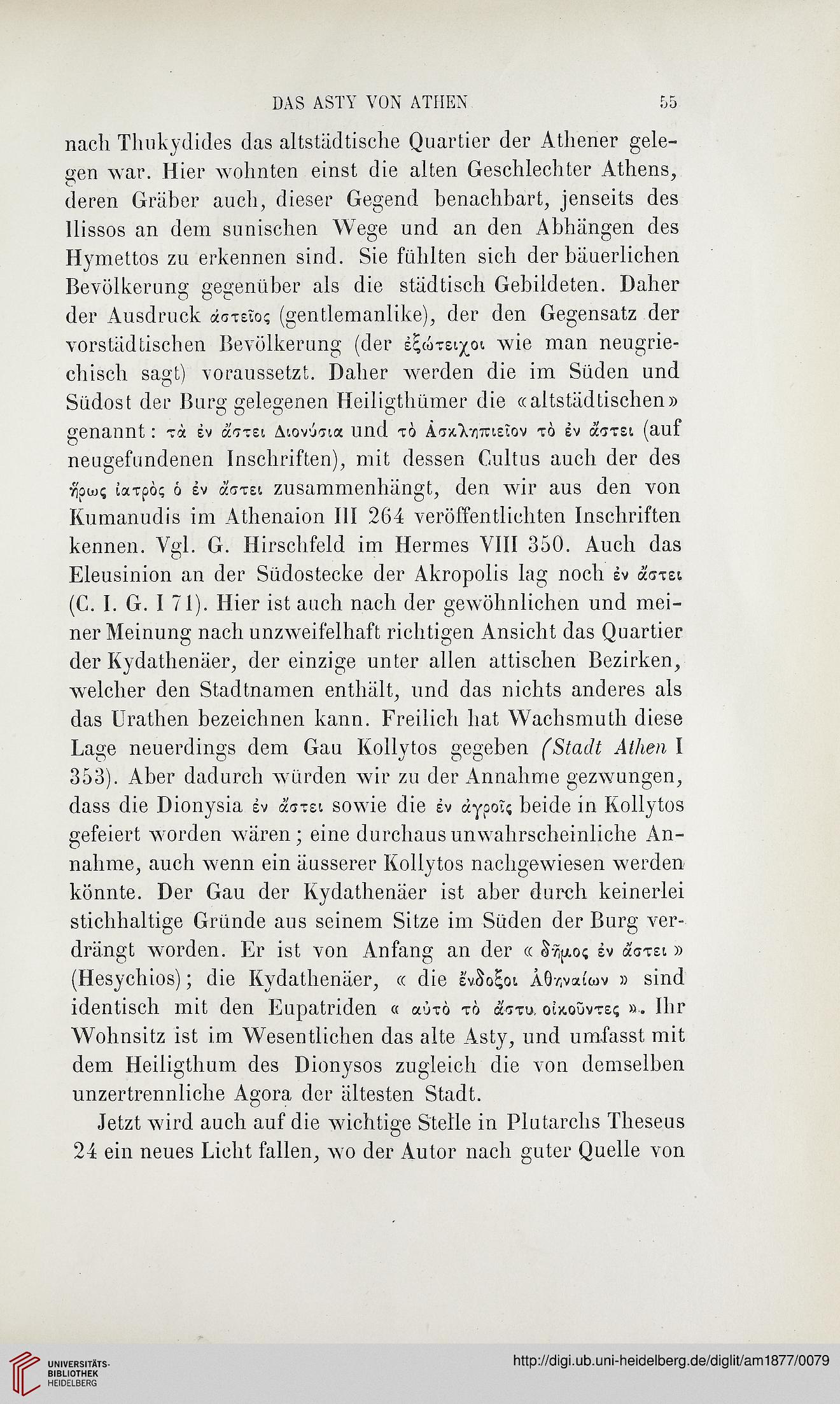DAS ASTY VON ATHEN
55
nach Thukydides das altstädtische Quartier der Athener gele-
gen war. Hier wohnten einst die alten Geschlechter Athens,
deren Gräber auch, dieser Gegend benachbart, jenseits des
llissos an dem sunischen Wege und an den Abhängen des
Hymettos zu erkennen sind. Sie fühlten sich der bäuerlichen
Bevölkerung gegenüber als die städtisch Gebildeten. Daher
der Ausdruck xc-TEto^ (gentlemanlike), der den Gegensatz der
vorstädtischen Bevölkerung (der ^MTE^cn wie man neugrie-
chisch sagt) voraussetzt. Daher werden die im Süden und
Südost der Burg gelegenen Heiligthümer die ((altstädtischen))
genannt: G <x?TEt. A^v-j^tx und io to sv o&Tst (auf
neugefundenen Inschriften), mit dessen Eultus auch der des
7ipoj; tKTpo; 6 ev x?TE( zusammenhängt, den wir aus den von
Kumanudis im Athenaion IH 264 verölfentlichten Inschriften
kennen. Vgl. G. Hirschfeld im Hermes VIII 350. Auch das
Eleusinion an der Südostecke der Akropolis lag noch sv xciEt
(C. I. G. I 71). Hier ist auch nach der gewöhnlichen und mei-
ner Meinung nach unzw eifelhaft richtigen Ansicht das Quartier
derKydathenäer, der einzige unter allen attischen Bezirken,
welcher den Stadtnamen enthält, und das nichts anderes als
das Urathen bezeichnen kann. Freilich hat Wachsmuth diese
Lage neuerdings dem Gau IÄollytos gegeben I
353). Aber dadurch würden wir zu der Annahme gezwungen,
dass die Dionysia sv <xc-:s( sowie die sv xypot; beide in Kollytos
gefeiert worden wären ; eine durchaus unw ahrscheinliche An-
nahme, auch wenn ein äusserer IÄollytos nachgewiesen werden
könnte. Der Gau der Kydathenäer ist aber durch keinerlei
stichhaltige Gründe aus seinem Sitze im Süden der Burg ver-
drängt worden. Er ist von Anfang an der (( sv xcrEt))
(Hesychios); die Kydathenäer, (( die sv^o^ot. AOzvxtMv n sind
identisch mit den Eupatriden a xüirö To x?Tu, otzoüvTEi; a. Ihr
Wohnsitz ist im Wesentlichen das alte Asty, und umfasst mit
dem Heiligthum des Dionysos zugleich die von demselben
unzertrennliche Agora der ältesten Stadt.
Jetzt wird auch auf die wichtige Stelle in Plutarchs Theseus
24 ein neues Licht fallen, wo der Autor nach guter Quelle von
55
nach Thukydides das altstädtische Quartier der Athener gele-
gen war. Hier wohnten einst die alten Geschlechter Athens,
deren Gräber auch, dieser Gegend benachbart, jenseits des
llissos an dem sunischen Wege und an den Abhängen des
Hymettos zu erkennen sind. Sie fühlten sich der bäuerlichen
Bevölkerung gegenüber als die städtisch Gebildeten. Daher
der Ausdruck xc-TEto^ (gentlemanlike), der den Gegensatz der
vorstädtischen Bevölkerung (der ^MTE^cn wie man neugrie-
chisch sagt) voraussetzt. Daher werden die im Süden und
Südost der Burg gelegenen Heiligthümer die ((altstädtischen))
genannt: G <x?TEt. A^v-j^tx und io to sv o&Tst (auf
neugefundenen Inschriften), mit dessen Eultus auch der des
7ipoj; tKTpo; 6 ev x?TE( zusammenhängt, den wir aus den von
Kumanudis im Athenaion IH 264 verölfentlichten Inschriften
kennen. Vgl. G. Hirschfeld im Hermes VIII 350. Auch das
Eleusinion an der Südostecke der Akropolis lag noch sv xciEt
(C. I. G. I 71). Hier ist auch nach der gewöhnlichen und mei-
ner Meinung nach unzw eifelhaft richtigen Ansicht das Quartier
derKydathenäer, der einzige unter allen attischen Bezirken,
welcher den Stadtnamen enthält, und das nichts anderes als
das Urathen bezeichnen kann. Freilich hat Wachsmuth diese
Lage neuerdings dem Gau IÄollytos gegeben I
353). Aber dadurch würden wir zu der Annahme gezwungen,
dass die Dionysia sv <xc-:s( sowie die sv xypot; beide in Kollytos
gefeiert worden wären ; eine durchaus unw ahrscheinliche An-
nahme, auch wenn ein äusserer IÄollytos nachgewiesen werden
könnte. Der Gau der Kydathenäer ist aber durch keinerlei
stichhaltige Gründe aus seinem Sitze im Süden der Burg ver-
drängt worden. Er ist von Anfang an der (( sv xcrEt))
(Hesychios); die Kydathenäer, (( die sv^o^ot. AOzvxtMv n sind
identisch mit den Eupatriden a xüirö To x?Tu, otzoüvTEi; a. Ihr
Wohnsitz ist im Wesentlichen das alte Asty, und umfasst mit
dem Heiligthum des Dionysos zugleich die von demselben
unzertrennliche Agora der ältesten Stadt.
Jetzt wird auch auf die wichtige Stelle in Plutarchs Theseus
24 ein neues Licht fallen, wo der Autor nach guter Quelle von