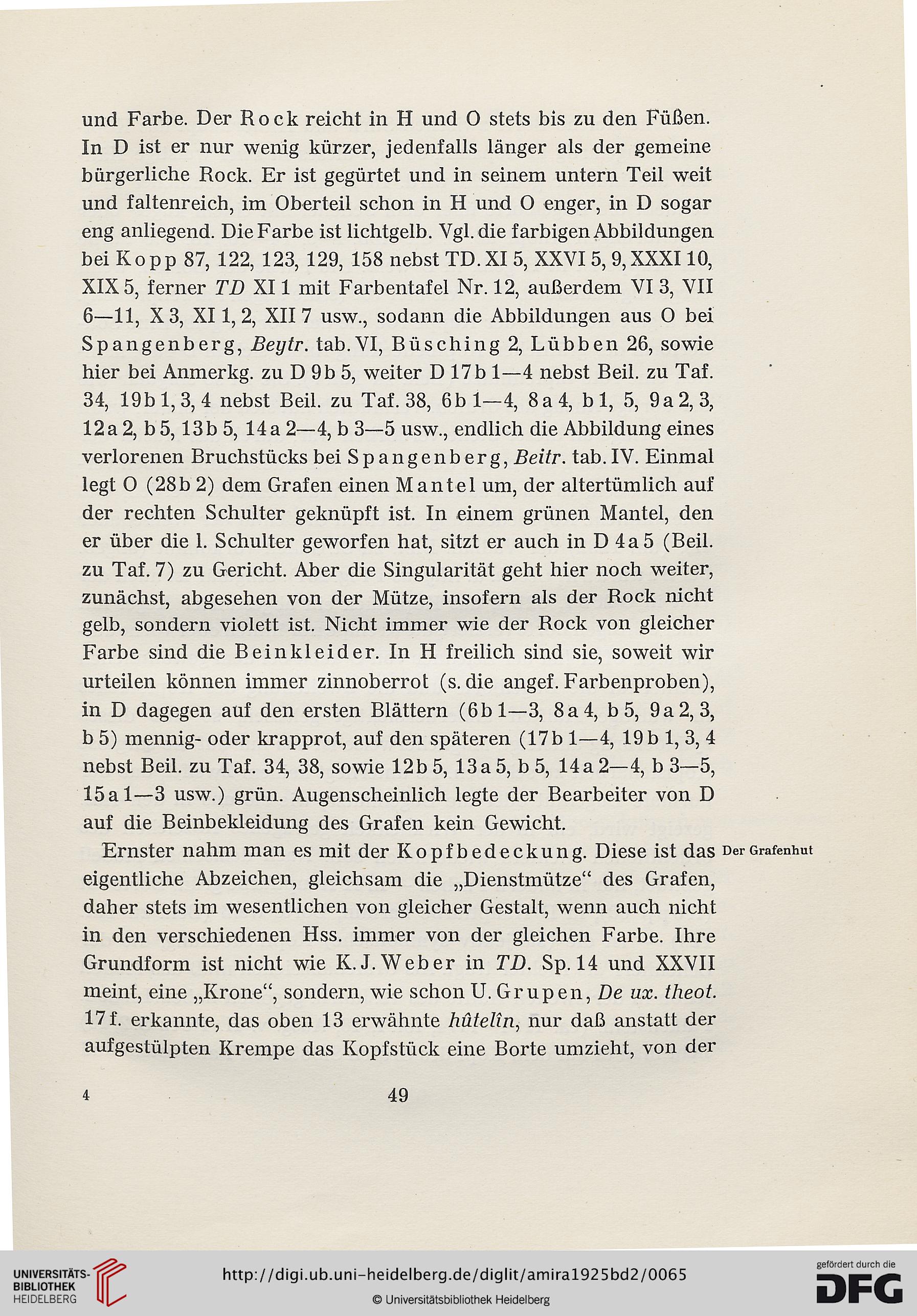und Farbe. Der Rock reicht in H und 0 stets bis zu den Füßen.
In D ist er nur wenig kürzer, jedenfalls länger als der gemeine
bürgerliche Rock. Er ist gegürtet und in seinem untern Teil weit
und faltenreich, im Oberteil schon in H und O enger, in D sogar
eng anliegend. Die Farbe ist lichtgelb. Vgl. die farbigen Abbildungen
bei Ko pp 87, 122, 123, 129, 158 nebst TD. XI 5, XXVI 5, 9, XXXI10,
XIX 5, ferner TD XI1 mit Farbentafel Nr. 12, außerdem VI 3, VII
6—11, X3, XI 1,2, XII 7 usw., sodann die Abbildungen aus O bei
Spangenberg, Beytr. tab.VI, Büsching 2, Lübben 26, sowie
hier bei Anmerkg. zu D 9b 5, weiter D 17b 1—4 nebst Beil. zu Taf.
34, 19b 1,3, 4 nebst Beil. zu Taf. 38, 6b 1—4, 8 a 4, b 1, 5, 9a 2, 3,
12a 2, b 5,13b 5, 14a 2—4, b 3—5 usw., endlich die Abbildung eines
verlorenen Bruchstücks bei Spangenberg, Beitr. tab. IV. Einmal
legt 0 (28b 2) dem Grafen einen Mantel um, der altertümlich auf
der rechten Schulter geknüpft ist. In einem grünen Mantel, den
er über die 1. Schulter geworfen hat, sitzt er auch in D 4a5 (Beil.
zu Taf. 7) zu Gericht. Aber die Singularität geht hier noch weiter,
zunächst, abgesehen von der Mütze, insofern als der Rock nicht
gelb, sondern violett ist. Nicht immer wie der Rock von gleicher
Farbe sind die Beinkleider. In H freilich sind sie, soweit wir
urteilen können immer zinnoberrot (s. die angef. Farbenproben),
in D dagegen auf den ersten Blättern (6b 1—3, 8a 4, b 5, 9a 2, 3,
b 5) mennig- oder krapprot, auf den späteren (17b 1—4, 19 b 1, 3, 4
nebst Beil. zu Taf. 34, 38, sowie 12b 5, 13a 5, b 5, 14a 2—4, b 3—5,
15al—3 usw.) grün. Augenscheinlich legte der Bearbeiter von D
auf die Beinbekleidung des Grafen kein Gewicht.
Ernster nahm man es mit der Kopfbedeckung. Diese ist das Der Grafenhut
eigentliche Abzeichen, gleichsam die „Dienstmütze" des Grafen,
daher stets im wesentlichen von gleicher Gestalt, wenn auch nicht
in den verschiedenen Hss. immer von der gleichen Farbe. Ihre
Grundform ist nicht wie K.J.Weber in TD. Sp. 14 und XXVII
meint, eine „Krone", sondern, wie schon U. Grupen, De ux. theot.
17 f. erkannte, das oben 13 erwähnte hütelin, nur daß anstatt der
aufgestülpten Krempe das Kopfstück eine Borte umzieht, von der
4
49
In D ist er nur wenig kürzer, jedenfalls länger als der gemeine
bürgerliche Rock. Er ist gegürtet und in seinem untern Teil weit
und faltenreich, im Oberteil schon in H und O enger, in D sogar
eng anliegend. Die Farbe ist lichtgelb. Vgl. die farbigen Abbildungen
bei Ko pp 87, 122, 123, 129, 158 nebst TD. XI 5, XXVI 5, 9, XXXI10,
XIX 5, ferner TD XI1 mit Farbentafel Nr. 12, außerdem VI 3, VII
6—11, X3, XI 1,2, XII 7 usw., sodann die Abbildungen aus O bei
Spangenberg, Beytr. tab.VI, Büsching 2, Lübben 26, sowie
hier bei Anmerkg. zu D 9b 5, weiter D 17b 1—4 nebst Beil. zu Taf.
34, 19b 1,3, 4 nebst Beil. zu Taf. 38, 6b 1—4, 8 a 4, b 1, 5, 9a 2, 3,
12a 2, b 5,13b 5, 14a 2—4, b 3—5 usw., endlich die Abbildung eines
verlorenen Bruchstücks bei Spangenberg, Beitr. tab. IV. Einmal
legt 0 (28b 2) dem Grafen einen Mantel um, der altertümlich auf
der rechten Schulter geknüpft ist. In einem grünen Mantel, den
er über die 1. Schulter geworfen hat, sitzt er auch in D 4a5 (Beil.
zu Taf. 7) zu Gericht. Aber die Singularität geht hier noch weiter,
zunächst, abgesehen von der Mütze, insofern als der Rock nicht
gelb, sondern violett ist. Nicht immer wie der Rock von gleicher
Farbe sind die Beinkleider. In H freilich sind sie, soweit wir
urteilen können immer zinnoberrot (s. die angef. Farbenproben),
in D dagegen auf den ersten Blättern (6b 1—3, 8a 4, b 5, 9a 2, 3,
b 5) mennig- oder krapprot, auf den späteren (17b 1—4, 19 b 1, 3, 4
nebst Beil. zu Taf. 34, 38, sowie 12b 5, 13a 5, b 5, 14a 2—4, b 3—5,
15al—3 usw.) grün. Augenscheinlich legte der Bearbeiter von D
auf die Beinbekleidung des Grafen kein Gewicht.
Ernster nahm man es mit der Kopfbedeckung. Diese ist das Der Grafenhut
eigentliche Abzeichen, gleichsam die „Dienstmütze" des Grafen,
daher stets im wesentlichen von gleicher Gestalt, wenn auch nicht
in den verschiedenen Hss. immer von der gleichen Farbe. Ihre
Grundform ist nicht wie K.J.Weber in TD. Sp. 14 und XXVII
meint, eine „Krone", sondern, wie schon U. Grupen, De ux. theot.
17 f. erkannte, das oben 13 erwähnte hütelin, nur daß anstatt der
aufgestülpten Krempe das Kopfstück eine Borte umzieht, von der
4
49