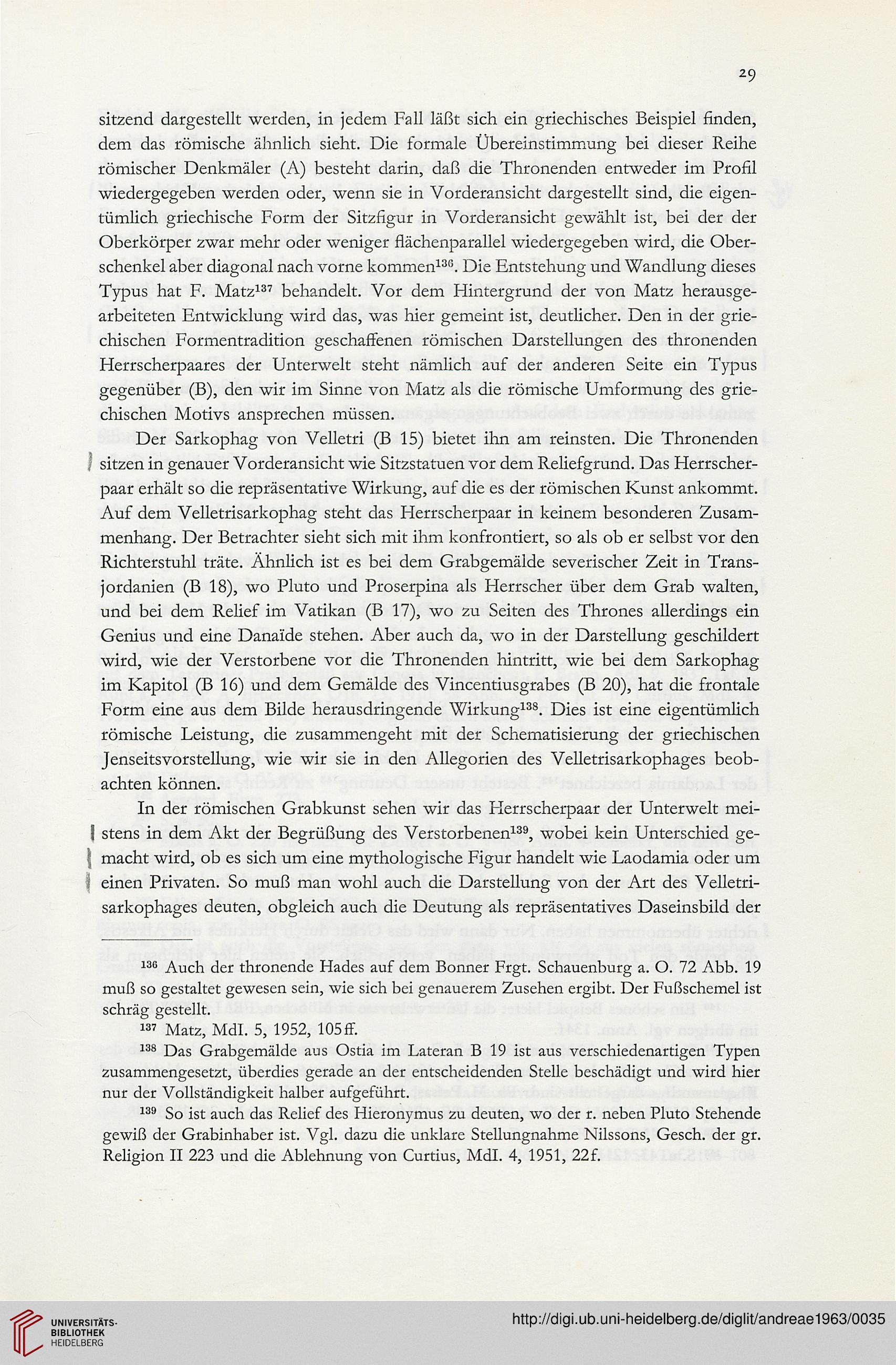2 9
sitzend dargestellt werden, in jedem Fall läßt sich ein griechisches Beispiel finden,
dem das römische ähnlich sieht. Die formale Übereinstimmung bei dieser Reihe
römischer Denkmäler (A) besteht darin, daß die Thronenden entweder im Profil
wiedergegeben werden oder, wenn sie in Vorderansicht dargestellt sind, die eigen-
tümlich griechische Form der Sitzfigur in Vorderansicht gewählt ist, bei der der
Oberkörper zwar mehr oder weniger flächenparallel wiedergegeben wird, die Ober-
schenkel aber diagonal nach vorne kommen130. Die Entstehung und Wandlung dieses
Typus hat F. Matz137 behandelt. Vor dem Hintergrund der von Matz herausge-
arbeiteten Entwicklung wird das, was hier gemeint ist, deutlicher. Den in der grie-
chischen Formentradition geschaffenen römischen Darstellungen des thronenden
Herrscherpaares der Unterwelt steht nämlich auf der anderen Seite ein Typus
gegenüber (B), den wir im Sinne von Matz als die römische Umformung des grie-
chischen Motivs ansprechen müssen.
Der Sarkophag von Velletri (B 15) bietet ihn am reinsten. Die Thronenden
; sitzen in genauer Vorderansicht wie Sitzstatuen vor dem Reliefgrund. Das Herrscher-
paar erhält so die repräsentative Wirkung, auf die es der römischen Kunst ankommt.
Auf dem Velletrisarkophag steht das Herrscherpaar in keinem besonderen Zusam-
menhang. Der Betrachter sieht sich mit ihm konfrontiert, so als ob er selbst vor den
Richterstuhl träte. Ähnlich ist es bei dem Grabgemälde severischer Zeit in Trans-
jordanien (B 18), wo Pluto und Proserpina als Herrscher über dem Grab walten,
und bei dem Relief im Vatikan (B 17), wo zu Seiten des Thrones allerdings ein
Genius und eine Danaide stehen. Aber auch da, wo in der Darstellung geschildert
wird, wie der Verstorbene vor die Thronenden hintritt, wie bei dem Sarkophag
im Kapitol (B 16) und dem Gemälde des Vincentiusgrabes (B 20), hat die frontale
Form eine aus dem Bilde herausdringende Wirkung138. Dies ist eine eigentümlich
römische Leistung, die zusammengeht mit der Schematisierung der griechischen
Jenseitsvorstellung, wie wir sie in den Allegorien des Velletrisarkophages beob-
achten können.
In der römischen Grabkunst sehen wir das Herrscherpaar der Unterwelt mei-
I stens in dem Akt der Begrüßung des Verstorbenen139, wobei kein Unterschied ge-
\ macht wird, ob es sich um eine mythologische Figur handelt wie Laodamia oder um
I einen Privaten. So muß man wohl auch die Darstellung von der Art des Velletri-
sarkophages deuten, obgleich auch die Deutung als repräsentatives Daseinsbild der
130 Auch der thronende Hades auf dem Bonner Frgt. Schauenburg a. O. 72 Abb. 19
muß so gestaltet gewesen sein, wie sich bei genauerem Zusehen ergibt. Der Fußschemel ist
schräg gestellt.
137 Matz, MdL 5, 1952, 105 ff.
138 Das Grabgemälde aus Ostia im Lateran B 19 ist aus verschiedenartigen Typen
zusammengesetzt, überdies gerade an der entscheidenden Stelle beschädigt und wird hier
nur der Vollständigkeit halber aufgeführt.
139 So ist auch das Relief des Hieronymus zu deuten, wo der r. neben Pluto Stehende
gewiß der Grabinhaber ist. Vgl. dazu die unklare Stellungnahme Nilssons, Gesch. der gr.
Religion II 223 und die Ablehnung von Curtius, MdL 4, 1951, 22f.
sitzend dargestellt werden, in jedem Fall läßt sich ein griechisches Beispiel finden,
dem das römische ähnlich sieht. Die formale Übereinstimmung bei dieser Reihe
römischer Denkmäler (A) besteht darin, daß die Thronenden entweder im Profil
wiedergegeben werden oder, wenn sie in Vorderansicht dargestellt sind, die eigen-
tümlich griechische Form der Sitzfigur in Vorderansicht gewählt ist, bei der der
Oberkörper zwar mehr oder weniger flächenparallel wiedergegeben wird, die Ober-
schenkel aber diagonal nach vorne kommen130. Die Entstehung und Wandlung dieses
Typus hat F. Matz137 behandelt. Vor dem Hintergrund der von Matz herausge-
arbeiteten Entwicklung wird das, was hier gemeint ist, deutlicher. Den in der grie-
chischen Formentradition geschaffenen römischen Darstellungen des thronenden
Herrscherpaares der Unterwelt steht nämlich auf der anderen Seite ein Typus
gegenüber (B), den wir im Sinne von Matz als die römische Umformung des grie-
chischen Motivs ansprechen müssen.
Der Sarkophag von Velletri (B 15) bietet ihn am reinsten. Die Thronenden
; sitzen in genauer Vorderansicht wie Sitzstatuen vor dem Reliefgrund. Das Herrscher-
paar erhält so die repräsentative Wirkung, auf die es der römischen Kunst ankommt.
Auf dem Velletrisarkophag steht das Herrscherpaar in keinem besonderen Zusam-
menhang. Der Betrachter sieht sich mit ihm konfrontiert, so als ob er selbst vor den
Richterstuhl träte. Ähnlich ist es bei dem Grabgemälde severischer Zeit in Trans-
jordanien (B 18), wo Pluto und Proserpina als Herrscher über dem Grab walten,
und bei dem Relief im Vatikan (B 17), wo zu Seiten des Thrones allerdings ein
Genius und eine Danaide stehen. Aber auch da, wo in der Darstellung geschildert
wird, wie der Verstorbene vor die Thronenden hintritt, wie bei dem Sarkophag
im Kapitol (B 16) und dem Gemälde des Vincentiusgrabes (B 20), hat die frontale
Form eine aus dem Bilde herausdringende Wirkung138. Dies ist eine eigentümlich
römische Leistung, die zusammengeht mit der Schematisierung der griechischen
Jenseitsvorstellung, wie wir sie in den Allegorien des Velletrisarkophages beob-
achten können.
In der römischen Grabkunst sehen wir das Herrscherpaar der Unterwelt mei-
I stens in dem Akt der Begrüßung des Verstorbenen139, wobei kein Unterschied ge-
\ macht wird, ob es sich um eine mythologische Figur handelt wie Laodamia oder um
I einen Privaten. So muß man wohl auch die Darstellung von der Art des Velletri-
sarkophages deuten, obgleich auch die Deutung als repräsentatives Daseinsbild der
130 Auch der thronende Hades auf dem Bonner Frgt. Schauenburg a. O. 72 Abb. 19
muß so gestaltet gewesen sein, wie sich bei genauerem Zusehen ergibt. Der Fußschemel ist
schräg gestellt.
137 Matz, MdL 5, 1952, 105 ff.
138 Das Grabgemälde aus Ostia im Lateran B 19 ist aus verschiedenartigen Typen
zusammengesetzt, überdies gerade an der entscheidenden Stelle beschädigt und wird hier
nur der Vollständigkeit halber aufgeführt.
139 So ist auch das Relief des Hieronymus zu deuten, wo der r. neben Pluto Stehende
gewiß der Grabinhaber ist. Vgl. dazu die unklare Stellungnahme Nilssons, Gesch. der gr.
Religion II 223 und die Ablehnung von Curtius, MdL 4, 1951, 22f.