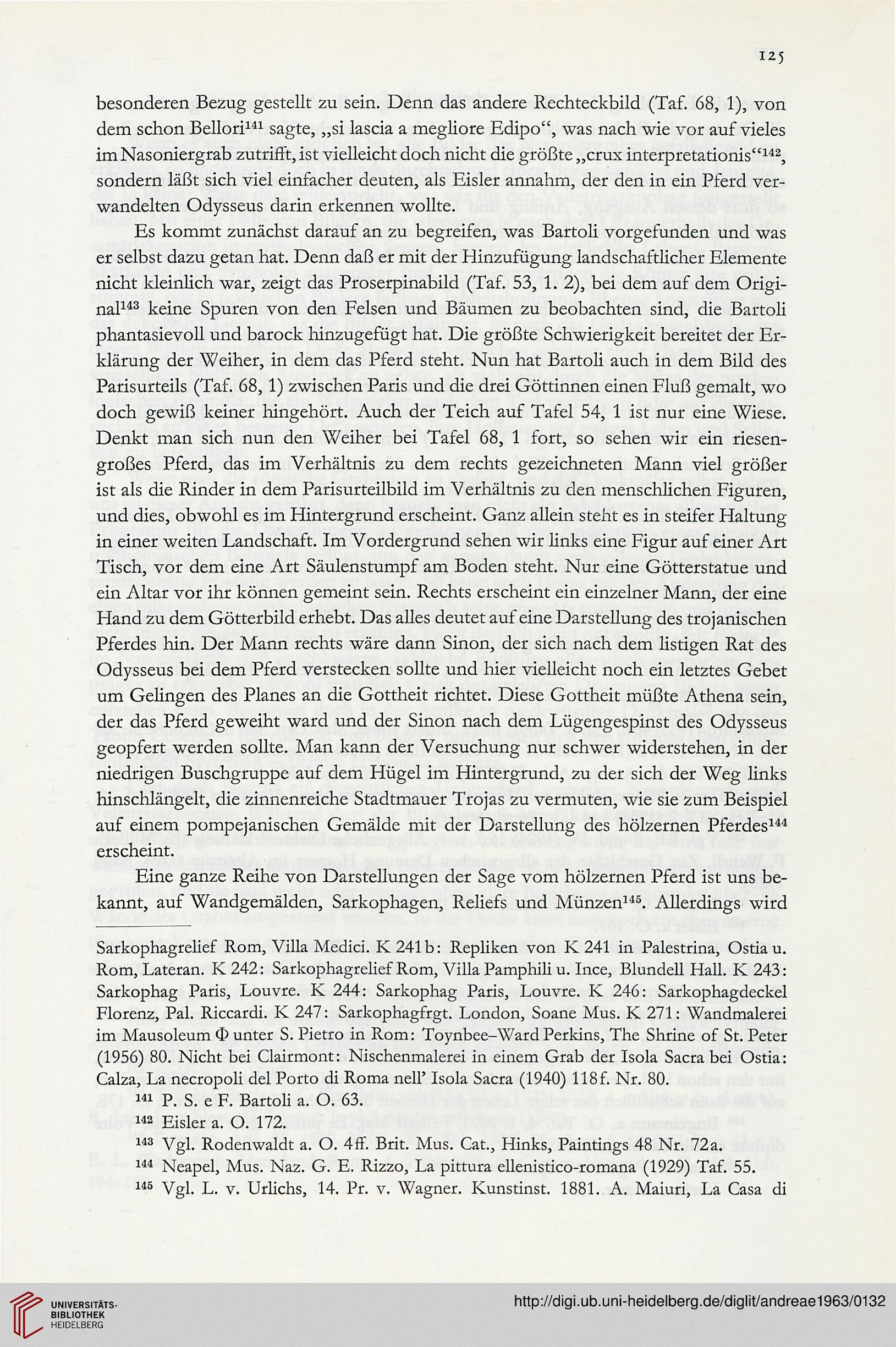125
besonderen Bezug gestellt zu sein. Denn das andere Rechteckbild (Taf. 68, 1), von
dem schon Bellori141 sagte, „si lascia a megliore Edipo", was nach wie vor auf vieles
im Nasoniergrab zutrifft, ist vielleicht doch nicht die größte „crux interpretationis"142,
sondern läßt sich viel einfacher deuten, als Eisler annahm, der den in ein Pferd ver-
wandelten Odysseus darin erkennen wollte.
Es kommt zunächst darauf an zu begreifen, was Bartoli vorgefunden und was
er selbst dazu getan hat. Denn daß er mit der Hinzufügung landschaftlicher Elemente
nicht kleinlich war, zeigt das Proserpinabild (Taf. 53, 1. 2), bei dem auf dem Origi-
nal143 keine Spuren von den Felsen und Bäumen zu beobachten sind, die Bartoli
phantasievoll und barock hinzugefügt hat. Die größte Schwierigkeit bereitet der Er-
klärung der Weiher, in dem das Pferd steht. Nun hat Bartoli auch in dem Bild des
Parisurteils (Taf. 68,1) zwischen Paris und die drei Göttinnen einen Fluß gemalt, wo
doch gewiß keiner hingehört. Auch der Teich auf Tafel 54, 1 ist nur eine Wiese.
Denkt man sich nun den Weiher bei Tafel 68, 1 fort, so sehen wir ein riesen-
großes Pferd, das im Verhältnis zu dem rechts gezeichneten Mann viel größer
ist als die Rinder in dem Parisurteilbild im Verhältnis zu den menschlichen Figuren,
und dies, obwohl es im Hintergrund erscheint. Ganz allein steht es in steifer Haltung
in einer weiten Landschaft. Im Vordergrund sehen wir links eine Figur auf einer Art
Tisch, vor dem eine Art Säulenstumpf am Boden steht. Nur eine Götterstatue und
ein Altar vor ihr können gemeint sein. Rechts erscheint ein einzelner Mann, der eine
Hand zu dem Götterbild erhebt. Das alles deutet auf eine Darstellung des trojanischen
Pferdes hin. Der Mann rechts wäre dann Sinon, der sich nach dem listigen Rat des
Odysseus bei dem Pferd verstecken sollte und hier vielleicht noch ein letztes Gebet
um Gelingen des Planes an die Gottheit richtet. Diese Gottheit müßte Athena sein,
der das Pferd geweiht ward und der Sinon nach dem Lügengespinst des Odysseus
geopfert werden sollte. Man kann der Versuchung nur schwer widerstehen, in der
niedrigen Buschgruppe auf dem Hügel im Hintergrund, zu der sich der Weg links
hinschlängelt, die zinnenreiche Stadtmauer Trojas zu vermuten, wie sie zum Beispiel
auf einem pompejanischen Gemälde mit der Darstellung des hölzernen Pferdes144
erscheint.
Eine ganze Reihe von Darstellungen der Sage vom hölzernen Pferd ist uns be-
kannt, auf Wandgemälden, Sarkophagen, Reliefs und Münzen145. Allerdings wird
Sarkophagrelief Rom, Villa Medici. K241b: Repliken von K 241 in Palestrina, Ostia u.
Rom, Lateran. K 242: Sarkophagrelief Rom, Villa Pamphili u. Ince, Blundell Hall. K 243:
Sarkophag Paris, Louvre. K 244: Sarkophag Paris, Louvre. K 246: Sarkophagdeckel
Florenz, Pal. Riccardi. K 247: Sarkophagfrgt. London, Soane Mus. K 271: Wandmalerei
im Mausoleum 3> unter S. Pietro in Rom: Toynbee-Ward Perkins, The Shrine of St. Peter
(1956) 80. Nicht bei Clairmont: Nischenmalerei in einem Grab der Isola Sacra bei Ostia:
Calza, La necropoli del Porto di Roma nell' Isola Sacra (1940) 118f. Nr. 80.
141 P. S. e F. Bartoli a. O. 63.
142 Eisler a. O. 172.
143 Vgl. Rodenwaldt a. O. 4 ff. Brit. Mus. Cat., Hinks, Paintings 48 Nr. 72 a.
144 Neapel, Mus. Naz. G. E. Rizzo, La pittura ellenistico-romana (1929) Taf. 55.
146 Vgl. L. v. Urlichs, 14. Pr. v. Wagner. Kunstinst. 1881. A. Maiuri, La Casa di
besonderen Bezug gestellt zu sein. Denn das andere Rechteckbild (Taf. 68, 1), von
dem schon Bellori141 sagte, „si lascia a megliore Edipo", was nach wie vor auf vieles
im Nasoniergrab zutrifft, ist vielleicht doch nicht die größte „crux interpretationis"142,
sondern läßt sich viel einfacher deuten, als Eisler annahm, der den in ein Pferd ver-
wandelten Odysseus darin erkennen wollte.
Es kommt zunächst darauf an zu begreifen, was Bartoli vorgefunden und was
er selbst dazu getan hat. Denn daß er mit der Hinzufügung landschaftlicher Elemente
nicht kleinlich war, zeigt das Proserpinabild (Taf. 53, 1. 2), bei dem auf dem Origi-
nal143 keine Spuren von den Felsen und Bäumen zu beobachten sind, die Bartoli
phantasievoll und barock hinzugefügt hat. Die größte Schwierigkeit bereitet der Er-
klärung der Weiher, in dem das Pferd steht. Nun hat Bartoli auch in dem Bild des
Parisurteils (Taf. 68,1) zwischen Paris und die drei Göttinnen einen Fluß gemalt, wo
doch gewiß keiner hingehört. Auch der Teich auf Tafel 54, 1 ist nur eine Wiese.
Denkt man sich nun den Weiher bei Tafel 68, 1 fort, so sehen wir ein riesen-
großes Pferd, das im Verhältnis zu dem rechts gezeichneten Mann viel größer
ist als die Rinder in dem Parisurteilbild im Verhältnis zu den menschlichen Figuren,
und dies, obwohl es im Hintergrund erscheint. Ganz allein steht es in steifer Haltung
in einer weiten Landschaft. Im Vordergrund sehen wir links eine Figur auf einer Art
Tisch, vor dem eine Art Säulenstumpf am Boden steht. Nur eine Götterstatue und
ein Altar vor ihr können gemeint sein. Rechts erscheint ein einzelner Mann, der eine
Hand zu dem Götterbild erhebt. Das alles deutet auf eine Darstellung des trojanischen
Pferdes hin. Der Mann rechts wäre dann Sinon, der sich nach dem listigen Rat des
Odysseus bei dem Pferd verstecken sollte und hier vielleicht noch ein letztes Gebet
um Gelingen des Planes an die Gottheit richtet. Diese Gottheit müßte Athena sein,
der das Pferd geweiht ward und der Sinon nach dem Lügengespinst des Odysseus
geopfert werden sollte. Man kann der Versuchung nur schwer widerstehen, in der
niedrigen Buschgruppe auf dem Hügel im Hintergrund, zu der sich der Weg links
hinschlängelt, die zinnenreiche Stadtmauer Trojas zu vermuten, wie sie zum Beispiel
auf einem pompejanischen Gemälde mit der Darstellung des hölzernen Pferdes144
erscheint.
Eine ganze Reihe von Darstellungen der Sage vom hölzernen Pferd ist uns be-
kannt, auf Wandgemälden, Sarkophagen, Reliefs und Münzen145. Allerdings wird
Sarkophagrelief Rom, Villa Medici. K241b: Repliken von K 241 in Palestrina, Ostia u.
Rom, Lateran. K 242: Sarkophagrelief Rom, Villa Pamphili u. Ince, Blundell Hall. K 243:
Sarkophag Paris, Louvre. K 244: Sarkophag Paris, Louvre. K 246: Sarkophagdeckel
Florenz, Pal. Riccardi. K 247: Sarkophagfrgt. London, Soane Mus. K 271: Wandmalerei
im Mausoleum 3> unter S. Pietro in Rom: Toynbee-Ward Perkins, The Shrine of St. Peter
(1956) 80. Nicht bei Clairmont: Nischenmalerei in einem Grab der Isola Sacra bei Ostia:
Calza, La necropoli del Porto di Roma nell' Isola Sacra (1940) 118f. Nr. 80.
141 P. S. e F. Bartoli a. O. 63.
142 Eisler a. O. 172.
143 Vgl. Rodenwaldt a. O. 4 ff. Brit. Mus. Cat., Hinks, Paintings 48 Nr. 72 a.
144 Neapel, Mus. Naz. G. E. Rizzo, La pittura ellenistico-romana (1929) Taf. 55.
146 Vgl. L. v. Urlichs, 14. Pr. v. Wagner. Kunstinst. 1881. A. Maiuri, La Casa di