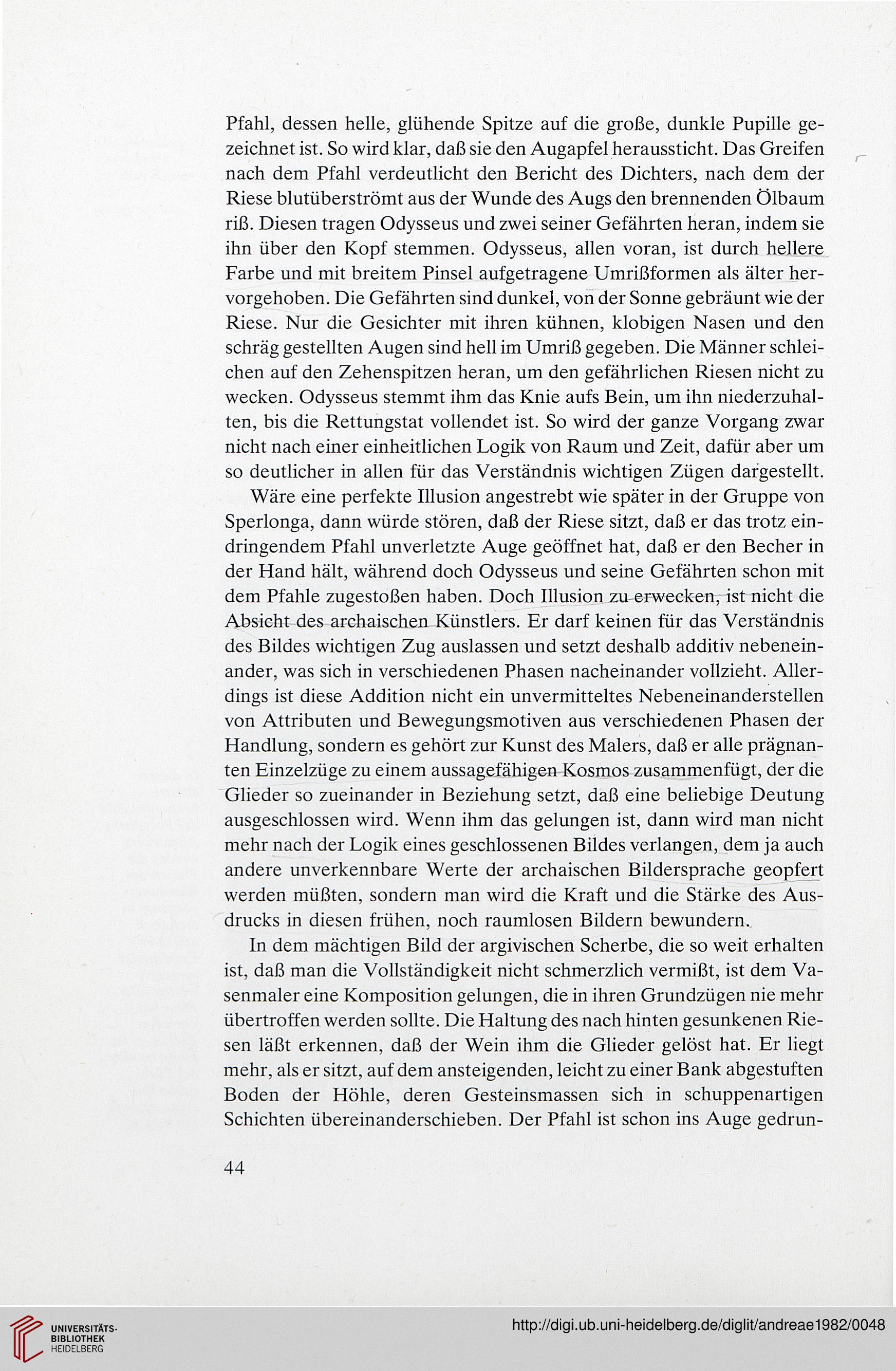Pfahl, dessen helle, glühende Spitze auf die große, dunkle Pupille ge-
zeichnet ist. So wird klar, daß sie den Augapfel heraussticht. Das Greifen
nach dem Pfahl verdeutlicht den Bericht des Dichters, nach dem der
Riese blutüberströmt aus der Wunde des Augs den brennenden Ölbaum
riß. Diesen tragen Odysseus und zwei seiner Gefährten heran, indem sie
ihn über den Kopf stemmen. Odysseus, allen voran, ist durch hellere
Farbe und mit breitem Pinsel aufgetragene Umrißformen als älter her-
vorgehoben. Die Gefährten sind dunkel, von der Sonne gebräunt wie der
Riese. Nur die Gesichter mit ihren kühnen, klobigen Nasen und den
schräg gestellten Augen sind hell im Umriß gegeben. Die Männer schlei-
chen auf den Zehenspitzen heran, um den gefährlichen Riesen nicht zu
wecken. Odysseus stemmt ihm das Knie aufs Bein, um ihn niederzuhal-
ten, bis die Rettungstat vollendet ist. So wird der ganze Vorgang zwar
nicht nach einer einheitlichen Logik von Raum und Zeit, dafür aber um
so deutlicher in allen für das Verständnis wichtigen Zügen dargestellt.
Wäre eine perfekte Illusion angestrebt wie später in der Gruppe von
Sperlonga, dann würde stören, daß der Riese sitzt, daß er das trotz ein-
dringendem Pfahl unverletzte Auge geöffnet hat, daß er den Becher in
der Hand hält, während doch Odysseus und seine Gefährten schon mit
dem Pfahle zugestoßen haben. Doch Illusion zu erwecken, ist nicht die
Absicht des archaischen Künstlers. Er darf keinen für das Verständnis
des Bildes wichtigen Zug auslassen und setzt deshalb additiv nebenein-
ander, was sich in verschiedenen Phasen nacheinander vollzieht. Aller-
dings ist diese Addition nicht ein unvermitteltes Nebeneinanderstellen
von Attributen und Bewegungsmotiven aus verschiedenen Phasen der
Handlung, sondern es gehört zur Kunst des Malers, daß er alle prägnan-
ten Einzelzüge zu einem aussagefähigen Kosmos zusammenfügt, der die
Glieder so zueinander in Beziehung setzt, daß eine beliebige Deutung
ausgeschlossen wird. Wenn ihm das gelungen ist, dann wird man nicht
mehr nach der Logik eines geschlossenen Bildes verlangen, dem ja auch
andere unverkennbare Werte der archaischen Bildersprache geopfert
werden müßten, sondern man wird die Kraft und die Stärke des Aus-
drucks in diesen frühen, noch raumlosen Bildern bewundern.
In dem mächtigen Bild der argivischen Scherbe, die so weit erhalten
ist, daß man die Vollständigkeit nicht schmerzlich vermißt, ist dem Va-
senmaler eine Komposition gelungen, die in ihren Grundzügen nie mehr
übertroffen werden sollte. Die Haltung des nach hinten gesunkenen Rie-
sen läßt erkennen, daß der Wein ihm die Glieder gelöst hat. Er liegt
mehr, als er sitzt, auf dem ansteigenden, leicht zu einer Bank abgestuften
Boden der Höhle, deren Gesteinsmassen sich in schuppenartigen
Schichten übereinanderschieben. Der Pfahl ist schon ins Auge gedrun-
44
zeichnet ist. So wird klar, daß sie den Augapfel heraussticht. Das Greifen
nach dem Pfahl verdeutlicht den Bericht des Dichters, nach dem der
Riese blutüberströmt aus der Wunde des Augs den brennenden Ölbaum
riß. Diesen tragen Odysseus und zwei seiner Gefährten heran, indem sie
ihn über den Kopf stemmen. Odysseus, allen voran, ist durch hellere
Farbe und mit breitem Pinsel aufgetragene Umrißformen als älter her-
vorgehoben. Die Gefährten sind dunkel, von der Sonne gebräunt wie der
Riese. Nur die Gesichter mit ihren kühnen, klobigen Nasen und den
schräg gestellten Augen sind hell im Umriß gegeben. Die Männer schlei-
chen auf den Zehenspitzen heran, um den gefährlichen Riesen nicht zu
wecken. Odysseus stemmt ihm das Knie aufs Bein, um ihn niederzuhal-
ten, bis die Rettungstat vollendet ist. So wird der ganze Vorgang zwar
nicht nach einer einheitlichen Logik von Raum und Zeit, dafür aber um
so deutlicher in allen für das Verständnis wichtigen Zügen dargestellt.
Wäre eine perfekte Illusion angestrebt wie später in der Gruppe von
Sperlonga, dann würde stören, daß der Riese sitzt, daß er das trotz ein-
dringendem Pfahl unverletzte Auge geöffnet hat, daß er den Becher in
der Hand hält, während doch Odysseus und seine Gefährten schon mit
dem Pfahle zugestoßen haben. Doch Illusion zu erwecken, ist nicht die
Absicht des archaischen Künstlers. Er darf keinen für das Verständnis
des Bildes wichtigen Zug auslassen und setzt deshalb additiv nebenein-
ander, was sich in verschiedenen Phasen nacheinander vollzieht. Aller-
dings ist diese Addition nicht ein unvermitteltes Nebeneinanderstellen
von Attributen und Bewegungsmotiven aus verschiedenen Phasen der
Handlung, sondern es gehört zur Kunst des Malers, daß er alle prägnan-
ten Einzelzüge zu einem aussagefähigen Kosmos zusammenfügt, der die
Glieder so zueinander in Beziehung setzt, daß eine beliebige Deutung
ausgeschlossen wird. Wenn ihm das gelungen ist, dann wird man nicht
mehr nach der Logik eines geschlossenen Bildes verlangen, dem ja auch
andere unverkennbare Werte der archaischen Bildersprache geopfert
werden müßten, sondern man wird die Kraft und die Stärke des Aus-
drucks in diesen frühen, noch raumlosen Bildern bewundern.
In dem mächtigen Bild der argivischen Scherbe, die so weit erhalten
ist, daß man die Vollständigkeit nicht schmerzlich vermißt, ist dem Va-
senmaler eine Komposition gelungen, die in ihren Grundzügen nie mehr
übertroffen werden sollte. Die Haltung des nach hinten gesunkenen Rie-
sen läßt erkennen, daß der Wein ihm die Glieder gelöst hat. Er liegt
mehr, als er sitzt, auf dem ansteigenden, leicht zu einer Bank abgestuften
Boden der Höhle, deren Gesteinsmassen sich in schuppenartigen
Schichten übereinanderschieben. Der Pfahl ist schon ins Auge gedrun-
44