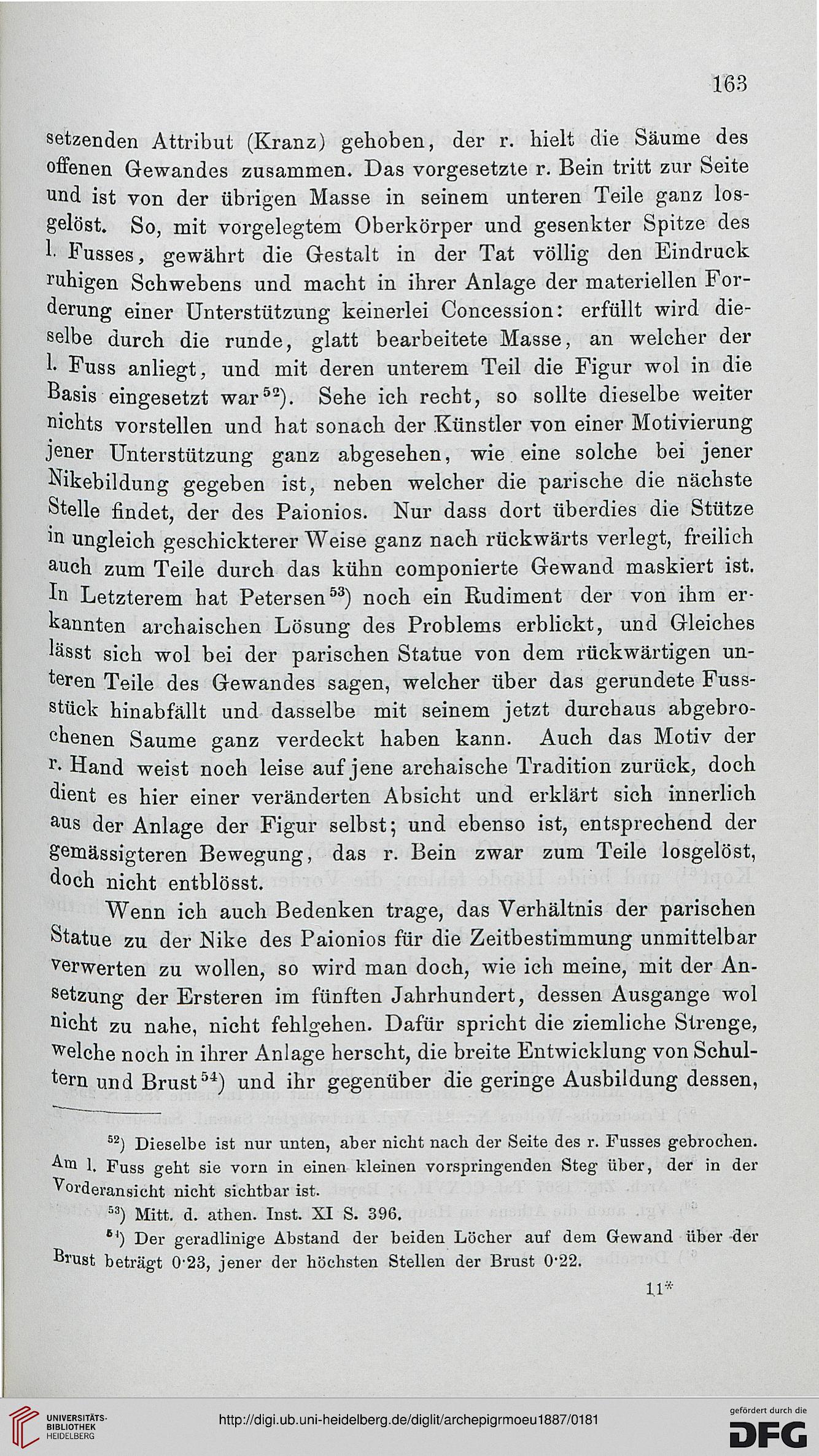163
setzenden Attribut (Kranz) gehoben, der r. hielt die Säume des
offenen Gewandes zusammen. Das vorgesetzte r. Bein tritt zur Seite
und ist von der übrigen Masse in seinem unteren Teile ganz los-
gelöst. So, mit vorgelegtem Oberkörper und gesenkter Spitze des
»'■ Fusses, gewährt die Gestalt in der Tat völlig den Eindruck
ruhigen Schwebens und macht in ihrer Anlage der materiellen For-
derung einer Unterstützung keinerlei Concession: erfüllt wird die-
selbe durch die runde, glatt bearbeitete Masse, an welcher der
Fuss anliegt, und mit deren unterem Teil die Figur wol in die
Basis eingesetzt war52). Sehe ich recht, so sollte dieselbe weiter
nichts vorstellen und hat sonach der Künstler von einer Motivierung
Jener Unterstützung ganz abgesehen, wie eine solche bei jener
Nikebildung gegeben ist, neben welcher die parische die nächste
Stelle findet, der des Paionios. Nur dass dort überdies die Stütze
lri ungleich geschickterer Weise ganz nach rückwärts verlegt, freilich
auch zum Teile durch das kühn componierte Gewand maskiert ist.
In Letzterem hat Petersen53) noch ein Rudiment der von ihm er-
kannten archaischen Lösung des Problems erblickt, und Gleiches
lässt sich wol bei der parischen Statue von dem rückwärtigen un-
teren Teile des Gewandes sagen, welcher über das gerundete Fuss-
stück hinabfällt und dasselbe mit seinem jetzt durchaus abgebro-
chenen Saume ganz verdeckt haben kann. Auch das Motiv der
r- Hand weist noch leise auf jene archaische Tradition zurück, doch
dient es hier einer veränderten Absicht und erklärt sich innerlich
aus der Anlage der Figur selbst; und ebenso ist, entsprechend der
gernässigteren Bewegung, das r. Bein zwar zum Teile losgelöst,
doch nicht entblösst.
Wenn ich auch Bedenken trage, das Verhältnis der parischen
Statue zu der Nike des Paionios für die Zeitbestimmung unmittelbar
verwerten zu wollen, so wird man doch, wie ich meine, mit der An-
setzung der Ersteren im fünften Jahrhundert, dessen Ausgange wol
nicht zu nahe, nicht fehlgehen. Dafür spricht die ziemliche Strenge,
welche noch in ihrer Anlage herscht, die breite Entwicklung von Schul-
tern und Brust54) und ihr gegenüber die geringe Ausbildung dessen,
52) Dieselbe ist nur unten, aber nicht nach der Seite des r. Fusses gebrochen.
Am 1. Fuss geht sie vorn in einen kleinen vorspringenden Steg über, der in der
Vorderansicht nicht sichtbar ist.
53) Mitt. d. athen. Inst. XI S. 396.
*() Der geradlinige Abstand der beiden Löcher auf dem Gewand über der
Brust beträgt 0 23, jener der höchsten Stellen der Brust 0-22.
11*
setzenden Attribut (Kranz) gehoben, der r. hielt die Säume des
offenen Gewandes zusammen. Das vorgesetzte r. Bein tritt zur Seite
und ist von der übrigen Masse in seinem unteren Teile ganz los-
gelöst. So, mit vorgelegtem Oberkörper und gesenkter Spitze des
»'■ Fusses, gewährt die Gestalt in der Tat völlig den Eindruck
ruhigen Schwebens und macht in ihrer Anlage der materiellen For-
derung einer Unterstützung keinerlei Concession: erfüllt wird die-
selbe durch die runde, glatt bearbeitete Masse, an welcher der
Fuss anliegt, und mit deren unterem Teil die Figur wol in die
Basis eingesetzt war52). Sehe ich recht, so sollte dieselbe weiter
nichts vorstellen und hat sonach der Künstler von einer Motivierung
Jener Unterstützung ganz abgesehen, wie eine solche bei jener
Nikebildung gegeben ist, neben welcher die parische die nächste
Stelle findet, der des Paionios. Nur dass dort überdies die Stütze
lri ungleich geschickterer Weise ganz nach rückwärts verlegt, freilich
auch zum Teile durch das kühn componierte Gewand maskiert ist.
In Letzterem hat Petersen53) noch ein Rudiment der von ihm er-
kannten archaischen Lösung des Problems erblickt, und Gleiches
lässt sich wol bei der parischen Statue von dem rückwärtigen un-
teren Teile des Gewandes sagen, welcher über das gerundete Fuss-
stück hinabfällt und dasselbe mit seinem jetzt durchaus abgebro-
chenen Saume ganz verdeckt haben kann. Auch das Motiv der
r- Hand weist noch leise auf jene archaische Tradition zurück, doch
dient es hier einer veränderten Absicht und erklärt sich innerlich
aus der Anlage der Figur selbst; und ebenso ist, entsprechend der
gernässigteren Bewegung, das r. Bein zwar zum Teile losgelöst,
doch nicht entblösst.
Wenn ich auch Bedenken trage, das Verhältnis der parischen
Statue zu der Nike des Paionios für die Zeitbestimmung unmittelbar
verwerten zu wollen, so wird man doch, wie ich meine, mit der An-
setzung der Ersteren im fünften Jahrhundert, dessen Ausgange wol
nicht zu nahe, nicht fehlgehen. Dafür spricht die ziemliche Strenge,
welche noch in ihrer Anlage herscht, die breite Entwicklung von Schul-
tern und Brust54) und ihr gegenüber die geringe Ausbildung dessen,
52) Dieselbe ist nur unten, aber nicht nach der Seite des r. Fusses gebrochen.
Am 1. Fuss geht sie vorn in einen kleinen vorspringenden Steg über, der in der
Vorderansicht nicht sichtbar ist.
53) Mitt. d. athen. Inst. XI S. 396.
*() Der geradlinige Abstand der beiden Löcher auf dem Gewand über der
Brust beträgt 0 23, jener der höchsten Stellen der Brust 0-22.
11*