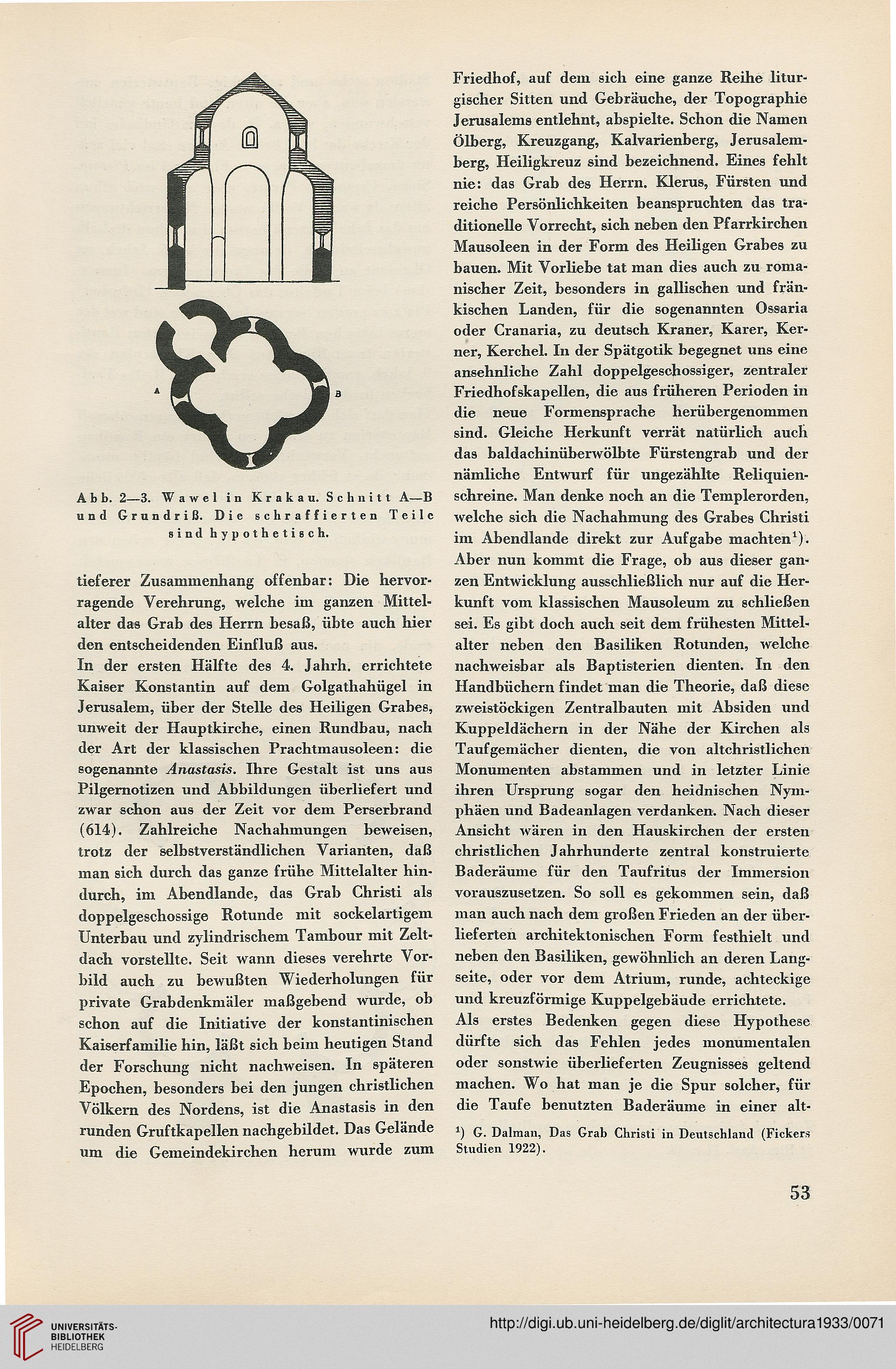<>
Abb. 2—3. Wawel in Krakau. Schnitt A—B
und Grundriß. Die schraffierten Teile
sind hypothetisch.
tieferer Zusammenhang offenbar: Die hervor-
ragende Verehrung, welche im ganzen Mittel-
alter das Grab des Herrn besaß, übte auch hier
den entscheidenden Einfluß aus.
In der ersten Hälfte des 4. Jahrh. errichtete
Kaiser Konstantin auf dem Golgathahügel in
Jerusalem, über der Stelle des Heiligen Grabes,
unweit der Hauptkirche, einen Rundbau, nach
der Art der klassischen Prachtmausoleen: die
sogenannte Anastasis. Ihre Gestalt ist uns aus
Pilgernotizen und Abbildungen überliefert und
zwar schon aus der Zeit vor dem Perserbrand
(614). Zahlreiche Nachahmungen beweisen,
trotz der selbstverständlichen Varianten, daß
man sich durch das ganze frühe Mittelalter hin-
durch, im Abendlande, das Grab Christi als
doppelgeschossige Rotunde mit sockelartigem
Unterbau und zylindrischem Tambour mit Zelt-
dach vorstellte. Seit wann dieses verehrte Vor-
bild auch zu bewußten Wiederholungen für
private Grabdenkmäler maßgebend wurde, ob
schon auf die Initiative der konstantinischen
Kaiserfamilie hin, läßt sich beim heutigen Stand
der Forschung nicht nachweisen. In späteren
Epochen, besonders bei den jungen christlichen
Völkern des Nordens, ist die Anastasis in den
runden Gruftkapellen nachgebildet. Das Gelände
um die Gemeindekirchen herum wurde zum
Friedhof, auf dem sich eine ganze Reihe litur-
gischer Sitten und Gebräuche, der Topographie
Jerusalems entlehnt, abspielte. Schon die Namen
Ölberg, Kreuzgang, Kalvarienberg, Jerusalem-
berg, Heiligkreuz sind bezeichnend. Eines fehlt
nie: das Grab des Herrn. Klerus, Fürsten und
reiche Persönlichkeiten beanspruchten das tra-
ditionelle Vorrecht, sich neben den Pfarrkirchen
Mausoleen in der Form des Heiligen Grabes zu
bauen. Mit Vorliebe tat man dies auch zu roma-
nischer Zeit, besonders in gallischen und frän-
kischen Landen, für die sogenannten Ossaria
oder Cranaria, zu deutsch Kraner, Karer, Ker-
ner, Kerchel. In der Spätgotik begegnet uns eine
ansehnliche Zahl doppelgeschossiger, zentraler
Friedhofskapellen, die aus früheren Perioden in
die neue Formensprache herübergenommen
sind. Gleiche Herkunft verrät natürlich auch
das baldachinüberwölbte Fürstengrab und der
nämliche Entwurf für ungezählte Reliquien-
schreine. Man denke noch an die Templerorden,
welche sich die Nachahmung des Grabes Christi
im Abendlande direkt zur Aufgabe machten1).
Aber nun kommt die Frage, ob aus dieser gan-
zen Entwicklung ausschließlich nur auf die Her-
kunft vom klassischen Mausoleum zu schließen
sei. Es gibt doch auch seit dem frühesten Mittel-
alter neben den Basiliken Rotunden, welche
nachweisbar als Baptisterien dienten. In den
Handbüchern findet man die Theorie, daß diese
zweistöckigen Zentralbauten mit Absiden und
Kuppeldächern in der Nähe der Kirchen als
Tauf gemacher dienten, die von altchristlichcn
Monumenten abstammen und in letzter Linie
ihren Ursprung sogar den heidnischen Nym-
phäen und Badeanlagen verdanken. Nach dieser
Ansicht wären in den Hauskirchen der ersten
christlichen Jahrhunderte zentral konstruierte
Baderäume für den Taufritus der Immersion
vorauszusetzen. So soll es gekommen sein, daß
man auch nach dem großen Frieden an der über-
lieferten architektonischen Form festhielt und
neben den Basiliken, gewöhnlich an deren Lang-
seite, oder vor dem Atrium, runde, achteckige
und kreuzförmige Kuppelgebäude errichtete.
Als erstes Bedenken gegen diese Hypothese
dürfte sich das Fehlen jedes monumentalen
oder sonstwie überlieferten Zeugnisses geltend
machen. Wo hat man je die Spur solcher, für
die Taufe benutzten Baderäume in einer alt-
*) G. Dalman, Das Grab Christi in Deutschland (Fickers
Studien 1922).
53
Abb. 2—3. Wawel in Krakau. Schnitt A—B
und Grundriß. Die schraffierten Teile
sind hypothetisch.
tieferer Zusammenhang offenbar: Die hervor-
ragende Verehrung, welche im ganzen Mittel-
alter das Grab des Herrn besaß, übte auch hier
den entscheidenden Einfluß aus.
In der ersten Hälfte des 4. Jahrh. errichtete
Kaiser Konstantin auf dem Golgathahügel in
Jerusalem, über der Stelle des Heiligen Grabes,
unweit der Hauptkirche, einen Rundbau, nach
der Art der klassischen Prachtmausoleen: die
sogenannte Anastasis. Ihre Gestalt ist uns aus
Pilgernotizen und Abbildungen überliefert und
zwar schon aus der Zeit vor dem Perserbrand
(614). Zahlreiche Nachahmungen beweisen,
trotz der selbstverständlichen Varianten, daß
man sich durch das ganze frühe Mittelalter hin-
durch, im Abendlande, das Grab Christi als
doppelgeschossige Rotunde mit sockelartigem
Unterbau und zylindrischem Tambour mit Zelt-
dach vorstellte. Seit wann dieses verehrte Vor-
bild auch zu bewußten Wiederholungen für
private Grabdenkmäler maßgebend wurde, ob
schon auf die Initiative der konstantinischen
Kaiserfamilie hin, läßt sich beim heutigen Stand
der Forschung nicht nachweisen. In späteren
Epochen, besonders bei den jungen christlichen
Völkern des Nordens, ist die Anastasis in den
runden Gruftkapellen nachgebildet. Das Gelände
um die Gemeindekirchen herum wurde zum
Friedhof, auf dem sich eine ganze Reihe litur-
gischer Sitten und Gebräuche, der Topographie
Jerusalems entlehnt, abspielte. Schon die Namen
Ölberg, Kreuzgang, Kalvarienberg, Jerusalem-
berg, Heiligkreuz sind bezeichnend. Eines fehlt
nie: das Grab des Herrn. Klerus, Fürsten und
reiche Persönlichkeiten beanspruchten das tra-
ditionelle Vorrecht, sich neben den Pfarrkirchen
Mausoleen in der Form des Heiligen Grabes zu
bauen. Mit Vorliebe tat man dies auch zu roma-
nischer Zeit, besonders in gallischen und frän-
kischen Landen, für die sogenannten Ossaria
oder Cranaria, zu deutsch Kraner, Karer, Ker-
ner, Kerchel. In der Spätgotik begegnet uns eine
ansehnliche Zahl doppelgeschossiger, zentraler
Friedhofskapellen, die aus früheren Perioden in
die neue Formensprache herübergenommen
sind. Gleiche Herkunft verrät natürlich auch
das baldachinüberwölbte Fürstengrab und der
nämliche Entwurf für ungezählte Reliquien-
schreine. Man denke noch an die Templerorden,
welche sich die Nachahmung des Grabes Christi
im Abendlande direkt zur Aufgabe machten1).
Aber nun kommt die Frage, ob aus dieser gan-
zen Entwicklung ausschließlich nur auf die Her-
kunft vom klassischen Mausoleum zu schließen
sei. Es gibt doch auch seit dem frühesten Mittel-
alter neben den Basiliken Rotunden, welche
nachweisbar als Baptisterien dienten. In den
Handbüchern findet man die Theorie, daß diese
zweistöckigen Zentralbauten mit Absiden und
Kuppeldächern in der Nähe der Kirchen als
Tauf gemacher dienten, die von altchristlichcn
Monumenten abstammen und in letzter Linie
ihren Ursprung sogar den heidnischen Nym-
phäen und Badeanlagen verdanken. Nach dieser
Ansicht wären in den Hauskirchen der ersten
christlichen Jahrhunderte zentral konstruierte
Baderäume für den Taufritus der Immersion
vorauszusetzen. So soll es gekommen sein, daß
man auch nach dem großen Frieden an der über-
lieferten architektonischen Form festhielt und
neben den Basiliken, gewöhnlich an deren Lang-
seite, oder vor dem Atrium, runde, achteckige
und kreuzförmige Kuppelgebäude errichtete.
Als erstes Bedenken gegen diese Hypothese
dürfte sich das Fehlen jedes monumentalen
oder sonstwie überlieferten Zeugnisses geltend
machen. Wo hat man je die Spur solcher, für
die Taufe benutzten Baderäume in einer alt-
*) G. Dalman, Das Grab Christi in Deutschland (Fickers
Studien 1922).
53