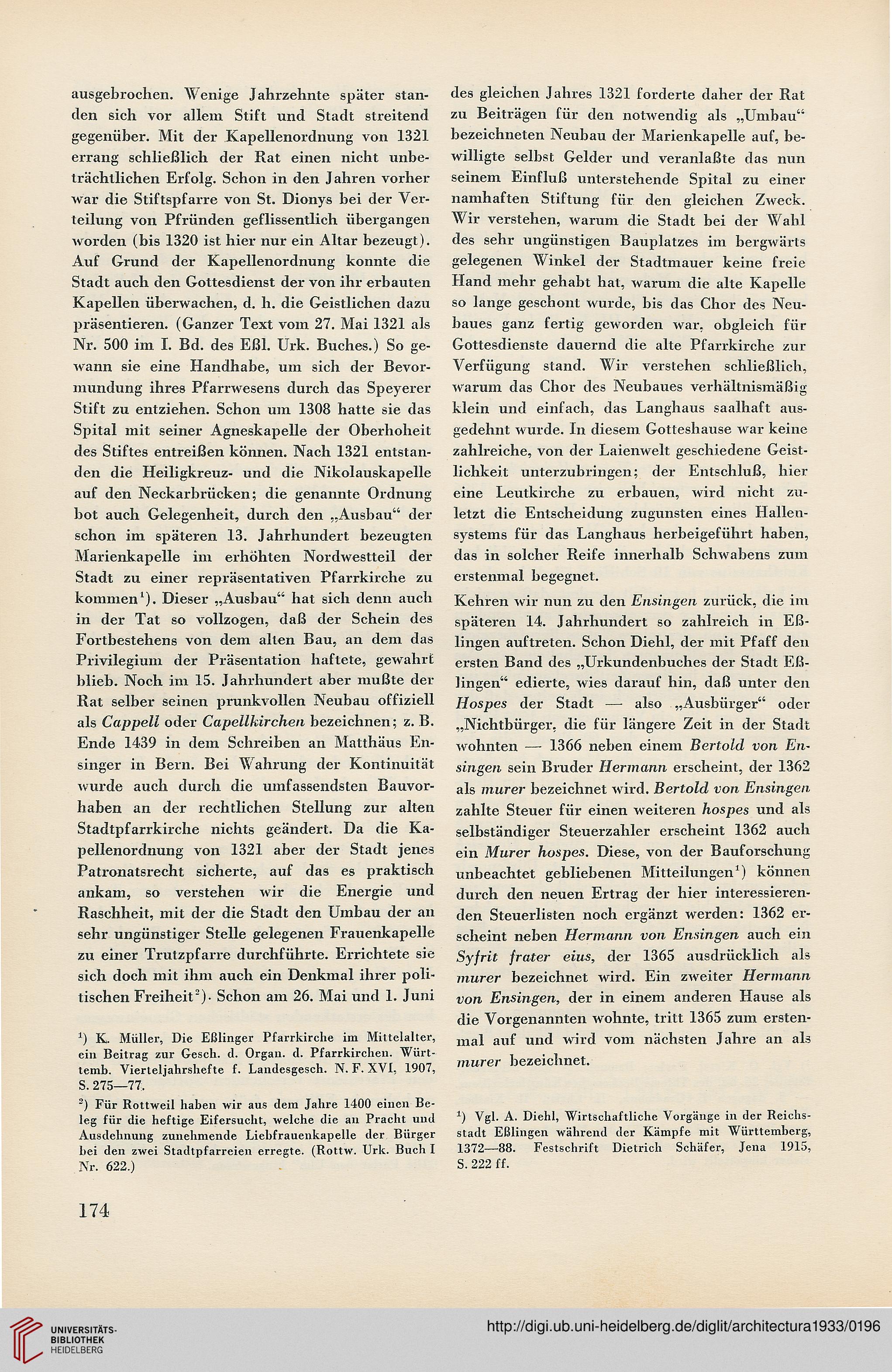ausgebrochen. Wenige Jahrzehnte später stan-
den sich vor allem Stift und Stadt streitend
gegenüber. Mit der Kapellenordnung von 1321
errang schließlich der Rat einen nicht unbe-
trächtlichen Erfolg. Schon in den Jahren vorher
war die Stiftspfarre von St. Dionys bei der Ver-
teilung von Pfründen geflissentlich übergangen
worden (bis 1320 ist hier nur ein Altar bezeugt).
Auf Grund der Kapellenordnung konnte die
Stadt auch den Gottesdienst der von ihr erbauten
Kapellen überwachen, d. h. die Geistlichen dazu
präsentieren. (Ganzer Text vom 27. Mai 1321 als
Nr. 500 im I. Bd. des Eßl. Urk. Buches.) So ge-
wann sie eine Handhabe, um sich der Bevor-
mundung ihres Pfarrwesens durch das Speyerer
Stift zu entziehen. Schon um 1308 hatte sie das
Spital mit seiner Agneskapelle der Oberhoheit
des Stiftes entreißen können. Nach 1321 entstan-
den die Heiligkreuz- und die Nikolauskapelle
auf den Neckarbrücken; die genannte Ordnung
bot auch Gelegenheit, durch den „Ausbau" der
schon im späteren 13. Jahrhundert, bezeugten
Marienkapelle im erhöhten Nordwestteil der
Stadt zu einer repräsentativen Pfarrkirche zu
kommen1). Dieser „Ausbau" hat sich denn auch
in der Tat so vollzogen, daß der Schein des
Fortbestehens von dem alten Bau, an dem das
Privilegium der Präsentation haftete, gewahrt
blieb. Noch im 15. Jahrhundert aber mußte der
Rat selber seinen prunkvollen Neubau offiziell
als Cappell oder Capellkircheu bezeichnen; z. B.
Ende 1439 in dem Schreiben an Matthäus En-
singer in Bern. Bei Wahrung der Kontinuität
wurde auch durch die umfassendsten Bauvor-
haben an der rechtlichen Stellung zur alten
Stadtpfarrkirche nichts geändert. Da die Ka-
pellenordnung von 1321 aber der Stadt jenes
Patronatsx*echt sicherte, auf das es praktisch
ankam, so verstehen wir die Energie und
Raschheit, mit der die Stadt den Umbau der an
sehr ungünstiger Stelle gelegenen Frauenkapelle
zu einer Trutzpfarre durchführte. Errichtete sie
sich doch mit ihm auch ein Denkmal ihrer poli-
tischen Freiheit2)- Schon am 26. Mai und 1. Juni
des gleichen Jahres 1321 forderte daher der Rat
zu Beiträgen für den notwendig als „Umbau"
bezeichneten Neubau der Marienkapelle auf, be-
willigte selbst Gelder und veranlaßte das nun
seinem Einfluß unterstehende Spital zu einer
namhaften Stiftung für den gleichen Zweck.
Wir verstehen, warum die Stadt bei der Wahl
des sehr ungünstigen Bauplatzes im bergwärts
gelegenen Winkel der Stadtmauer keine freie
Hand mehr gehabt hat, warum die alte Kapelle
so lange geschont wurde, bis das Chor des Neu-
baues ganz fertig geworden war, obgleich für
Gottesdienste dauernd die alte Pfarrkirche zur
Verfügung stand. Wir verstehen schließlich,
warum das Chor des Neubaues verhältnismäßig
klein und einfach, das Langhaus saalhaft avis-
gedehnt wurde. In diesem Gotteshause war keine
zahlreiche, von der Laienwelt geschiedene Geist-
lichkeit unterzubringen; der Entschluß, hier
eine Leutkirche zu erbauen, wird nicht zu-
letzt die Entscheidung zugunsten eines Halle u-
systems für das Langhaus herbeigeführt haben,
das in solcher Reife innerhalb Schwabens zum
erstenmal begegnet.
Kehren wir nun zu den Ensingen zurück, die im
späteren 14. Jahrhundert so zahlreich in Eß-
lingen auftreten. Schon Diehl, der mit Pfaff den
ersten Band des „Urkundenbuches der Stadt Eß-
lingen" edierte, wies darauf hin, daß unter den
Hospes der Stadt — also „Ausbürger" oder
„Nichtbürger, die für längere Zeit in der Stadt
wohnten —- 1366 neben einem Bertold von En-
singen sein Bruder Hermann erscheint, der 1362
als murer bezeichnet wird. Bertold von Ensingen
zahlte Steuer für einen weiteren hospes und als
selbständiger Steuerzahler erscheint 1362 auch
ein Murer hospes. Diese, von der Bauforschung
unbeachtet gebliebenen Mitteilungen1) können
durch den neuen Ertrag der hier interessieren-
den Steuerlisten noch ergänzt werden: 1362 er-
scheint neben Hermann von Ensingen auch ein
Syfrit frater eins, der 1365 ausdrücklich als
murer bezeichnet wird. Ein zweiter Hermann
von Ensingen, der in einem anderen Hause als
die Vorgenannten wohnte, tritt 1365 zum ersten-
mal auf und wird vom nächsten Jahre an als
murer bezeichnet.
*) Vgl. A. Diehl, Wirtschaftliche Vorgänge in der Reichs-
stadt Eßlingen während der Kämpfe mit Württemberg,
1372—88. Festschrift Dietrich Schäfer, Jena 1915,
S. 222 ff.
') K. Müller, Die Eßlinger Pfarrkirche im Mittelalter,
ein Beitrag zur Gesch. d. Organ, d. Pfarrkirchen. Wiirt-
temb. Vierleljahrshefte f. Landesgesch. N. F. XVI, 1907,
S. 275—77.
~) Für Rottweil haben wir aus dem Jahre 1400 einen Be-
leg für die heftige Eifersucht, welche die an Pracht und
Ausdehnung zunehmende Liebfrauenkapelle der Bürger
bei den zwei Stadtpfarreien erregte. (Rottw. Urk. Buch I
Nr. 622.)
174
den sich vor allem Stift und Stadt streitend
gegenüber. Mit der Kapellenordnung von 1321
errang schließlich der Rat einen nicht unbe-
trächtlichen Erfolg. Schon in den Jahren vorher
war die Stiftspfarre von St. Dionys bei der Ver-
teilung von Pfründen geflissentlich übergangen
worden (bis 1320 ist hier nur ein Altar bezeugt).
Auf Grund der Kapellenordnung konnte die
Stadt auch den Gottesdienst der von ihr erbauten
Kapellen überwachen, d. h. die Geistlichen dazu
präsentieren. (Ganzer Text vom 27. Mai 1321 als
Nr. 500 im I. Bd. des Eßl. Urk. Buches.) So ge-
wann sie eine Handhabe, um sich der Bevor-
mundung ihres Pfarrwesens durch das Speyerer
Stift zu entziehen. Schon um 1308 hatte sie das
Spital mit seiner Agneskapelle der Oberhoheit
des Stiftes entreißen können. Nach 1321 entstan-
den die Heiligkreuz- und die Nikolauskapelle
auf den Neckarbrücken; die genannte Ordnung
bot auch Gelegenheit, durch den „Ausbau" der
schon im späteren 13. Jahrhundert, bezeugten
Marienkapelle im erhöhten Nordwestteil der
Stadt zu einer repräsentativen Pfarrkirche zu
kommen1). Dieser „Ausbau" hat sich denn auch
in der Tat so vollzogen, daß der Schein des
Fortbestehens von dem alten Bau, an dem das
Privilegium der Präsentation haftete, gewahrt
blieb. Noch im 15. Jahrhundert aber mußte der
Rat selber seinen prunkvollen Neubau offiziell
als Cappell oder Capellkircheu bezeichnen; z. B.
Ende 1439 in dem Schreiben an Matthäus En-
singer in Bern. Bei Wahrung der Kontinuität
wurde auch durch die umfassendsten Bauvor-
haben an der rechtlichen Stellung zur alten
Stadtpfarrkirche nichts geändert. Da die Ka-
pellenordnung von 1321 aber der Stadt jenes
Patronatsx*echt sicherte, auf das es praktisch
ankam, so verstehen wir die Energie und
Raschheit, mit der die Stadt den Umbau der an
sehr ungünstiger Stelle gelegenen Frauenkapelle
zu einer Trutzpfarre durchführte. Errichtete sie
sich doch mit ihm auch ein Denkmal ihrer poli-
tischen Freiheit2)- Schon am 26. Mai und 1. Juni
des gleichen Jahres 1321 forderte daher der Rat
zu Beiträgen für den notwendig als „Umbau"
bezeichneten Neubau der Marienkapelle auf, be-
willigte selbst Gelder und veranlaßte das nun
seinem Einfluß unterstehende Spital zu einer
namhaften Stiftung für den gleichen Zweck.
Wir verstehen, warum die Stadt bei der Wahl
des sehr ungünstigen Bauplatzes im bergwärts
gelegenen Winkel der Stadtmauer keine freie
Hand mehr gehabt hat, warum die alte Kapelle
so lange geschont wurde, bis das Chor des Neu-
baues ganz fertig geworden war, obgleich für
Gottesdienste dauernd die alte Pfarrkirche zur
Verfügung stand. Wir verstehen schließlich,
warum das Chor des Neubaues verhältnismäßig
klein und einfach, das Langhaus saalhaft avis-
gedehnt wurde. In diesem Gotteshause war keine
zahlreiche, von der Laienwelt geschiedene Geist-
lichkeit unterzubringen; der Entschluß, hier
eine Leutkirche zu erbauen, wird nicht zu-
letzt die Entscheidung zugunsten eines Halle u-
systems für das Langhaus herbeigeführt haben,
das in solcher Reife innerhalb Schwabens zum
erstenmal begegnet.
Kehren wir nun zu den Ensingen zurück, die im
späteren 14. Jahrhundert so zahlreich in Eß-
lingen auftreten. Schon Diehl, der mit Pfaff den
ersten Band des „Urkundenbuches der Stadt Eß-
lingen" edierte, wies darauf hin, daß unter den
Hospes der Stadt — also „Ausbürger" oder
„Nichtbürger, die für längere Zeit in der Stadt
wohnten —- 1366 neben einem Bertold von En-
singen sein Bruder Hermann erscheint, der 1362
als murer bezeichnet wird. Bertold von Ensingen
zahlte Steuer für einen weiteren hospes und als
selbständiger Steuerzahler erscheint 1362 auch
ein Murer hospes. Diese, von der Bauforschung
unbeachtet gebliebenen Mitteilungen1) können
durch den neuen Ertrag der hier interessieren-
den Steuerlisten noch ergänzt werden: 1362 er-
scheint neben Hermann von Ensingen auch ein
Syfrit frater eins, der 1365 ausdrücklich als
murer bezeichnet wird. Ein zweiter Hermann
von Ensingen, der in einem anderen Hause als
die Vorgenannten wohnte, tritt 1365 zum ersten-
mal auf und wird vom nächsten Jahre an als
murer bezeichnet.
*) Vgl. A. Diehl, Wirtschaftliche Vorgänge in der Reichs-
stadt Eßlingen während der Kämpfe mit Württemberg,
1372—88. Festschrift Dietrich Schäfer, Jena 1915,
S. 222 ff.
') K. Müller, Die Eßlinger Pfarrkirche im Mittelalter,
ein Beitrag zur Gesch. d. Organ, d. Pfarrkirchen. Wiirt-
temb. Vierleljahrshefte f. Landesgesch. N. F. XVI, 1907,
S. 275—77.
~) Für Rottweil haben wir aus dem Jahre 1400 einen Be-
leg für die heftige Eifersucht, welche die an Pracht und
Ausdehnung zunehmende Liebfrauenkapelle der Bürger
bei den zwei Stadtpfarreien erregte. (Rottw. Urk. Buch I
Nr. 622.)
174