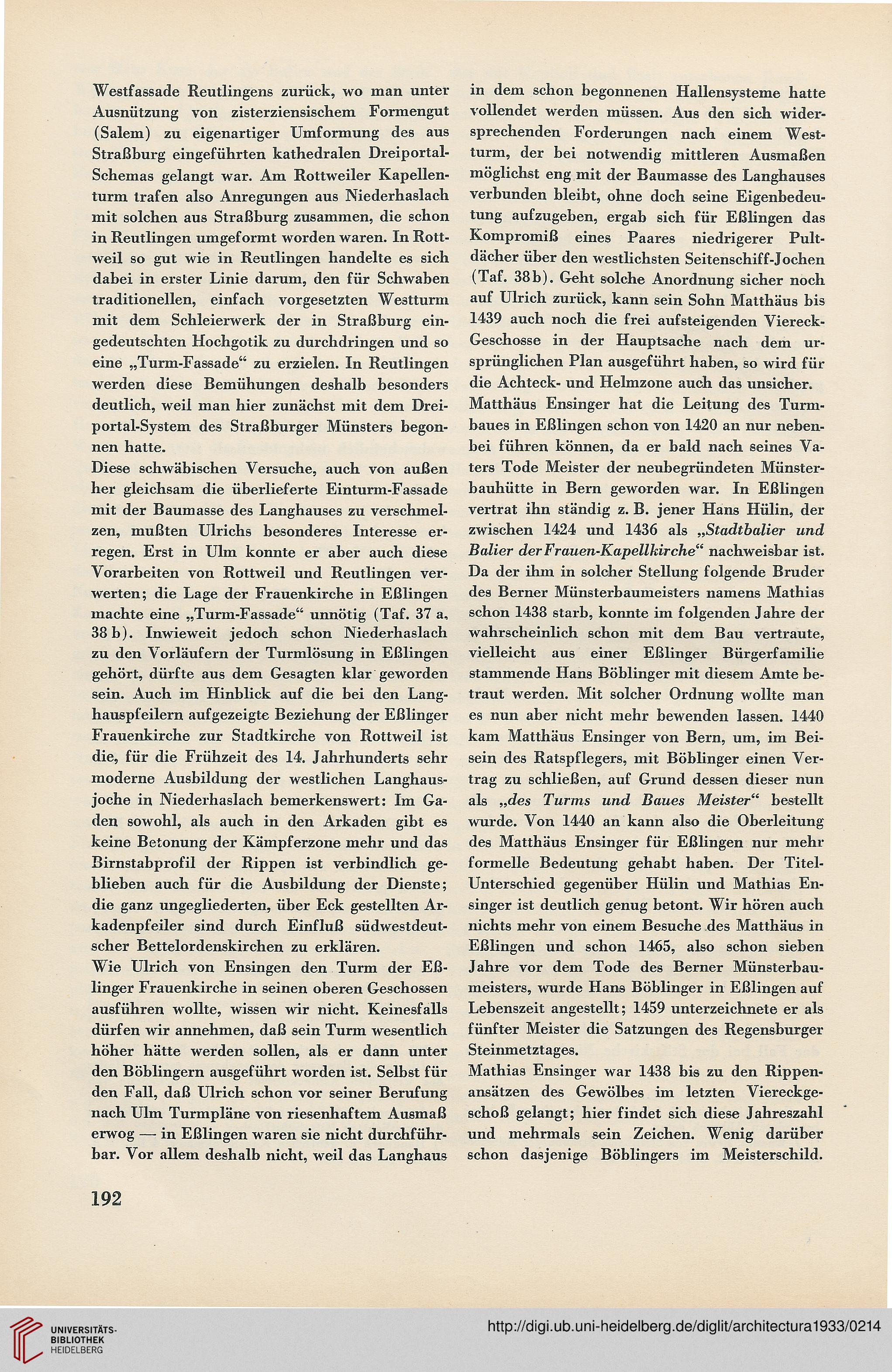Westfassade Reutlingens zurück, wo man unter
Ausnützung von zisterziensischem Formengut
(Salem) zu eigenartiger Umformung des aus
Straßburg eingeführten kathedralen Dreiportal-
Schemas gelangt war. Am Rottweiler Kapellen-
turm trafen also Anregungen aus Niederhaslach
mit solchen aus Straßburg zusammen, die schon
in Reutlingen umgeformt worden waren. In Rott-
weil so gut wie in Reutlingen handelte es sich
dabei in erster Linie darum, den für Schwaben
traditionellen, einfach vorgesetzten We3tturm
mit dem Schleierwerk der in Straßburg ein-
gedeutschten Hochgotik zu durchdringen und so
eine „Turm-Fassade" zu erzielen. In Reutlingen
werden diese Bemühungen deshalb besonders
deutlich, weil man hier zunächst mit dem Drei-
portal-System des Straßburger Münsters begon-
nen hatte.
Diese schwäbischen Versuche, auch von außen
her gleichsam die überlieferte Einturm-Fassade
mit der Baumasse des Langhauses zu verschmel-
zen, mußten Ulrichs besonderes Interesse er-
regen. Erst in Ulm konnte er aber auch diese
Vorarbeiten von Rottweil und Reutlingen ver-
werten; die Lage der Frauenkirche in Eßlingen
machte eine „Turm-Fassade" unnötig (Taf. 37 a,
38 b). Inwieweit jedoch schon Niederhaslach
zu den Vorläufern der Turmlösung in Eßlingen
gehört, dürfte aus dem Gesagten klar geworden
sein. Auch im Hinblick auf die bei den Lang-
hauspfeilern aufgezeigte Beziehung der Eßlinger
Frauenkirche zur Stadtkirche von Rottweil ist
die, für die Frühzeit des 14. Jahrhunderts sehr
moderne Ausbildung der westlichen Langhaus-
joche in Niederhaslach bemerkenswert: Im Ga-
den sowohl, als auch in den Arkaden gibt es
keine Betonung der Kämpferzone mehr und das
Birnstabprofil der Rippen ist verbindlich ge-
blieben auch für die Ausbildung der Dienste;
die ganz ungegliederten, über Eck gestellten Ar-
kadenpfeiler sind durch Einfluß südwestdeut-
scher Bettelordenskirchen zu erklären.
Wie Ulrich von Ensingen den Turm der Eß-
linger Frauenkirche in seinen oberen Geschossen
ausführen wollte, wissen wir nicht. Keinesfalls
dürfen wir annehmen, daß sein Turm wesentlich
höher hätte werden sollen, als er dann unter
den Böblingern ausgeführt worden ist. Selbst für
den Fall, daß Ulrich schon vor seiner Berufung
nach Ulm Turmpläne von riesenhaftem Ausmaß
erwog —■ in Eßlingen waren sie nicht durchführ-
bar. Vor allem deshalb nicht, weil das Langhaus
in dem schon begonnenen Hallensysteme hatte
vollendet werden müssen. Aus den sich wider-
sprechenden Forderungen nach einem West-
turm, der bei notwendig mittleren Ausmaßen
möglichst eng mit der Baumasse des Langhauses
verbunden bleibt, ohne doch seine Eigenbedeu-
tung aufzugeben, ergab sich für Eßlingen das
Kompromiß eines Paares niedrigerer Pult-
dächer über den westlichsten Seitenschiff-Jochen
(Taf. 38b). Geht solche Anordnung sicher noch
auf Ulrich zurück, kann sein Sohn Matthäus bis
1439 auch noch die frei aufsteigenden Viereck-
Geschosse in der Hauptsache nach dem ur-
sprünglichen Plan ausgeführt haben, so wird für
die Achteck- und Helmzone auch das unsicher.
Matthäus Ensinger hat die Leitung des Turm-
baues in Eßlingen schon von 1420 an nur neben-
bei führen können, da er bald nach seines Va-
ters Tode Meister der neubegründeten Münster-
bauhütte in Bern geworden war. In Eßlingen
vertrat ihn ständig z. B. jener Hans Hülin, der
zwischen 1424 und 1436 als „Stadtbalier und
Balier der Frauen-Kapellkirche" nachweisbar ist.
Da der ihm in solcher Stellung folgende Bruder
des Berner Münsterbaumeisters namens Mathias
schon 1438 starb, konnte im folgenden Jahre der
wahrscheinlich schon mit dem Bau vertraute,
vielleicht aus einer Eßlinger Bürgerfamilie
stammende Hans Böblinger mit diesem Amte be-
traut werden. Mit solcher Ordnung wollte man
es nun aber nicht mehr bewenden lassen. 1440
kam Matthäus Ensinger von Bern, um, im Bei-
sein des Ratspflegers, mit Böblinger einen Ver-
trag zu schließen, auf Grund dessen dieser nun
als „des Turms und Baues Meister" bestellt
wurde. Von 1440 an kann also die Oberleitung
des Matthäus Ensinger für Eßlingen nur mehr
formelle Bedeutung gehabt haben. Der Titel-
Unterschied gegenüber Hülin und Mathias En-
singer ist deutlich genug betont. Wir hören auch
nichts mehr von einem Besuche des Matthäus in
Eßlingen und schon 1465, also schon sieben
Jahre vor dem Tode des Berner Münsterbau-
meisters, wurde Hans Böblinger in Eßlingen auf
Lebenszeit angestellt; 1459 unterzeichnete er als
fünfter Meister die Satzungen des Regensburger
Steinmetztages.
Mathias Ensinger war 1438 bis zu den Rippen-
ansätzen des Gewölbes im letzten Viereckge-
schoß gelangt; hier findet sich diese Jahreszahl
und mehrmals sein Zeichen. Wenig darüber
schon dasjenige Böblingers im Meisterschild.
192
Ausnützung von zisterziensischem Formengut
(Salem) zu eigenartiger Umformung des aus
Straßburg eingeführten kathedralen Dreiportal-
Schemas gelangt war. Am Rottweiler Kapellen-
turm trafen also Anregungen aus Niederhaslach
mit solchen aus Straßburg zusammen, die schon
in Reutlingen umgeformt worden waren. In Rott-
weil so gut wie in Reutlingen handelte es sich
dabei in erster Linie darum, den für Schwaben
traditionellen, einfach vorgesetzten We3tturm
mit dem Schleierwerk der in Straßburg ein-
gedeutschten Hochgotik zu durchdringen und so
eine „Turm-Fassade" zu erzielen. In Reutlingen
werden diese Bemühungen deshalb besonders
deutlich, weil man hier zunächst mit dem Drei-
portal-System des Straßburger Münsters begon-
nen hatte.
Diese schwäbischen Versuche, auch von außen
her gleichsam die überlieferte Einturm-Fassade
mit der Baumasse des Langhauses zu verschmel-
zen, mußten Ulrichs besonderes Interesse er-
regen. Erst in Ulm konnte er aber auch diese
Vorarbeiten von Rottweil und Reutlingen ver-
werten; die Lage der Frauenkirche in Eßlingen
machte eine „Turm-Fassade" unnötig (Taf. 37 a,
38 b). Inwieweit jedoch schon Niederhaslach
zu den Vorläufern der Turmlösung in Eßlingen
gehört, dürfte aus dem Gesagten klar geworden
sein. Auch im Hinblick auf die bei den Lang-
hauspfeilern aufgezeigte Beziehung der Eßlinger
Frauenkirche zur Stadtkirche von Rottweil ist
die, für die Frühzeit des 14. Jahrhunderts sehr
moderne Ausbildung der westlichen Langhaus-
joche in Niederhaslach bemerkenswert: Im Ga-
den sowohl, als auch in den Arkaden gibt es
keine Betonung der Kämpferzone mehr und das
Birnstabprofil der Rippen ist verbindlich ge-
blieben auch für die Ausbildung der Dienste;
die ganz ungegliederten, über Eck gestellten Ar-
kadenpfeiler sind durch Einfluß südwestdeut-
scher Bettelordenskirchen zu erklären.
Wie Ulrich von Ensingen den Turm der Eß-
linger Frauenkirche in seinen oberen Geschossen
ausführen wollte, wissen wir nicht. Keinesfalls
dürfen wir annehmen, daß sein Turm wesentlich
höher hätte werden sollen, als er dann unter
den Böblingern ausgeführt worden ist. Selbst für
den Fall, daß Ulrich schon vor seiner Berufung
nach Ulm Turmpläne von riesenhaftem Ausmaß
erwog —■ in Eßlingen waren sie nicht durchführ-
bar. Vor allem deshalb nicht, weil das Langhaus
in dem schon begonnenen Hallensysteme hatte
vollendet werden müssen. Aus den sich wider-
sprechenden Forderungen nach einem West-
turm, der bei notwendig mittleren Ausmaßen
möglichst eng mit der Baumasse des Langhauses
verbunden bleibt, ohne doch seine Eigenbedeu-
tung aufzugeben, ergab sich für Eßlingen das
Kompromiß eines Paares niedrigerer Pult-
dächer über den westlichsten Seitenschiff-Jochen
(Taf. 38b). Geht solche Anordnung sicher noch
auf Ulrich zurück, kann sein Sohn Matthäus bis
1439 auch noch die frei aufsteigenden Viereck-
Geschosse in der Hauptsache nach dem ur-
sprünglichen Plan ausgeführt haben, so wird für
die Achteck- und Helmzone auch das unsicher.
Matthäus Ensinger hat die Leitung des Turm-
baues in Eßlingen schon von 1420 an nur neben-
bei führen können, da er bald nach seines Va-
ters Tode Meister der neubegründeten Münster-
bauhütte in Bern geworden war. In Eßlingen
vertrat ihn ständig z. B. jener Hans Hülin, der
zwischen 1424 und 1436 als „Stadtbalier und
Balier der Frauen-Kapellkirche" nachweisbar ist.
Da der ihm in solcher Stellung folgende Bruder
des Berner Münsterbaumeisters namens Mathias
schon 1438 starb, konnte im folgenden Jahre der
wahrscheinlich schon mit dem Bau vertraute,
vielleicht aus einer Eßlinger Bürgerfamilie
stammende Hans Böblinger mit diesem Amte be-
traut werden. Mit solcher Ordnung wollte man
es nun aber nicht mehr bewenden lassen. 1440
kam Matthäus Ensinger von Bern, um, im Bei-
sein des Ratspflegers, mit Böblinger einen Ver-
trag zu schließen, auf Grund dessen dieser nun
als „des Turms und Baues Meister" bestellt
wurde. Von 1440 an kann also die Oberleitung
des Matthäus Ensinger für Eßlingen nur mehr
formelle Bedeutung gehabt haben. Der Titel-
Unterschied gegenüber Hülin und Mathias En-
singer ist deutlich genug betont. Wir hören auch
nichts mehr von einem Besuche des Matthäus in
Eßlingen und schon 1465, also schon sieben
Jahre vor dem Tode des Berner Münsterbau-
meisters, wurde Hans Böblinger in Eßlingen auf
Lebenszeit angestellt; 1459 unterzeichnete er als
fünfter Meister die Satzungen des Regensburger
Steinmetztages.
Mathias Ensinger war 1438 bis zu den Rippen-
ansätzen des Gewölbes im letzten Viereckge-
schoß gelangt; hier findet sich diese Jahreszahl
und mehrmals sein Zeichen. Wenig darüber
schon dasjenige Böblingers im Meisterschild.
192