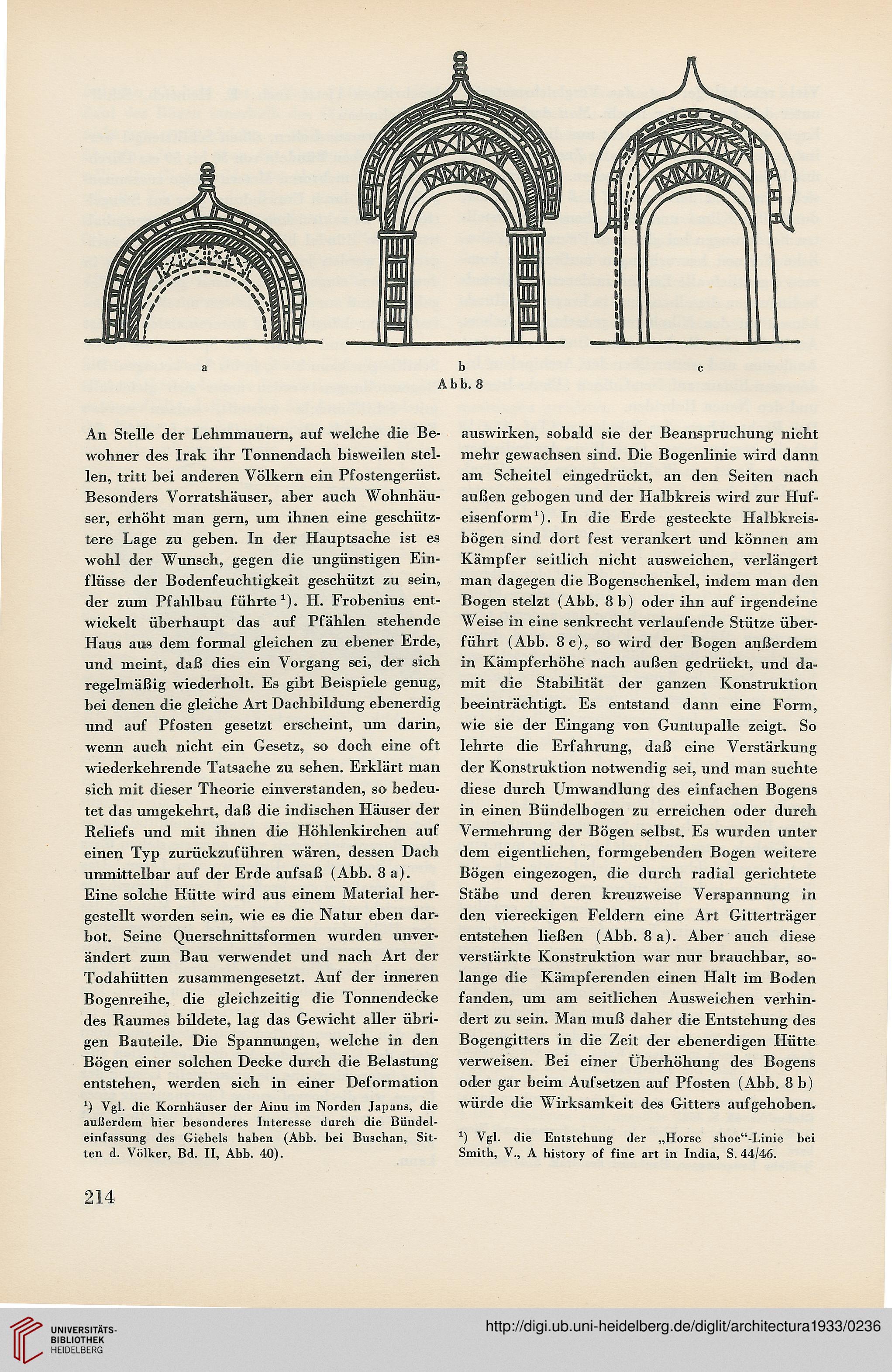b
Abb. 8
c
An Stelle der Lehmmauern, auf welche die Be-
wohner des Irak ihr Tonnendach bisweilen stel-
len, tritt bei anderen Völkern ein Pfostengerüst.
Besonders Vorratshäuser, aber auch Wohnhäu-
ser, erhöht man gern, um ihnen eine geschütz-
tere Lage zu geben. In der Hauptsache ist es
wohl der Wunsch, gegen die ungünstigen Ein-
flüsse der Bodenfeuchtigkeit geschützt zu sein,
der zum Pfahlbau führte1). H. Frobenius ent-
wickelt überhaupt das auf Pfählen stehende
Haus aus dem formal gleichen zu ebener Erde,
und meint, daß dies ein Vorgang sei, der sich
regelmäßig wiederholt. Es gibt Beispiele genug,
bei denen die gleiche Art Dachbildung ebenerdig
und auf Pfosten gesetzt erscheint, um darin,
wenn auch nicht ein Gesetz, so doch eine oft
wiederkehrende Tatsache zu sehen. Erklärt man
sich mit dieser Theorie einverstanden, so bedeu-
tet das umgekehrt, daß die indischen Häuser der
Reliefs und mit ihnen die Höhlenkirchen auf
einen Typ zurückzuführen wären, dessen Dach
unmittelbar auf der Erde aufsaß (Abb. 8 a).
Eine solche Hütte wird aus einem Material her-
gestellt worden sein, wie es die Natur eben dar-
bot. Seine Querschnittsformen wurden unver-
ändert zum Bau verwendet und nach Art der
Todahütten zusammengesetzt. Auf der inneren
Bogenreihe, die gleichzeitig die Tonnendecke
des Raumes bildete, lag das Gewicht aller übri-
gen Bauteile. Die Spannungen, welche in den
Bögen einer solchen Decke durch die Belastung
entstehen, werden sich in einer Deformation
1) Vgl. die Kornhäuser der Ainu im Norden Japans, die
außerdem hier besonderes Interesse durch die Bündel-
einfassung des Giebels haben (Abb. bei Buschan, Sit-
ten d. Völker, Bd. II, Abb. 40).
auswirken, sobald sie der Beanspruchung nicht
mehr gewachsen sind. Die Bogenlinie wird dann
am Scheitel eingedrückt, an den Seiten nach
außen gebogen und der Halbkreis wird zur Huf-
eisenform1). In die Erde gesteckte Halbkreis-
bögen sind dort fest verankert und können am
Kämpfer seitlich nicht ausweichen, verlängert
man dagegen die Bogenschenkel, indem man den
Bogen stelzt (Abb. 8 b) oder ihn auf irgendeine
Weise in eine senkrecht verlaufende Stütze über-
führt (Abb. 8 c), so wird der Bogen außerdem
in Kämpferhöhe nach außen gedrückt, und da-
mit die Stabilität der ganzen Konstruktion
beeinträchtigt. Es entstand dann eine Form,
wie sie der Eingang von Guntupalle zeigt. So
lehrte die Erfahrung, daß eine Verstärkung
der Konstruktion notwendig sei, und man suchte
diese durch Umwandlung des einfachen Bogens
in einen Bündelbogen zu erreichen oder durch
Vermehrung der Bögen selbst. Es wurden unter
dem eigentlichen, formgebenden Bogen weitere
Bögen eingezogen, die durch radial gerichtete
Stäbe und deren kreuzweise Verspannung in
den viereckigen Feldern eine Art Gitterträger
entstehen ließen (Abb. 8 a). Aber auch diese
verstärkte Konstruktion war nur brauchbar, so-
lange die Kämpferenden einen Halt im Boden
fanden, um am seitlichen Ausweichen verhin-
dert zu sein. Man muß daher die Entstehung des
Bogengitters in die Zeit der ebenerdigen Hütte
verweisen. Bei einer Überhöhung des Bogens
oder gar beim Aufsetzen auf Pfosten (Abb. 8 b)
würde die Wirksamkeit des Gitters aufgehoben.
1) Vgl. die Entstehung der „Horse shoe"-Linie bei
Smith, V., A history of fine art in India, S. 44/46.
214
Abb. 8
c
An Stelle der Lehmmauern, auf welche die Be-
wohner des Irak ihr Tonnendach bisweilen stel-
len, tritt bei anderen Völkern ein Pfostengerüst.
Besonders Vorratshäuser, aber auch Wohnhäu-
ser, erhöht man gern, um ihnen eine geschütz-
tere Lage zu geben. In der Hauptsache ist es
wohl der Wunsch, gegen die ungünstigen Ein-
flüsse der Bodenfeuchtigkeit geschützt zu sein,
der zum Pfahlbau führte1). H. Frobenius ent-
wickelt überhaupt das auf Pfählen stehende
Haus aus dem formal gleichen zu ebener Erde,
und meint, daß dies ein Vorgang sei, der sich
regelmäßig wiederholt. Es gibt Beispiele genug,
bei denen die gleiche Art Dachbildung ebenerdig
und auf Pfosten gesetzt erscheint, um darin,
wenn auch nicht ein Gesetz, so doch eine oft
wiederkehrende Tatsache zu sehen. Erklärt man
sich mit dieser Theorie einverstanden, so bedeu-
tet das umgekehrt, daß die indischen Häuser der
Reliefs und mit ihnen die Höhlenkirchen auf
einen Typ zurückzuführen wären, dessen Dach
unmittelbar auf der Erde aufsaß (Abb. 8 a).
Eine solche Hütte wird aus einem Material her-
gestellt worden sein, wie es die Natur eben dar-
bot. Seine Querschnittsformen wurden unver-
ändert zum Bau verwendet und nach Art der
Todahütten zusammengesetzt. Auf der inneren
Bogenreihe, die gleichzeitig die Tonnendecke
des Raumes bildete, lag das Gewicht aller übri-
gen Bauteile. Die Spannungen, welche in den
Bögen einer solchen Decke durch die Belastung
entstehen, werden sich in einer Deformation
1) Vgl. die Kornhäuser der Ainu im Norden Japans, die
außerdem hier besonderes Interesse durch die Bündel-
einfassung des Giebels haben (Abb. bei Buschan, Sit-
ten d. Völker, Bd. II, Abb. 40).
auswirken, sobald sie der Beanspruchung nicht
mehr gewachsen sind. Die Bogenlinie wird dann
am Scheitel eingedrückt, an den Seiten nach
außen gebogen und der Halbkreis wird zur Huf-
eisenform1). In die Erde gesteckte Halbkreis-
bögen sind dort fest verankert und können am
Kämpfer seitlich nicht ausweichen, verlängert
man dagegen die Bogenschenkel, indem man den
Bogen stelzt (Abb. 8 b) oder ihn auf irgendeine
Weise in eine senkrecht verlaufende Stütze über-
führt (Abb. 8 c), so wird der Bogen außerdem
in Kämpferhöhe nach außen gedrückt, und da-
mit die Stabilität der ganzen Konstruktion
beeinträchtigt. Es entstand dann eine Form,
wie sie der Eingang von Guntupalle zeigt. So
lehrte die Erfahrung, daß eine Verstärkung
der Konstruktion notwendig sei, und man suchte
diese durch Umwandlung des einfachen Bogens
in einen Bündelbogen zu erreichen oder durch
Vermehrung der Bögen selbst. Es wurden unter
dem eigentlichen, formgebenden Bogen weitere
Bögen eingezogen, die durch radial gerichtete
Stäbe und deren kreuzweise Verspannung in
den viereckigen Feldern eine Art Gitterträger
entstehen ließen (Abb. 8 a). Aber auch diese
verstärkte Konstruktion war nur brauchbar, so-
lange die Kämpferenden einen Halt im Boden
fanden, um am seitlichen Ausweichen verhin-
dert zu sein. Man muß daher die Entstehung des
Bogengitters in die Zeit der ebenerdigen Hütte
verweisen. Bei einer Überhöhung des Bogens
oder gar beim Aufsetzen auf Pfosten (Abb. 8 b)
würde die Wirksamkeit des Gitters aufgehoben.
1) Vgl. die Entstehung der „Horse shoe"-Linie bei
Smith, V., A history of fine art in India, S. 44/46.
214