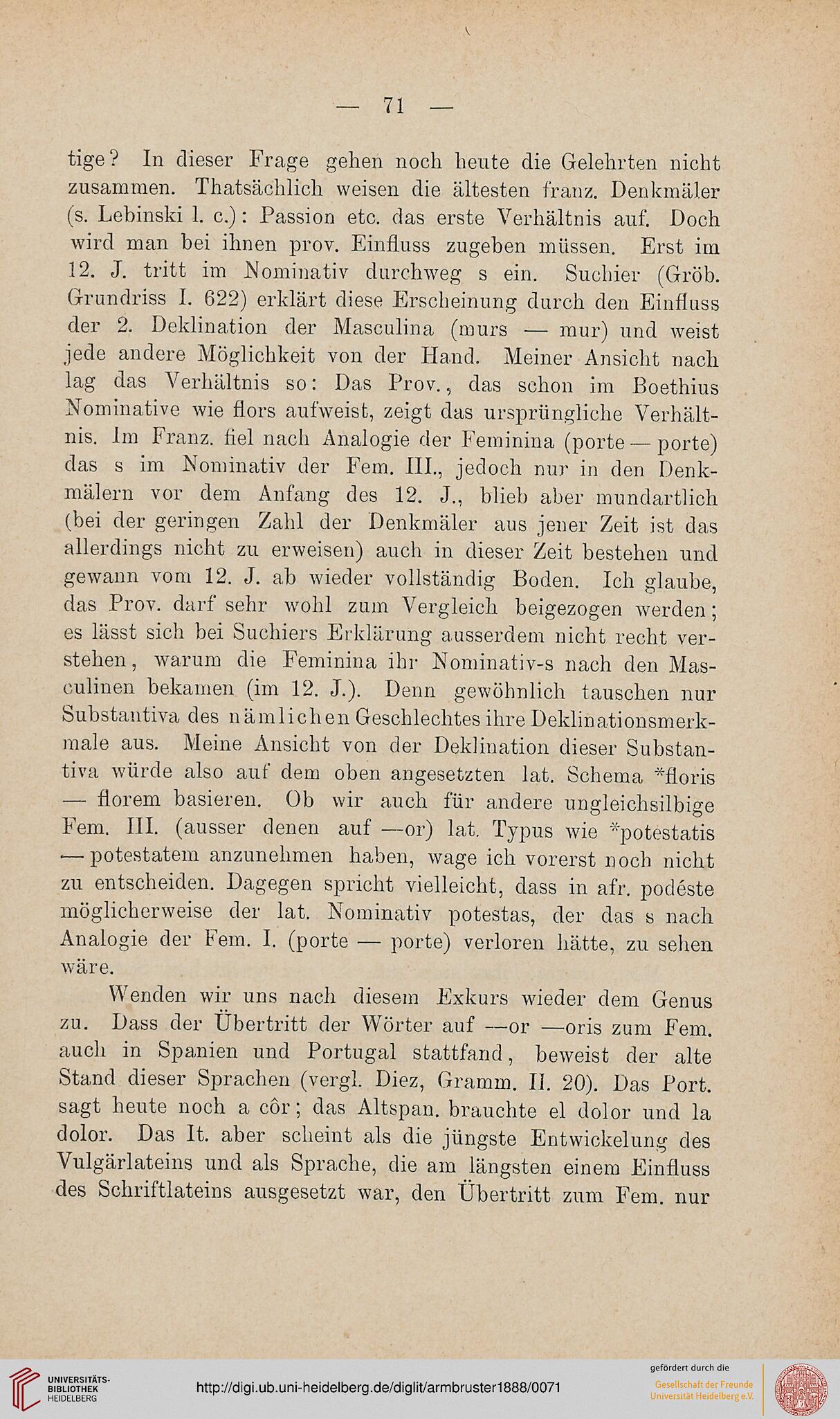71
tige? In dieser Frage gehen noch heute die Gelehrten nicht
zusammen. Thatsächlich weisen die ältesten franz. Denkmäler
(s. Lebinski 1. c.) : Passion etc. das erste Verhältnis auf. Doch
wird man bei ihnen prov. Einfluss zugeben müssen. Erst im
12. J. tritt im Nominativ durchweg s ein. Sucliier (Grob.
Grundriss I. 622) erklärt diese Erscheinung durch den Einfluss
der 2. Deklination der Masculina (murs — mur) und weist
jede andere Möglichkeit von der Hand. Meiner Ansicht nach
lag das Verhältnis so : Das Prov., das schon im Boethius
Nominative wie flors aufweist, zeigt das ursprüngliche Verhält-
nis. Im Franz, fiel nach Analogie der Feminina (porte—porte)
das s im Nominativ der Fern. III., jedoch nur in den Denk-
mälern vor dem Anfang des 12. J., blieb aber mundartlich
(bei der geringen Zahl der Denkmäler aus jener Zeit ist das
allerdings nicht zu erweisen) auch in dieser Zeit bestehen und
gewann vom 12. J. ab wieder vollständig Boden. Ich glaube,
das Prov. darf sehr wohl zum Vergleich beigezogen werden ;
es lässt sich bei Suchiers Erklärung ausserdem nicht recht ver-
stehen, warum die Feminina ihr Nominativ-s nach den Mas-
culinen bekamen (im 12. J.). Denn gewöhnlich tauschen nur
Substantiva des nämlichen Geschlechtes ihre Deklinationsmerk-
male aus. Meine Ansicht von der Deklination dieser Substan-
tiva würde also auf dem oben angesetzten lat. Schema *floris
— florem basieren. Ob wir auch für andere ungleichsilbige
Fern. III. (äusser denen auf —or) lat. Typus wie *potestatis
— potestatem anzunehmen haben, wage ich vorerst noch nicht
zu entscheiden. Dagegen spricht vielleicht, dass in afr. podéste
möglicherweise der lat. Nominativ potestas, der das s nach
Analogie der Fern. I. (porte — porte) verloren hätte, zu sehen
wäre.
Wenden wir uns nach diesem Exkurs wieder dem Genus
zu. Dass der Übertritt der Wörter auf —or —oris zum Fern,
auch in Spanien und Portugal stattfand, beweist der alte
Stand dieser Sprachen (vergl. Diez, Gramm. II. 20). Das Port,
sagt heute noch a cor ; das Altspan, brauchte el dolor und la
dolor. Das It. aber scheint als die jüngste Entwickelung des
Vulgärlateins und als Sprache, die am längsten einem Einfluss
des Schriftlateins ausgesetzt war, den Übertritt zum Fern, nur
tige? In dieser Frage gehen noch heute die Gelehrten nicht
zusammen. Thatsächlich weisen die ältesten franz. Denkmäler
(s. Lebinski 1. c.) : Passion etc. das erste Verhältnis auf. Doch
wird man bei ihnen prov. Einfluss zugeben müssen. Erst im
12. J. tritt im Nominativ durchweg s ein. Sucliier (Grob.
Grundriss I. 622) erklärt diese Erscheinung durch den Einfluss
der 2. Deklination der Masculina (murs — mur) und weist
jede andere Möglichkeit von der Hand. Meiner Ansicht nach
lag das Verhältnis so : Das Prov., das schon im Boethius
Nominative wie flors aufweist, zeigt das ursprüngliche Verhält-
nis. Im Franz, fiel nach Analogie der Feminina (porte—porte)
das s im Nominativ der Fern. III., jedoch nur in den Denk-
mälern vor dem Anfang des 12. J., blieb aber mundartlich
(bei der geringen Zahl der Denkmäler aus jener Zeit ist das
allerdings nicht zu erweisen) auch in dieser Zeit bestehen und
gewann vom 12. J. ab wieder vollständig Boden. Ich glaube,
das Prov. darf sehr wohl zum Vergleich beigezogen werden ;
es lässt sich bei Suchiers Erklärung ausserdem nicht recht ver-
stehen, warum die Feminina ihr Nominativ-s nach den Mas-
culinen bekamen (im 12. J.). Denn gewöhnlich tauschen nur
Substantiva des nämlichen Geschlechtes ihre Deklinationsmerk-
male aus. Meine Ansicht von der Deklination dieser Substan-
tiva würde also auf dem oben angesetzten lat. Schema *floris
— florem basieren. Ob wir auch für andere ungleichsilbige
Fern. III. (äusser denen auf —or) lat. Typus wie *potestatis
— potestatem anzunehmen haben, wage ich vorerst noch nicht
zu entscheiden. Dagegen spricht vielleicht, dass in afr. podéste
möglicherweise der lat. Nominativ potestas, der das s nach
Analogie der Fern. I. (porte — porte) verloren hätte, zu sehen
wäre.
Wenden wir uns nach diesem Exkurs wieder dem Genus
zu. Dass der Übertritt der Wörter auf —or —oris zum Fern,
auch in Spanien und Portugal stattfand, beweist der alte
Stand dieser Sprachen (vergl. Diez, Gramm. II. 20). Das Port,
sagt heute noch a cor ; das Altspan, brauchte el dolor und la
dolor. Das It. aber scheint als die jüngste Entwickelung des
Vulgärlateins und als Sprache, die am längsten einem Einfluss
des Schriftlateins ausgesetzt war, den Übertritt zum Fern, nur