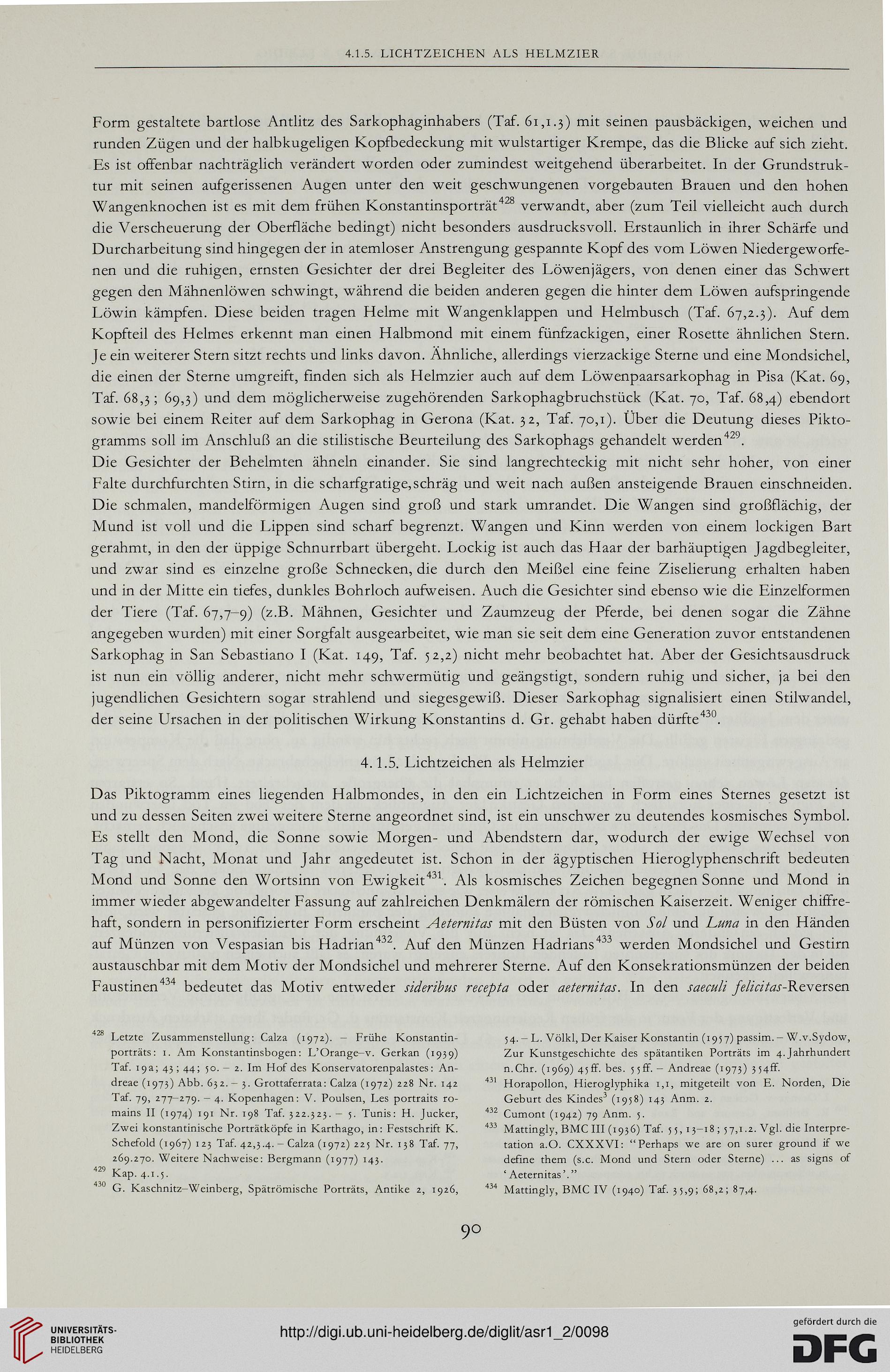4.1.5. LICHTZEICHEN ALS HELMZIER
Form gestaltete bartlose Antlitz des Sarkophaginhabers (Taf. 61,1.3) m^ seinen pausbäckigen, weichen und
runden Zügen und der halbkugeligen Kopfbedeckung mit wulstartiger Krempe, das die Blicke auf sich zieht.
Es ist offenbar nachträglich verändert worden oder zumindest weitgehend überarbeitet. In der Grundstruk-
tur mit seinen aufgerissenen Augen unter den weit geschwungenen vorgebauten Brauen und den hohen
Wangenknochen ist es mit dem frühen Konstantinsporträt428 verwandt, aber (zum Teil vielleicht auch durch
die Verscheuerung der Oberfläche bedingt) nicht besonders ausdrucksvoll. Erstaunlich in ihrer Schärfe und
Durcharbeitung sind hingegen der in atemloser Anstrengung gespannte Kopf des vom Löwen Niedergeworfe-
nen und die ruhigen, ernsten Gesichter der drei Begleiter des Löwenjägers, von denen einer das Schwert
gegen den Mähnenlöwen schwingt, während die beiden anderen gegen die hinter dem Löwen aufspringende
Löwin kämpfen. Diese beiden tragen Helme mit Wangenklappen und Helmbusch (Taf. 67,2.3). Auf dem
Kopfteil des Helmes erkennt man einen Halbmond mit einem fünfzackigen, einer Rosette ähnlichen Stern.
Je ein weiterer Stern sitzt rechts und links davon. Ähnliche, allerdings vierzackige Sterne und eine Mondsichel,
die einen der Sterne umgreift, finden sich als Helmzier auch auf dem Löwenpaarsarkophag in Pisa (Kat. 69,
Taf. 68,3; 69,3) und dem möglicherweise zugehörenden Sarkophagbruchstück (Kat. 70, Taf. 68,4) ebendort
sowie bei einem Reiter auf dem Sarkophag in Gerona (Kat. 32, Taf. 70,1). Über die Deutung dieses Pikto-
gramms soll im Anschluß an die stilistische Beurteilung des Sarkophags gehandelt werden429.
Die Gesichter der Behelmten ähneln einander. Sie sind langrechteckig mit nicht sehr hoher, von einer
Falte durchfurchten Stirn, in die scharfgratige,schräg und weit nach außen ansteigende Brauen einschneiden.
Die schmalen, mandelförmigen Augen sind groß und stark umrandet. Die Wangen sind großflächig, der
Mund ist voll und die Lippen sind scharf begrenzt. Wangen und Kinn werden von einem lockigen Bart
gerahmt, in den der üppige Schnurrbart übergeht. Lockig ist auch das Haar der barhäuptigen Jagdbegleiter,
und zwar sind es einzelne große Schnecken, die durch den Meißel eine feine Ziselierung erhalten haben
und in der Mitte ein tiefes, dunkles Bohrloch aufweisen. Auch die Gesichter sind ebenso wie die Einzelformen
der Tiere (Taf. 67,7-9) (Z-B- Mähnen, Gesichter und Zaumzeug der Pferde, bei denen sogar die Zähne
angegeben wurden) mit einer Sorgfalt ausgearbeitet, wie man sie seit dem eine Generation zuvor entstandenen
Sarkophag in San Sebastiano I (Kat. 149, Taf. 52,2) nicht mehr beobachtet hat. Aber der Gesichtsausdruck
ist nun ein völlig anderer, nicht mehr schwermütig und geängstigt, sondern ruhig und sicher, ja bei den
jugendlichen Gesichtern sogar strahlend und siegesgewiß. Dieser Sarkophag signalisiert einen Stilwandel,
der seine Ursachen in der politischen Wirkung Konstantins d. Gr. gehabt haben dürfte430.
4.1.5. Lichtzeichen als Helmzier
Das Piktogramm eines liegenden Halbmondes, in den ein Lichtzeichen in Form eines Sternes gesetzt ist
und zu dessen Seiten zwei weitere Sterne angeordnet sind, ist ein unschwer zu deutendes kosmisches Symbol.
Es stellt den Mond, die Sonne sowie Morgen- und Abendstern dar, wodurch der ewige Wechsel von
Tag und Nacht, Monat und Jahr angedeutet ist. Schon in der ägyptischen Hieroglyphenschrift bedeuten
Mond und Sonne den Wortsinn von Ewigkeit431. Als kosmisches Zeichen begegnen Sonne und Mond in
immer wieder abgewandelter Fassung auf zahlreichen Denkmälern der römischen Kaiserzeit. Weniger chiffre-
haft, sondern in personifizierter Form erscheint Aeternitas mit den Büsten von So/ und Lima in den Händen
auf Münzen von Vespasian bis Hadrian432. Auf den Münzen Hadrians433 werden Mondsichel und Gestirn
austauschbar mit dem Motiv der Mondsichel und mehrerer Sterne. Auf den Konsekrationsmünzen der beiden
Faustinen434 bedeutet das Motiv entweder sideribus recepta oder aeternitas. In den saeculi felicitas-Reversen
Letzte Zusammenstellung: Calza (1972). - Frühe Konstantin-
porträts: 1. Am Konstantinsbogen: L'Orange-v. Gerkan (1939)
Taf. 19a; 43 ; 44; 50. - 2. Im Hof des Konservatorenpalastes: An-
dreae (1973) Abb. 632. - 3. Grottaferrata: Calza (1972) 228 Nr. 142
Taf. 79, 277-279. - 4. Kopenhagen: V. Poulsen, Les portraits ro-
mains II (1974) 191 Nr. 198 Taf. 322.323. - 5. Tunis: H. Jucker,
Zwei konstantinische Porträtköpfe in Karthago, in: Festschrift K.
Schefold (1967) 1 23 Taf. 42,3.4. - Calza (1972) 22; Nr. 138 Taf. 77,
269.270. Weitere Nachweise: Bergmann (1977) 143.
Kap. 4.1.5.
G. Kaschnitz-Weinberg, Spätrömische Porträts, Antike 2, 1926,
54. - L. Völkl, Der Kaiser Konstantin (1957) passim. - W.v.Sydow,
Zur Kunstgeschichte des spätantiken Porträts im 4.Jahrhundert
n.Chr. (1969) 45 ff. bes. 5 5 ff. - Andreae (1973) 3 54Ö7-
Horapollon, Hieroglyphika 1,1, mitgeteilt von E. Norden, Die
Geburt des Kindes (1958) 143 Anm. 2.
Cumont (1942) 79 Anm. 5.
Mattingly, BMC III (1936) Taf. 5 5, 1 3-18 ; 57,1.2. Vgl. die Interpre-
tation a.O. CXXXVI: "Perhaps we are on surer ground if we
define them (s.c. Mond und Stern oder Sterne) ... as signs of
' Aeternitas'."
Mattingly, BMC IV (1940) Taf. 35,9; 68,2; 87,4.
9O
Form gestaltete bartlose Antlitz des Sarkophaginhabers (Taf. 61,1.3) m^ seinen pausbäckigen, weichen und
runden Zügen und der halbkugeligen Kopfbedeckung mit wulstartiger Krempe, das die Blicke auf sich zieht.
Es ist offenbar nachträglich verändert worden oder zumindest weitgehend überarbeitet. In der Grundstruk-
tur mit seinen aufgerissenen Augen unter den weit geschwungenen vorgebauten Brauen und den hohen
Wangenknochen ist es mit dem frühen Konstantinsporträt428 verwandt, aber (zum Teil vielleicht auch durch
die Verscheuerung der Oberfläche bedingt) nicht besonders ausdrucksvoll. Erstaunlich in ihrer Schärfe und
Durcharbeitung sind hingegen der in atemloser Anstrengung gespannte Kopf des vom Löwen Niedergeworfe-
nen und die ruhigen, ernsten Gesichter der drei Begleiter des Löwenjägers, von denen einer das Schwert
gegen den Mähnenlöwen schwingt, während die beiden anderen gegen die hinter dem Löwen aufspringende
Löwin kämpfen. Diese beiden tragen Helme mit Wangenklappen und Helmbusch (Taf. 67,2.3). Auf dem
Kopfteil des Helmes erkennt man einen Halbmond mit einem fünfzackigen, einer Rosette ähnlichen Stern.
Je ein weiterer Stern sitzt rechts und links davon. Ähnliche, allerdings vierzackige Sterne und eine Mondsichel,
die einen der Sterne umgreift, finden sich als Helmzier auch auf dem Löwenpaarsarkophag in Pisa (Kat. 69,
Taf. 68,3; 69,3) und dem möglicherweise zugehörenden Sarkophagbruchstück (Kat. 70, Taf. 68,4) ebendort
sowie bei einem Reiter auf dem Sarkophag in Gerona (Kat. 32, Taf. 70,1). Über die Deutung dieses Pikto-
gramms soll im Anschluß an die stilistische Beurteilung des Sarkophags gehandelt werden429.
Die Gesichter der Behelmten ähneln einander. Sie sind langrechteckig mit nicht sehr hoher, von einer
Falte durchfurchten Stirn, in die scharfgratige,schräg und weit nach außen ansteigende Brauen einschneiden.
Die schmalen, mandelförmigen Augen sind groß und stark umrandet. Die Wangen sind großflächig, der
Mund ist voll und die Lippen sind scharf begrenzt. Wangen und Kinn werden von einem lockigen Bart
gerahmt, in den der üppige Schnurrbart übergeht. Lockig ist auch das Haar der barhäuptigen Jagdbegleiter,
und zwar sind es einzelne große Schnecken, die durch den Meißel eine feine Ziselierung erhalten haben
und in der Mitte ein tiefes, dunkles Bohrloch aufweisen. Auch die Gesichter sind ebenso wie die Einzelformen
der Tiere (Taf. 67,7-9) (Z-B- Mähnen, Gesichter und Zaumzeug der Pferde, bei denen sogar die Zähne
angegeben wurden) mit einer Sorgfalt ausgearbeitet, wie man sie seit dem eine Generation zuvor entstandenen
Sarkophag in San Sebastiano I (Kat. 149, Taf. 52,2) nicht mehr beobachtet hat. Aber der Gesichtsausdruck
ist nun ein völlig anderer, nicht mehr schwermütig und geängstigt, sondern ruhig und sicher, ja bei den
jugendlichen Gesichtern sogar strahlend und siegesgewiß. Dieser Sarkophag signalisiert einen Stilwandel,
der seine Ursachen in der politischen Wirkung Konstantins d. Gr. gehabt haben dürfte430.
4.1.5. Lichtzeichen als Helmzier
Das Piktogramm eines liegenden Halbmondes, in den ein Lichtzeichen in Form eines Sternes gesetzt ist
und zu dessen Seiten zwei weitere Sterne angeordnet sind, ist ein unschwer zu deutendes kosmisches Symbol.
Es stellt den Mond, die Sonne sowie Morgen- und Abendstern dar, wodurch der ewige Wechsel von
Tag und Nacht, Monat und Jahr angedeutet ist. Schon in der ägyptischen Hieroglyphenschrift bedeuten
Mond und Sonne den Wortsinn von Ewigkeit431. Als kosmisches Zeichen begegnen Sonne und Mond in
immer wieder abgewandelter Fassung auf zahlreichen Denkmälern der römischen Kaiserzeit. Weniger chiffre-
haft, sondern in personifizierter Form erscheint Aeternitas mit den Büsten von So/ und Lima in den Händen
auf Münzen von Vespasian bis Hadrian432. Auf den Münzen Hadrians433 werden Mondsichel und Gestirn
austauschbar mit dem Motiv der Mondsichel und mehrerer Sterne. Auf den Konsekrationsmünzen der beiden
Faustinen434 bedeutet das Motiv entweder sideribus recepta oder aeternitas. In den saeculi felicitas-Reversen
Letzte Zusammenstellung: Calza (1972). - Frühe Konstantin-
porträts: 1. Am Konstantinsbogen: L'Orange-v. Gerkan (1939)
Taf. 19a; 43 ; 44; 50. - 2. Im Hof des Konservatorenpalastes: An-
dreae (1973) Abb. 632. - 3. Grottaferrata: Calza (1972) 228 Nr. 142
Taf. 79, 277-279. - 4. Kopenhagen: V. Poulsen, Les portraits ro-
mains II (1974) 191 Nr. 198 Taf. 322.323. - 5. Tunis: H. Jucker,
Zwei konstantinische Porträtköpfe in Karthago, in: Festschrift K.
Schefold (1967) 1 23 Taf. 42,3.4. - Calza (1972) 22; Nr. 138 Taf. 77,
269.270. Weitere Nachweise: Bergmann (1977) 143.
Kap. 4.1.5.
G. Kaschnitz-Weinberg, Spätrömische Porträts, Antike 2, 1926,
54. - L. Völkl, Der Kaiser Konstantin (1957) passim. - W.v.Sydow,
Zur Kunstgeschichte des spätantiken Porträts im 4.Jahrhundert
n.Chr. (1969) 45 ff. bes. 5 5 ff. - Andreae (1973) 3 54Ö7-
Horapollon, Hieroglyphika 1,1, mitgeteilt von E. Norden, Die
Geburt des Kindes (1958) 143 Anm. 2.
Cumont (1942) 79 Anm. 5.
Mattingly, BMC III (1936) Taf. 5 5, 1 3-18 ; 57,1.2. Vgl. die Interpre-
tation a.O. CXXXVI: "Perhaps we are on surer ground if we
define them (s.c. Mond und Stern oder Sterne) ... as signs of
' Aeternitas'."
Mattingly, BMC IV (1940) Taf. 35,9; 68,2; 87,4.
9O