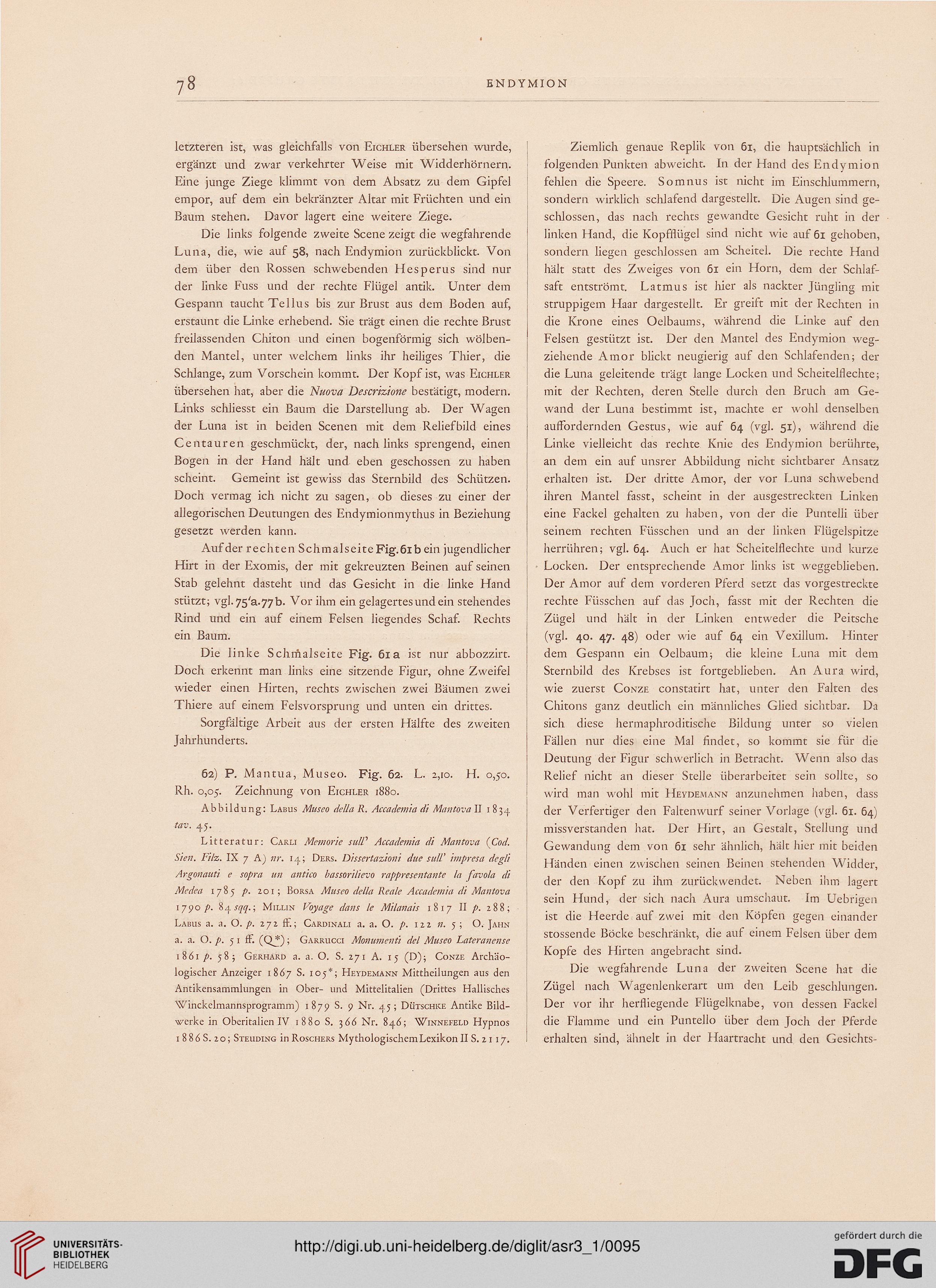78
KNDYMION
letzteren ist, was gleichfalls von Eichler übersehen wurde,
ergänzt und zwar verkehrter Weise mit Widderhörnern.
Eine junge Ziege klimmt von dem Absatz zu dem Gipfel
empor, auf dem ein bekränzter Altar mit Früchten und ein
Baum stehen. Davor lagert eine weitere Ziege.
Die links folgende zweite Scene zeigt die wegfahrende
Luna, die, wie auf 58, nach Endymion zurückblickt. Von
dem über den Rossen schwebenden Hesperus sind nur
der linke Fuss und der rechte Flügel antik. Unter dem
Gespann taucht Tellus bis zur Brust aus dem Boden auf,
erstaunt die Linke erhebend. Sie trägt einen die rechte Brust
freilassenden Chiton und einen bogenförmig sich wölben-
den Mantel, unter welchem links ihr heiliges Thier, die
Schlange, zum Vorschein kommt. Der Kopf ist, was Eichler
übersehen hat, aber die Nuova Descrizione bestätigt, modern.
Links schliesst ein Baum die Darstellung ab. Der Wagen
der Luna ist in beiden Scenen mit dem Reliefbild eines
Centauren geschmückt, der, nach links sprengend, einen
Bogen in der Hand hält und eben geschossen zu haben
scheint. Gemeint ist gewiss das Sternbild des Schützen.
Doch vermag ich nicht zu sagen, ob dieses zu einer der
allegorischen Deutungen des Endymionmythus in Beziehung
gesetzt werden kann.
Auf der rechten Schmalseite Fig.6lb ein jugendlicher
Hirt in der Exomis, der mit gekreuzten Beinen auf seinen
Stab gelehnt dasteht und das Gesicht in die linke Hand
stützt; vgl.75'a.77b. Vor ihm ein gelagertes und ein stehendes
Rind und ein auf einem Felsen liegendes Schaf. Rechts
ein Baum.
Die linke Schmalseite Fig. 61 a ist nur abbozzirt.
Doch erkennt man links eine sitzende Figur, ohne Zweifel
wieder einen Hirten, rechts zwischen zwei Bäumen zwei
Thiere auf einem Felsvorsprung und unten ein drittes.
Sorgfältige Arbeit aus der ersten Hälfte des zweiten
Jahrhunderts.
62) P. Mantua, Museo. Fig. 62. L. 2,10. H. 0,50.
Rh. 0,05. Zeichnung von Eichler 1880.
Abbildung: Labus Museo deUa R. Accademia dl Mantova II 1 834
tav. 4.5.
Litteratur: Carli Memorie suW Accademia dt Mantova (Cod.
Sien. Filz. IX 7 A) nr. 14; Ders. Dissertazioni due sulT impresa dcgli
Argonauti e sopra an antico bassorilievo rappresentante la favola di
Medea 1785 p. 201; Borsa Museo della Reale Accademia di Mantova
1790/». %A.sqq.; Millin Voyage dans le Milanais 1817 II p. 288;
Labus a. a. O. p. 272 ff; Cardinali a. a. O. p. 122 n. 5 ; O. Jahn
a. a. O. p. 51 ff. (qj^); Garrucci Monumenü del Museo Lateranense
1861 p. 58; Gerhard a. a. O. S. 271 A. 15 (D); Conze Archäo-
logischer Anzeiger 1867 S. 105*; Heydemann MittheiJungen aus den
Antikensammlungen in Ober- und Mittelitalien (Drittes Hallisches
Winckclmannsprogramm) 1879 S. 9 Nr. 45; Dütschke Antike Bild-
werke in Oberitalicn IV 1880 S. 366 Nr. 846; Winnefeld Hypnos
1 8 86 S. 20; Steuding in Roschers Mythologischem Lexikon II S. 2117.
Ziemlich genaue Replik von 61, die hauptsächlich in
folgenden Punkten abweicht. In der Hand des Endymion
fehlen die Speere. Somnus ist nicht im Einschlummern,
sondern wirklich schlafend dargestellt. Die Augen sind ge-
schlossen, das nach rechts gewandte Gesicht ruht in der
linken Hand, die Kopfflügel sind nicht wie auf 61 gehoben,
sondern liegen geschlossen am Scheitel. Die rechte Hand
hält statt des Zweiges von 61 ein Horn, dem der Schlaf-
saft entströmt. Latmus ist hier als nackter Jüngling mit
struppigem Haar dargestellt. Er greift mit der Rechten in
die Krone eines Oelbaums, während die Linke auf den
Felsen gestützt ist. Der den Mantel des Endymion weg-
ziehende Amor blickt neugierig auf den Schlafenden; der
die Luna geleitende trägt lange Locken und Scheitelflechte;
mit der Rechten, deren Stelle durch den Bruch am Ge-
wand der Luna bestimmt ist, machte er wohl denselben
auffordernden Gestus, wie auf 64 (vgl. 51), während die
Linke vielleicht das rechte Knie des Endymion berührte,
an dem ein auf unsrer Abbildung nicht sichtbarer Ansatz
erhalten ist. Der dritte Amor, der vor Luna schwebend
ihren Mantel fasst, scheint in der ausgestreckten Linken
eine Fackel gehalten zu haben, von der die Puntelli über
seinem rechten Füsschen und an der linken Flügelspitze
herrühren; vgl. 64. Auch er hat Scheitelflechte und kurze
Locken. Der entsprechende Amor links ist weggeblieben.
Der Amor auf dem vorderen Pferd setzt das vorgestreckte
rechte Füsschen auf das Joch, fasst mit der Rechten die
Zügel und hält in der Linken entweder die Peitsche
(vgl. 40. 47. 48) oder wie auf 64 ein Vexillum. Hinter
dem Gespann ein Oelbaum; die kleine Luna mit dem
Sternbild des Krebses ist fortgeblieben. An Aura wird,
wie zuerst Conze constatirt hat, unter den Falten des
Chitons ganz deutlich ein männliches Glied sichtbar. Da
sich diese hermaphroditische Bildung unter so vielen
Fällen nur dies eine Mal findet, so kommt sie für die
Deutung der Figur schwerlich in Betracht. Wenn also das
Relief nicht an dieser Stelle überarbeitet sein sollte, so
wird man wohl mit Heydemann anzunehmen haben, dass
der Verfertiger den Faltenwurf seiner Vorlage (vgl. 61. 64)
missverstanden hat. Der Hirt, an Gestalt, Stellung und
Gewandung dem von 61 sehr ähnlich, hält hier mit beiden
Händen einen zwischen seinen Beinen stehenden Widder,
der den Kopf zu ihm zurückwendet. Neben ihm lagert
sein Hund, der sich nach Aura umschaut. Im Uebrigen
ist die Heerde auf zwei mit den Köpfen gegen einander
stossende Böcke beschränkt, die auf einem Felsen über dem
Kopfe des Hirten angebracht sind.
Die wegfahrende Luna der zweiten Scene hat die
Zügel nach Wagenlenkerart um den Leib geschlungen.
Der vor ihr herfliegende Flügelknabe, von dessen Fackel
die Flamme und ein Puntello über dem Joch der Pferde
erhalten sind, ähnelt in der Haartracht und den Gesichts-
KNDYMION
letzteren ist, was gleichfalls von Eichler übersehen wurde,
ergänzt und zwar verkehrter Weise mit Widderhörnern.
Eine junge Ziege klimmt von dem Absatz zu dem Gipfel
empor, auf dem ein bekränzter Altar mit Früchten und ein
Baum stehen. Davor lagert eine weitere Ziege.
Die links folgende zweite Scene zeigt die wegfahrende
Luna, die, wie auf 58, nach Endymion zurückblickt. Von
dem über den Rossen schwebenden Hesperus sind nur
der linke Fuss und der rechte Flügel antik. Unter dem
Gespann taucht Tellus bis zur Brust aus dem Boden auf,
erstaunt die Linke erhebend. Sie trägt einen die rechte Brust
freilassenden Chiton und einen bogenförmig sich wölben-
den Mantel, unter welchem links ihr heiliges Thier, die
Schlange, zum Vorschein kommt. Der Kopf ist, was Eichler
übersehen hat, aber die Nuova Descrizione bestätigt, modern.
Links schliesst ein Baum die Darstellung ab. Der Wagen
der Luna ist in beiden Scenen mit dem Reliefbild eines
Centauren geschmückt, der, nach links sprengend, einen
Bogen in der Hand hält und eben geschossen zu haben
scheint. Gemeint ist gewiss das Sternbild des Schützen.
Doch vermag ich nicht zu sagen, ob dieses zu einer der
allegorischen Deutungen des Endymionmythus in Beziehung
gesetzt werden kann.
Auf der rechten Schmalseite Fig.6lb ein jugendlicher
Hirt in der Exomis, der mit gekreuzten Beinen auf seinen
Stab gelehnt dasteht und das Gesicht in die linke Hand
stützt; vgl.75'a.77b. Vor ihm ein gelagertes und ein stehendes
Rind und ein auf einem Felsen liegendes Schaf. Rechts
ein Baum.
Die linke Schmalseite Fig. 61 a ist nur abbozzirt.
Doch erkennt man links eine sitzende Figur, ohne Zweifel
wieder einen Hirten, rechts zwischen zwei Bäumen zwei
Thiere auf einem Felsvorsprung und unten ein drittes.
Sorgfältige Arbeit aus der ersten Hälfte des zweiten
Jahrhunderts.
62) P. Mantua, Museo. Fig. 62. L. 2,10. H. 0,50.
Rh. 0,05. Zeichnung von Eichler 1880.
Abbildung: Labus Museo deUa R. Accademia dl Mantova II 1 834
tav. 4.5.
Litteratur: Carli Memorie suW Accademia dt Mantova (Cod.
Sien. Filz. IX 7 A) nr. 14; Ders. Dissertazioni due sulT impresa dcgli
Argonauti e sopra an antico bassorilievo rappresentante la favola di
Medea 1785 p. 201; Borsa Museo della Reale Accademia di Mantova
1790/». %A.sqq.; Millin Voyage dans le Milanais 1817 II p. 288;
Labus a. a. O. p. 272 ff; Cardinali a. a. O. p. 122 n. 5 ; O. Jahn
a. a. O. p. 51 ff. (qj^); Garrucci Monumenü del Museo Lateranense
1861 p. 58; Gerhard a. a. O. S. 271 A. 15 (D); Conze Archäo-
logischer Anzeiger 1867 S. 105*; Heydemann MittheiJungen aus den
Antikensammlungen in Ober- und Mittelitalien (Drittes Hallisches
Winckclmannsprogramm) 1879 S. 9 Nr. 45; Dütschke Antike Bild-
werke in Oberitalicn IV 1880 S. 366 Nr. 846; Winnefeld Hypnos
1 8 86 S. 20; Steuding in Roschers Mythologischem Lexikon II S. 2117.
Ziemlich genaue Replik von 61, die hauptsächlich in
folgenden Punkten abweicht. In der Hand des Endymion
fehlen die Speere. Somnus ist nicht im Einschlummern,
sondern wirklich schlafend dargestellt. Die Augen sind ge-
schlossen, das nach rechts gewandte Gesicht ruht in der
linken Hand, die Kopfflügel sind nicht wie auf 61 gehoben,
sondern liegen geschlossen am Scheitel. Die rechte Hand
hält statt des Zweiges von 61 ein Horn, dem der Schlaf-
saft entströmt. Latmus ist hier als nackter Jüngling mit
struppigem Haar dargestellt. Er greift mit der Rechten in
die Krone eines Oelbaums, während die Linke auf den
Felsen gestützt ist. Der den Mantel des Endymion weg-
ziehende Amor blickt neugierig auf den Schlafenden; der
die Luna geleitende trägt lange Locken und Scheitelflechte;
mit der Rechten, deren Stelle durch den Bruch am Ge-
wand der Luna bestimmt ist, machte er wohl denselben
auffordernden Gestus, wie auf 64 (vgl. 51), während die
Linke vielleicht das rechte Knie des Endymion berührte,
an dem ein auf unsrer Abbildung nicht sichtbarer Ansatz
erhalten ist. Der dritte Amor, der vor Luna schwebend
ihren Mantel fasst, scheint in der ausgestreckten Linken
eine Fackel gehalten zu haben, von der die Puntelli über
seinem rechten Füsschen und an der linken Flügelspitze
herrühren; vgl. 64. Auch er hat Scheitelflechte und kurze
Locken. Der entsprechende Amor links ist weggeblieben.
Der Amor auf dem vorderen Pferd setzt das vorgestreckte
rechte Füsschen auf das Joch, fasst mit der Rechten die
Zügel und hält in der Linken entweder die Peitsche
(vgl. 40. 47. 48) oder wie auf 64 ein Vexillum. Hinter
dem Gespann ein Oelbaum; die kleine Luna mit dem
Sternbild des Krebses ist fortgeblieben. An Aura wird,
wie zuerst Conze constatirt hat, unter den Falten des
Chitons ganz deutlich ein männliches Glied sichtbar. Da
sich diese hermaphroditische Bildung unter so vielen
Fällen nur dies eine Mal findet, so kommt sie für die
Deutung der Figur schwerlich in Betracht. Wenn also das
Relief nicht an dieser Stelle überarbeitet sein sollte, so
wird man wohl mit Heydemann anzunehmen haben, dass
der Verfertiger den Faltenwurf seiner Vorlage (vgl. 61. 64)
missverstanden hat. Der Hirt, an Gestalt, Stellung und
Gewandung dem von 61 sehr ähnlich, hält hier mit beiden
Händen einen zwischen seinen Beinen stehenden Widder,
der den Kopf zu ihm zurückwendet. Neben ihm lagert
sein Hund, der sich nach Aura umschaut. Im Uebrigen
ist die Heerde auf zwei mit den Köpfen gegen einander
stossende Böcke beschränkt, die auf einem Felsen über dem
Kopfe des Hirten angebracht sind.
Die wegfahrende Luna der zweiten Scene hat die
Zügel nach Wagenlenkerart um den Leib geschlungen.
Der vor ihr herfliegende Flügelknabe, von dessen Fackel
die Flamme und ein Puntello über dem Joch der Pferde
erhalten sind, ähnelt in der Haartracht und den Gesichts-