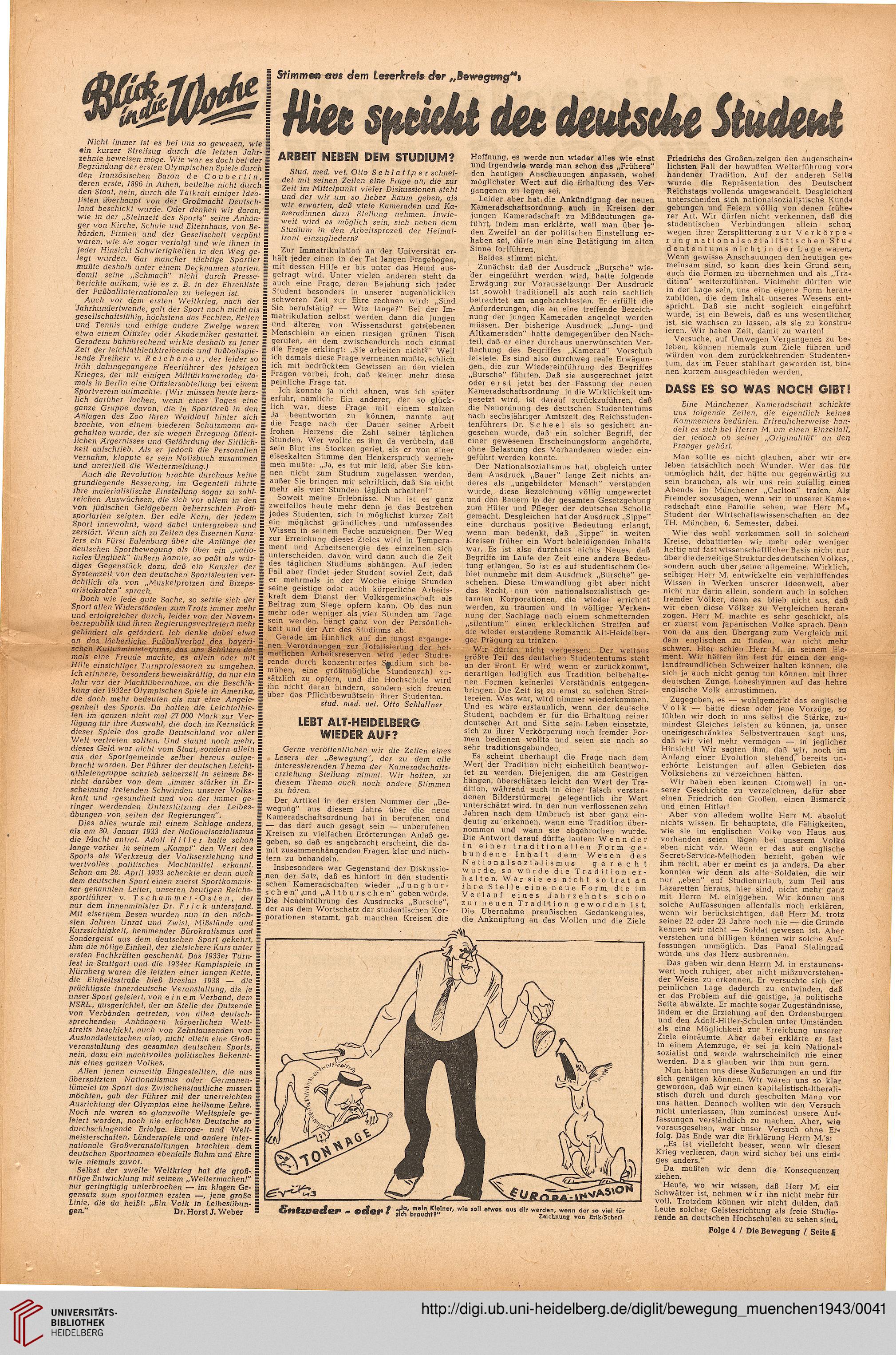| Stimmen -avs dem Leserkreis efer „Bewegimg*41
Nicht immer ist es bei uns so gewesen, wie
•in kurzer Streiizug durch die letzten Jahr-
zehnte beweisen möge. Wie war es doch bei der
Begründung der ersten Olympischen Spiele durch
den Iranzösischen Baron de C o ub e r t i n ,
deren erste, 1896 in Athen, beileibe nicht durch
den Staat, nein, durch die Tatkrait einiger Idea- \
listen überhaupt von der Großmacht Deutsch- !
land beschickt wurde. Oder denken wir daran, !
wie in der „Steinzeit des Sports" seine Anhän- j
ger von Kirche, Schule und Elternhaus, von Be- j
hörden, Firmen und der Gesellschalt verpönt j
waren, wie sie sogar verfolgt und wie ihnen in j
jeder Hinsicht Schwierigkeiten in den Weg ge- \
legt wurden. Gar mancher tüchtige Sportler !
mußte deshalb unter einem Decknamen starten, ;
damit seine „Schmach" nicht durch Presse- j
berichte auikam, wie es z. B. in der Ehrenliste j
der Fußballinternationalen zu belegen ist.
Auch vor dem ersten Weltkrieg, nach der ;
Jahrhundertwende, galt der Sport noch nicht als j
gesellschaltsiähig, höchstens das Fechten, Reiten !
und Tennis und einige andere Zweige waren i
etwa einem Oltizier oder Akademiker gestattet. \
Geradezu bahnbrechend wirkte deshalb zu jener j
Zeit der leichtathletiktreibende und iuRhallspie- J
lende Freiherr v. Reichenau, der leider so \
früh dahingegangene Heerlührer des jetzigen ■
Krieges, der mit einigen Militärkameraden da- l
mals in Berlin eine Othziersabteilung bei einem l
Sportverein aulmachte. (Wir müssen heule herz- [
lieh darüber lachen, wenn eines Tages eine !
ganze Gruppe davon, die in Sportdreß in den l
Anlagen des Zoo ihren Waldlauf hinter sich [
brachte, von einem biederen Schutzmann an- \
gehalten wurde, der sie wegen Erregung öffent- i
liehen Ärgernisses und Gefährdung der Sittlich- l
keit aulschrieb. Als er jedoch die Personalien \
vernahm, klappte er sein Notizbuch zusammen ■
und unterließ die Weitermeldung.)
Auch die Revolution brachte durchaus keine ;
grundlegende Besserung, im Gegenteil lührte ;
ihre materialistische Einstellung sogar zu zahl- 2
reichen Auswüchsen, die sich vor allem in den Z
von jüdischen Geldgebern beherrschten Profi- •
Sportarten zeigten. Der edle Kern, der jedem Z
Sport innewohnt, ward dabei untergraben und Z
zerstört. Wenn sich zu Zeiten des Eisernen Kanz- «
lers ein Fürst Eulenburg über die Anlange der ■
deutschen Sportbewegung als über ein „natio- Z
nales Unglück" äußern konnte, so paßt als wür- Z
diges Gegenstück dazu, daß ein Kanzler der j
Systemzeit von den deutschen Sportsleulen ver- Z
ächtlich als von „Muskelprotzen und Bizeps- Z
aristokraten" sprach. z
Doch wie jede gute Sache, so setzte sich der ;
Sport allen Widerständen zum Trotz immer mehr 5
und erfolgreicher durch, leider von der Novem- Z
berrepublik und ihren Regierungsvertretern mehr «
gehindert als gelördert. Ich denke dabei etwa ■
an das lächerliche Fußballverbot des bayeri- I
sehen Kultusministeriums, das uns Schülern da- z
mals eine Freude machte, es allein oder mit •
Hille einsichtiger Turnprolessoren zu umgehen. ■
Ich erinnere, besonders beweiskrältig, da nur ein Z
Jahr vor der Machtübernahme, an die Beschik- Z
kung der 1932er Olympischen Spiele in Amerika, ■
die doch mehr bedeuten als nur eine Angele- Z
genheit des Sports. Da hatten die Leichtalhle- Z
ten im ganzen nicht mal 27 000 Mark zur Ver- z
fügung für ihre Auswahl, die doch im Kernstück «
dieser Spiele das große Deutschland vor aller Z
Welt vertreten sollten. Und staunt noch mehr, z
dieses Geld war nicht vom Staat, sondern allein ■
aus der Sportgemeinde selber heraus aulge- Z
bracht worden. Der Führer der deutschen Leicht- Z
athletengruppe schrieb seinerzeit in seinem Be- ■
rieht darüber von dem „immer stärker in Er- S
scheinung tretenden Schwinden unserer Volks- Z
kraft und -gesundheit und von der immer ge- ;
ringer werdenden Unterstützung der Leibes- •
Übungen von Seiten der Regierungen".
Dies alles wurde mit einem Schlage anders, z
als am 30. Januar 1933 der Nationalsozialismus ;
die Macht antrat. Adolf Hitler hatte schont
lange vorher in seinem „Kamp!" den Werl des Z
Sports als Werkzeug der Volkserziehung und z
wertvolles politisches Machtmittel erkannt. ■
Schon am 28. April 1933 schenkte er denn auch Z
dem deutschen Sport einen zuerst Sportkommis- Z
sar genannten Leiter, unseren heutigen Reichs- ■
sportführer v. Tschammer-Osten, der Z
nur dem Innenminister Dr. Fr ick unterstand. Z
Mit eisernem Besen wurden nun in den nach- z
sten Jahren Unrat und Zwist, Mißstände und •
Kurzsichtigkeit, hemmender Bürokralismus und Z
Sondergeist aus dem deutschen Sport gekehrt, Z
ihm die nötige Einheit, der zielsichere Kurs unter ;
ersten Fachkrälten geschenkt. Das 1933er Turn- «
lest in Stuttgart und die 1934er Kamptspiele in Z
Nürnberg waren die letzten einer langen Kette, z
die Einheitsstraße hieß Breslau 1938 — die ;
prächtigste innerdeutsche Veranstaltung, die je Z
unser Sport geleiert, von einem Verband, dem Z
NSRL., ausgerichtet, der an Stelle der Dutzende ■
von Verbänden getreten, von allen deutsch- ;
sprechenden Anhängern körperlichen Welt- Z
Streits beschickt, auch von Zehntausenden von Z
Ausländsdeutschen also, nicht allein eine Groß- ;
Veranstaltung des gesamten deutschen Sports, ;
nein, dazu ein machtvolles politisches Bekennl- Z
nis eines ganzen Volkes.
Allen jenen einseitig Eingestellten, die aus \
überspitztem Nationalismus oder Germanen- Z
iümelei im Sport das Zwischenstaatliche missen Z
möchten, gab der Führer mit der unerreichten ■
Ausrichtung der Olympias eine heilsame Lehre. ■
Noch nie waren so glanzvolle Weltspiele ge- Z
feiert worden, noch nie erlochten Deutsche so Z
durchschlagende Erlolge. Europa- und Welt- ■
meisterschalten, Länderspiele und andere inter- Z
nationale Großveranstaltungen brachten dem 2
deutschen Sportnamen ebenfalls Ruhm und Ehre ■
wie niemals zuvor. j
Selbst der zweite Weltkrieg hat die groß- Z
artige Entwicklung mit seinem „Weitermachen!" Z
nur geringfügig unterbrochen — im kla§en Ge- ■
gensalz zum sportarmen ersten —, jene große Z
Linie, die da heißt: „Ein Volk in Leibesübun- Z
gen." Dr. Horst J. Weber !
Hiet stttuk det deutsche SUtd&U
| ARBEIT NEBEN DEM STUDIUM?
Stud. med. vet. Otto Schlaftfier schnel-
! det mit seinen Zeilen eine Frage an, die zur
\ Zeit im Mittelpunkt vieler Diskussionen steht
\ und der wir um so lieber Raum geben, als
j wir erwarten, daß viele Kameraden und Ka-
! meradinnen dazu Stellung nehmen. Inwie-
weit wird es möglich sein, sich neben dem
Studium in den Arbeitsprozeß der Heimat-
front einzugliedern?
Zur Immatrikulation an der Universität er-
hält jeder einen in der Tat langen Fragebogen,
mit dessen Hilfe er bis unter das Hemd aus-
gefragt wird. Unter vielen anderen steht da
auch eine Frage, deren Bejahung sich jeder
Student besonders in unserer augenblicklich
schweren Zeit zur Ehre rechnen wird: „Sind
Sie berufstätig? — Wie lange?" Bei der Im-
matrikulation selbst werden dann die jungen
und älteren von Wissensdurst getriebenen
Menschlein an einen riesigen grünen Tisch
gerufen, an dem zwischendurch noch einmal
die Frage erklingt: „Sie arbeiten nicht?" Weil
ich damals diese Frage verneinen mußte, schlich
ich mit bedrücktem Gewissen an den vielen
Fragen vorbei, froh, daß keiner mehr diese
peinliche Frage tat.
Ich konnte ja nicht ahnen, was ich später
erfuhr, nämlich: Ein anderer, der so glück-
lich war, diese Frage mit einem stolzen
Ja beantworten zu können, nannte aut
die Frage nach der Dauer seiner Arbeit
frohen Herzens die Zahl seiner täglichen
Stunden. Wer wollte es ihm da verübeln, daß
sein Blut ins Stocken geriet, als er von einer
eiseskalten Stimme den Henkerspruch verneh-
men mußte: „Ja, es tut mir leid, aber Sie kön-
nen nicht zum Studium zugelassen werden,
außer Sie bringen mir schriftlich, daß Sie nicht
mehr als vier Stunden täglich arbeiten!"
Soweit meine Erlebnisse. Nun ist es ganz
zweifellos heute mehr denn je das Bestreben
jedes Studenten, sich in möglichst kurzer Zeit
ein möglichst gründliches und umfassendes
Wissen in seinem Fache anzueignen. Der Weg
zur Erreichung dieses Zieles wird in Tempera-
ment und Arbeitsenergie des einzelnen sich
unterscheiden, davon wird dann auch die Zeit
des täglichen Studiums abhängen. Auf jeden
Fall aber findet jeder Student soviel Zeit, daß
er mehrmals in der Woche einige Stunden
seine geistige oder auch körperliche Arbeits-
kraft dem Dienst der Volksgemeinschaft als
Beitrag zum Siege opfern kann. Ob das nun
mehr oder weniger als vier Stunden am Tage
sein werden, hängt ganz von der Persönlich-
keit und der Art des Studiums ab.
Gerade im Hinblick auf die jüngst ergange-
nen Verordnungen zur Totalisierung der hei-
matlichen Arbeitsreserven wird jeder Studie-
rende durch konzentriertes Sipdium sich be-
mühen, eine größtmögliche Stundenzahl zu-
sätzlich zu opfern, und die Hochschule wird
ihn nicht daran hindern, sondern sich freuen
über das Pflichtbewußtsein ihrer Studenten.
stud. med. vet. Otto Schlaflner
LEBT ALT-HEIDELBERG
WIEDER AUF?
Gerne veröffentlichen wir die Zeilen eines
» Lesers der „Bewegung", der zu dem alle
interessierenden Thema der Kameradschalts-
erziehung Stellung nimmt. Wir hoffen, zu
diesem Thema auch noch andere Stimmen
zu hören.
Der Artikel in der ersten Nummer der „Be-
wegung" aus diesem Jahre über die neue
Kameradschaftsordnung hat in berufenen und
— das darf auch gesagt sein — unberufenen
Kreisen zu vielfachen Erörterungen Anlaß ge-
geben, so daß es angebracht erscheint, die da-
mit zusammenhängenden Fragen klar und nüch-
tern zu behandeln.
Insbesondere war Gegenstand der Diskussio-
nen der Satz, daß es hinfort in den studenti-
schen Kameradschaften wieder „Jungbur-
schen" .und „A 11 b u r s c h e n" geben würde.
Die Neueinführung des Ausdrucks „Bursche",
der aus dem Wortschatz der studentischen Kor-
porationen stammt, gab manchen Kreisen die
Hoffnung, es werde nun wieder alles wie einst
und irgendwie werde man schon das „Frühere"
den heutigen Anschauungen anpassen, wobei
möglichster Wert auf die Erhaltung des Ver-
gangenen zu legen sei.
Leider aber hat, die Ankündigung der neuen
Kameradschaftsordnung, auch in Kreisen der
jungen Kameradschaft zu Mißdeutungen ge-
führt, indem man erklärte, weil man über je-
den Zweifel an der politischen Einstellung er-
haben sei, dürfe man eine Betätigung im alten
Sinne fortführen.
Beides stimmt nicht.
Zunächst: daß der Ausdruck „Bursche" wie-
der eingeführt werden wird, hatte folgende
Erwägung zur Voraussetzung: Der Ausdruck
ist sowohl traditionell als auch rein sachlich
betrachtet am angebrachtesten. Er erfüllt die
Anforderungen, die an eine treffende Bezeich-
nung der jungen Kameraden angelegt werden
müssen. Der bisherige Ausdruck „Jung- und
Altkameraden" hatte demgegenüber den Nach-
teil, daß er einer durchaus unerwünschten Ver-
flachung des Begriffes „Kamerad" Vorschub
leistete. Es sind also durchweg reale Erwägun-
gen, die zur Wiedereinführung des Begriffes
„Bursche" führten. Daß sie ausgerechnet jetzt
oder erst jetzt bei der Fassung der neuen
Kameradschaftsordnung in die Wirklichkeit um-
gesetzt wird, ist darauf zurückzuführen, daß
die Neuordnung des deutschen Studententums
nach sechsjähriger Amtszeit des Reichsstuden-
tenführers Dr. Scheel als so gesichert an-
gesehen wurde, daß ein solcher Begriff, der
einer gewesenen Erscheinungsform angehörte,
ohne Belastung des Vorhandenen wieder ein-
geführt werden konnte.
Der Nationalsozialismus hat, obgleich unter
dem Ausdruck „Bauer" lange Zeit nichts an-
deres als „ungebildeter Mensch" verstanden
wurde, diese Bezeichnung völlig umgewertet
und den Bauern in der gesamten Gesetzgebung
zum Hüter und Pfleger der deutschen Scholle
gemacht. Desgleichen hat der Ausdruck „Sippe"
eine durchaus positive Bedeutung erlangt,
wenn man bedenkt, daß „Sippe" in weiten
Kreisen früher ein Wort beleidigenden Inhalts
war. Es ist also durchaus nichts Neues, daß
Begriffe im Laufe der Zeit eine andere Bedeu-
tung erlangen. So ist es auf studentischem Ge-
biet nunmehr mit dem Ausdruck „Bursche" ge-
schehen. Diese Umwandlung gibt aber nicht
das Recht, nun von nationalsozialistisch ge-
tarnten Korporationen, die wieder errichtet
werden, zu träumen und in völliger Verken-
nung der Sachlage nach einem schmetternden
„silentium" einen erklecklichen Streifen auf
die wieder erstandene Romantik Alt-Heidelber-
ger Prägung zu trinken.
Wir dürfen nicht vergessen: Der weitaus
größte Teil des deutschen Studententums steht
an der Front. Er wird, wenn er zurückkommt,
derartigen lediglich aus Tradition beibehalte-
nen Formen keinerlei Verständnis entgegen-
bringen. Die Zeit ist zu ernst zu solchen Strei-
tereien. Was war, wird nimmer wiederkommen.
Und es wäre erstaunlich, wenn der deutsche
Student, nachdem er für die Erhaltung reiner
deutscher Art und Sitte sein Leben einsetzte,
sich zu ihrer Verkörperung noch fremder For-
men bedienen wollte und seien sie noch so
sehr traditionsgebunden.
Es scheint überhaupt die Frage nach dem
Wert der Tradition nicht einheitlich beantwor-
tet zu werden. Diejenigen, die am Gestrigen
hängen, überschätzen leicht den Wert der Tra-
dition, während auch in einer falsch verstan-
denen Bilderstürmerei gelegentlich ihr Wert
unterschätzt wird. In den nun verflossenen zehn
Jahren nach dem Umbruch ist aber ganz ein-
deutig zu erkennen, wann eine Tradition über-
nommen und wann sie abgebrochen wurde.
Die Antwort darauf dürfte lauten: Wenn der
in einer traditionellen Form ge-
bundene Inhalt dem Wesen des
Nationalsozialismus gerecht
wurde, so wurde die Tradition er-
halten. War sie es nicht, so trat, an
ihre Stelle eine neue Form, die im
Verlauf eines Jahrzehnts schon
zur neuen Tradition geworden ist.
Die Übernahme preußischen Gedankengutes,
die Anknüpfung an das Wollen und die Ziele
itnttuedet* » eder* / 'feh'b"*'cht?"ner' w'e *°" **wc" auj werden' wenn der s° vie| für
Zeichnung von Erik/Scherl
Friedrichs des Großen.zeigen den augenschein*
lichsten Fall der bewußten Weiterführung vor-i
handener Tradition. Auf der andereh Seite!
wurde die Repräsentation des Deutschem
Reichstags vollends umgewandelt. Desgleichen!
unterscheiden sich nationalsozialistische Kund*
gebungen und Feiern völlig von denen frühe*
rer Art. Wir dürfen nicht verkennen, daß dia
studentischen Verbindungen allein schon,
wegen ihrer Zersplitterung zur Verkörpe*
rung nationalsozialistischen S t u *
dententums nicht in der Lage waren«
Wenn gewisse Anschauungen den heutigen ge*
meinsam sind, so kann dies kein Grund sein,
auch die Formen zu übernehmen und als „Tra-:
dition" weiterzuführen. Vielmehr dürften wir
in der Lage sein, uns eine eigene Form heran*
zubilden, die dem Iahalt unseres Wesens ent-
spricht. Daß sie nicht sogleich eingeführt
wurde, ist ein Beweis, daß es uns wesentlicher,
ist, sie wachsen zu lassen, als sie zu konstru-
ieren. Wir haben Zeit, damit zu warten!
Versuche, auf Umwegen Veigangenes zu be*
leben, können niemals zum Ziele führen und
würden von dem zurückkehrenden Studenten*
tum, das im Feuer stahlhart geworden ist, bin*
nen kurzem ausgeschieden werden.
DASS ES SO WAS NOCH GIBT!
Eine Münchener Kameradschaft schickte
uns folgende Zeilen, die eigentlich keines
Kommentars bedürfen. Erfreulicherweise han-
delt es sich bei Herrn M. um einen Einzellall,
der jedoch ob seiner „Originalität" an den
Pranger gehört.
Man sollte es nicht glauben, aber wir er*
leben tatsächlich noch Wunder. Wer das für
unmöglich hält, der hätte nur gegenwärtig zu
sein brauchen, als wir uns rein zufällig eines
Abends im Münchener „Carlton" trafen. Als
Fremder sozusagen, wenn wir in unserer Käme*
radschaft eine Familie sehen, war Herr M.*
Student der Wirtschaftswissenschaften an der
TH. München, 6. Semester, dabei.
Wie das wohl vorkommen soll in solchem:
Kreise, debattierten wir mehr oder weniger
heftig auf fast wissenschaftlicher Basis nicht nur
über die derzeitige Struktur des deutschen Volkes, .
sondern auch überfeine allgemeine. Wirklich,
selbiger Herr M. entwickelte ein verblüffendes
Wissen in Werken unserer Ideenwelt, aber
nicht nur darin allein, sondern auch in solchen
fremder Völker, denn es blieb nicht aus, daß
wir eben diese Völker zu Vergleichen heran-
zogen. Herr M. machte es sehr geschickt, als
er zuerst vom Japanischen Volke sprach. Denn
von da aus den Ubergang zum Vergleich mit
dem englischen zu finden, war nicht mehr
schwer. Hier schien Herr M. in seinem Ele-
ment. Wir hätten ihn fast für einen der eng-
landfreundlichen Schweizer halten können, die
sich ja auch nicht genug tun können, mit ihrer
deutschen Zunge Lobeshymnen auf das hehre
englische Volk anzustimmen.
Zugegeben, es — wohlgemerkt das englische
Volk — hätte diese oder jene Vorzüge, so
fühlen wir doch in uns selbst die Stärke, zu-
mindest Gleiches leisten zu können, ja, unser
uneingeschränktes Selbstvertrauen sagt uns,
daß wir viel mehr vermögen — in jeglicher
Hinsicht! Wir sagten ihm, daß wir, noch im
Anfang einer Evolution stehend,' bereits un-
erhörte Leistungen auf - allen Gebieten des
Volkslebens zu verzeichnen hätten.
Wir haben eben keinen Cromwell in un*
serer Geschichte zu verzeichnen, dafür aber
einen Friedrich den Großen, einen Bismarck
und einen Hitler!
Aber von alledem wollte Herr M. absolut
nichts wissen. Er behauptete, die Fähigkeiten,
wie sie im englischen Volke von Haus aus
vorhanden seien lägen bei unserem Volke
eben nicht vor. Wenn er das auf englische
Secret-Service-Methoden bezieht, geben wir
ihm recht, aber er meint es ja anders. Da aber
konnten wir denn als alte Soldaten, die wir
nur „eben" auf Studienurlaub, zum Teil aus
Lazaretten heraus, hier sind, nicht mehr ganz
mit Herrn M. einiggehen. Wir können uns
solche Auffassungen allenfalls noch erklären,
wenn wir berücksichtigen, daß Herr M. trotz
seiner 22 oder 23 Jahre noch nie — die Gründe
kennen wir nicht — Soldat gewesen ist. Aber
verstehen und billigen können wir solche Auf-
fassungen unmöglich. Das Fanal Stalingrad
würde uns das Herz ausbrennen.
Das gaben wir denn Herrn M. in erstaunens-*
wert noch ruhiger, aber nicht mißzuverstehen-
der Weise zu erkennen. Er versuchte sich der
peinlichen Lage dadurch zu entwinden, daß
er das Problem auf die geistige, ja politische
Seite abwälzte. Er machte sogar Zugeständnisse,
indem er die Erziehung auf den Ordensburgen:
und den Adolf-Hitler-Schulen unter Umständen
als eine Möglichkeit zur Erreichung unserer
Ziele einräumte Aber dabei erklärte er fast
in einem Atemzuge, er sei ja kein National-
sozialist und werde wahrscheinlich nie einer
werden. Das glauben wir ihm nun gern.
Nun hätten uns diese Äußerungen an und für
sich genügen können. Wir waren uns so klar,
geworden, daß wir einen kapitalistisch-liberali-
stisch durch und durch geschulten Mann vor
uns hatten. Dennoch wollten wir den Versuch
nicht unterlassen, ihm zumindest unsere Auf*
fassungen verständlich zu machen. Aber, wiei
vorausgesehen, war unser Versuch ohne Er*
folg. Das Ende war die Erklärung Herrn M.'s:
„Es ist vielleicht besser, wenn wir diese«
Krieg verlieien, dann wird sicher bei uns eini*
ges anders."
Da mußten wir denn die Konsequenzen
ziehen.
Heute, wo wir wissen, daß Herr M. eilt
Schwätzer ist, nehmen w i r ihn nicht mehr für
voll. Trotzdem können wir nicht dulden, daß
Leute solcher Geistesrichtung als freie Studie-
rende an deutschen Hochschulen zu sehen sind«
Folge 4 / Die Bewegung / Seite I
Nicht immer ist es bei uns so gewesen, wie
•in kurzer Streiizug durch die letzten Jahr-
zehnte beweisen möge. Wie war es doch bei der
Begründung der ersten Olympischen Spiele durch
den Iranzösischen Baron de C o ub e r t i n ,
deren erste, 1896 in Athen, beileibe nicht durch
den Staat, nein, durch die Tatkrait einiger Idea- \
listen überhaupt von der Großmacht Deutsch- !
land beschickt wurde. Oder denken wir daran, !
wie in der „Steinzeit des Sports" seine Anhän- j
ger von Kirche, Schule und Elternhaus, von Be- j
hörden, Firmen und der Gesellschalt verpönt j
waren, wie sie sogar verfolgt und wie ihnen in j
jeder Hinsicht Schwierigkeiten in den Weg ge- \
legt wurden. Gar mancher tüchtige Sportler !
mußte deshalb unter einem Decknamen starten, ;
damit seine „Schmach" nicht durch Presse- j
berichte auikam, wie es z. B. in der Ehrenliste j
der Fußballinternationalen zu belegen ist.
Auch vor dem ersten Weltkrieg, nach der ;
Jahrhundertwende, galt der Sport noch nicht als j
gesellschaltsiähig, höchstens das Fechten, Reiten !
und Tennis und einige andere Zweige waren i
etwa einem Oltizier oder Akademiker gestattet. \
Geradezu bahnbrechend wirkte deshalb zu jener j
Zeit der leichtathletiktreibende und iuRhallspie- J
lende Freiherr v. Reichenau, der leider so \
früh dahingegangene Heerlührer des jetzigen ■
Krieges, der mit einigen Militärkameraden da- l
mals in Berlin eine Othziersabteilung bei einem l
Sportverein aulmachte. (Wir müssen heule herz- [
lieh darüber lachen, wenn eines Tages eine !
ganze Gruppe davon, die in Sportdreß in den l
Anlagen des Zoo ihren Waldlauf hinter sich [
brachte, von einem biederen Schutzmann an- \
gehalten wurde, der sie wegen Erregung öffent- i
liehen Ärgernisses und Gefährdung der Sittlich- l
keit aulschrieb. Als er jedoch die Personalien \
vernahm, klappte er sein Notizbuch zusammen ■
und unterließ die Weitermeldung.)
Auch die Revolution brachte durchaus keine ;
grundlegende Besserung, im Gegenteil lührte ;
ihre materialistische Einstellung sogar zu zahl- 2
reichen Auswüchsen, die sich vor allem in den Z
von jüdischen Geldgebern beherrschten Profi- •
Sportarten zeigten. Der edle Kern, der jedem Z
Sport innewohnt, ward dabei untergraben und Z
zerstört. Wenn sich zu Zeiten des Eisernen Kanz- «
lers ein Fürst Eulenburg über die Anlange der ■
deutschen Sportbewegung als über ein „natio- Z
nales Unglück" äußern konnte, so paßt als wür- Z
diges Gegenstück dazu, daß ein Kanzler der j
Systemzeit von den deutschen Sportsleulen ver- Z
ächtlich als von „Muskelprotzen und Bizeps- Z
aristokraten" sprach. z
Doch wie jede gute Sache, so setzte sich der ;
Sport allen Widerständen zum Trotz immer mehr 5
und erfolgreicher durch, leider von der Novem- Z
berrepublik und ihren Regierungsvertretern mehr «
gehindert als gelördert. Ich denke dabei etwa ■
an das lächerliche Fußballverbot des bayeri- I
sehen Kultusministeriums, das uns Schülern da- z
mals eine Freude machte, es allein oder mit •
Hille einsichtiger Turnprolessoren zu umgehen. ■
Ich erinnere, besonders beweiskrältig, da nur ein Z
Jahr vor der Machtübernahme, an die Beschik- Z
kung der 1932er Olympischen Spiele in Amerika, ■
die doch mehr bedeuten als nur eine Angele- Z
genheit des Sports. Da hatten die Leichtalhle- Z
ten im ganzen nicht mal 27 000 Mark zur Ver- z
fügung für ihre Auswahl, die doch im Kernstück «
dieser Spiele das große Deutschland vor aller Z
Welt vertreten sollten. Und staunt noch mehr, z
dieses Geld war nicht vom Staat, sondern allein ■
aus der Sportgemeinde selber heraus aulge- Z
bracht worden. Der Führer der deutschen Leicht- Z
athletengruppe schrieb seinerzeit in seinem Be- ■
rieht darüber von dem „immer stärker in Er- S
scheinung tretenden Schwinden unserer Volks- Z
kraft und -gesundheit und von der immer ge- ;
ringer werdenden Unterstützung der Leibes- •
Übungen von Seiten der Regierungen".
Dies alles wurde mit einem Schlage anders, z
als am 30. Januar 1933 der Nationalsozialismus ;
die Macht antrat. Adolf Hitler hatte schont
lange vorher in seinem „Kamp!" den Werl des Z
Sports als Werkzeug der Volkserziehung und z
wertvolles politisches Machtmittel erkannt. ■
Schon am 28. April 1933 schenkte er denn auch Z
dem deutschen Sport einen zuerst Sportkommis- Z
sar genannten Leiter, unseren heutigen Reichs- ■
sportführer v. Tschammer-Osten, der Z
nur dem Innenminister Dr. Fr ick unterstand. Z
Mit eisernem Besen wurden nun in den nach- z
sten Jahren Unrat und Zwist, Mißstände und •
Kurzsichtigkeit, hemmender Bürokralismus und Z
Sondergeist aus dem deutschen Sport gekehrt, Z
ihm die nötige Einheit, der zielsichere Kurs unter ;
ersten Fachkrälten geschenkt. Das 1933er Turn- «
lest in Stuttgart und die 1934er Kamptspiele in Z
Nürnberg waren die letzten einer langen Kette, z
die Einheitsstraße hieß Breslau 1938 — die ;
prächtigste innerdeutsche Veranstaltung, die je Z
unser Sport geleiert, von einem Verband, dem Z
NSRL., ausgerichtet, der an Stelle der Dutzende ■
von Verbänden getreten, von allen deutsch- ;
sprechenden Anhängern körperlichen Welt- Z
Streits beschickt, auch von Zehntausenden von Z
Ausländsdeutschen also, nicht allein eine Groß- ;
Veranstaltung des gesamten deutschen Sports, ;
nein, dazu ein machtvolles politisches Bekennl- Z
nis eines ganzen Volkes.
Allen jenen einseitig Eingestellten, die aus \
überspitztem Nationalismus oder Germanen- Z
iümelei im Sport das Zwischenstaatliche missen Z
möchten, gab der Führer mit der unerreichten ■
Ausrichtung der Olympias eine heilsame Lehre. ■
Noch nie waren so glanzvolle Weltspiele ge- Z
feiert worden, noch nie erlochten Deutsche so Z
durchschlagende Erlolge. Europa- und Welt- ■
meisterschalten, Länderspiele und andere inter- Z
nationale Großveranstaltungen brachten dem 2
deutschen Sportnamen ebenfalls Ruhm und Ehre ■
wie niemals zuvor. j
Selbst der zweite Weltkrieg hat die groß- Z
artige Entwicklung mit seinem „Weitermachen!" Z
nur geringfügig unterbrochen — im kla§en Ge- ■
gensalz zum sportarmen ersten —, jene große Z
Linie, die da heißt: „Ein Volk in Leibesübun- Z
gen." Dr. Horst J. Weber !
Hiet stttuk det deutsche SUtd&U
| ARBEIT NEBEN DEM STUDIUM?
Stud. med. vet. Otto Schlaftfier schnel-
! det mit seinen Zeilen eine Frage an, die zur
\ Zeit im Mittelpunkt vieler Diskussionen steht
\ und der wir um so lieber Raum geben, als
j wir erwarten, daß viele Kameraden und Ka-
! meradinnen dazu Stellung nehmen. Inwie-
weit wird es möglich sein, sich neben dem
Studium in den Arbeitsprozeß der Heimat-
front einzugliedern?
Zur Immatrikulation an der Universität er-
hält jeder einen in der Tat langen Fragebogen,
mit dessen Hilfe er bis unter das Hemd aus-
gefragt wird. Unter vielen anderen steht da
auch eine Frage, deren Bejahung sich jeder
Student besonders in unserer augenblicklich
schweren Zeit zur Ehre rechnen wird: „Sind
Sie berufstätig? — Wie lange?" Bei der Im-
matrikulation selbst werden dann die jungen
und älteren von Wissensdurst getriebenen
Menschlein an einen riesigen grünen Tisch
gerufen, an dem zwischendurch noch einmal
die Frage erklingt: „Sie arbeiten nicht?" Weil
ich damals diese Frage verneinen mußte, schlich
ich mit bedrücktem Gewissen an den vielen
Fragen vorbei, froh, daß keiner mehr diese
peinliche Frage tat.
Ich konnte ja nicht ahnen, was ich später
erfuhr, nämlich: Ein anderer, der so glück-
lich war, diese Frage mit einem stolzen
Ja beantworten zu können, nannte aut
die Frage nach der Dauer seiner Arbeit
frohen Herzens die Zahl seiner täglichen
Stunden. Wer wollte es ihm da verübeln, daß
sein Blut ins Stocken geriet, als er von einer
eiseskalten Stimme den Henkerspruch verneh-
men mußte: „Ja, es tut mir leid, aber Sie kön-
nen nicht zum Studium zugelassen werden,
außer Sie bringen mir schriftlich, daß Sie nicht
mehr als vier Stunden täglich arbeiten!"
Soweit meine Erlebnisse. Nun ist es ganz
zweifellos heute mehr denn je das Bestreben
jedes Studenten, sich in möglichst kurzer Zeit
ein möglichst gründliches und umfassendes
Wissen in seinem Fache anzueignen. Der Weg
zur Erreichung dieses Zieles wird in Tempera-
ment und Arbeitsenergie des einzelnen sich
unterscheiden, davon wird dann auch die Zeit
des täglichen Studiums abhängen. Auf jeden
Fall aber findet jeder Student soviel Zeit, daß
er mehrmals in der Woche einige Stunden
seine geistige oder auch körperliche Arbeits-
kraft dem Dienst der Volksgemeinschaft als
Beitrag zum Siege opfern kann. Ob das nun
mehr oder weniger als vier Stunden am Tage
sein werden, hängt ganz von der Persönlich-
keit und der Art des Studiums ab.
Gerade im Hinblick auf die jüngst ergange-
nen Verordnungen zur Totalisierung der hei-
matlichen Arbeitsreserven wird jeder Studie-
rende durch konzentriertes Sipdium sich be-
mühen, eine größtmögliche Stundenzahl zu-
sätzlich zu opfern, und die Hochschule wird
ihn nicht daran hindern, sondern sich freuen
über das Pflichtbewußtsein ihrer Studenten.
stud. med. vet. Otto Schlaflner
LEBT ALT-HEIDELBERG
WIEDER AUF?
Gerne veröffentlichen wir die Zeilen eines
» Lesers der „Bewegung", der zu dem alle
interessierenden Thema der Kameradschalts-
erziehung Stellung nimmt. Wir hoffen, zu
diesem Thema auch noch andere Stimmen
zu hören.
Der Artikel in der ersten Nummer der „Be-
wegung" aus diesem Jahre über die neue
Kameradschaftsordnung hat in berufenen und
— das darf auch gesagt sein — unberufenen
Kreisen zu vielfachen Erörterungen Anlaß ge-
geben, so daß es angebracht erscheint, die da-
mit zusammenhängenden Fragen klar und nüch-
tern zu behandeln.
Insbesondere war Gegenstand der Diskussio-
nen der Satz, daß es hinfort in den studenti-
schen Kameradschaften wieder „Jungbur-
schen" .und „A 11 b u r s c h e n" geben würde.
Die Neueinführung des Ausdrucks „Bursche",
der aus dem Wortschatz der studentischen Kor-
porationen stammt, gab manchen Kreisen die
Hoffnung, es werde nun wieder alles wie einst
und irgendwie werde man schon das „Frühere"
den heutigen Anschauungen anpassen, wobei
möglichster Wert auf die Erhaltung des Ver-
gangenen zu legen sei.
Leider aber hat, die Ankündigung der neuen
Kameradschaftsordnung, auch in Kreisen der
jungen Kameradschaft zu Mißdeutungen ge-
führt, indem man erklärte, weil man über je-
den Zweifel an der politischen Einstellung er-
haben sei, dürfe man eine Betätigung im alten
Sinne fortführen.
Beides stimmt nicht.
Zunächst: daß der Ausdruck „Bursche" wie-
der eingeführt werden wird, hatte folgende
Erwägung zur Voraussetzung: Der Ausdruck
ist sowohl traditionell als auch rein sachlich
betrachtet am angebrachtesten. Er erfüllt die
Anforderungen, die an eine treffende Bezeich-
nung der jungen Kameraden angelegt werden
müssen. Der bisherige Ausdruck „Jung- und
Altkameraden" hatte demgegenüber den Nach-
teil, daß er einer durchaus unerwünschten Ver-
flachung des Begriffes „Kamerad" Vorschub
leistete. Es sind also durchweg reale Erwägun-
gen, die zur Wiedereinführung des Begriffes
„Bursche" führten. Daß sie ausgerechnet jetzt
oder erst jetzt bei der Fassung der neuen
Kameradschaftsordnung in die Wirklichkeit um-
gesetzt wird, ist darauf zurückzuführen, daß
die Neuordnung des deutschen Studententums
nach sechsjähriger Amtszeit des Reichsstuden-
tenführers Dr. Scheel als so gesichert an-
gesehen wurde, daß ein solcher Begriff, der
einer gewesenen Erscheinungsform angehörte,
ohne Belastung des Vorhandenen wieder ein-
geführt werden konnte.
Der Nationalsozialismus hat, obgleich unter
dem Ausdruck „Bauer" lange Zeit nichts an-
deres als „ungebildeter Mensch" verstanden
wurde, diese Bezeichnung völlig umgewertet
und den Bauern in der gesamten Gesetzgebung
zum Hüter und Pfleger der deutschen Scholle
gemacht. Desgleichen hat der Ausdruck „Sippe"
eine durchaus positive Bedeutung erlangt,
wenn man bedenkt, daß „Sippe" in weiten
Kreisen früher ein Wort beleidigenden Inhalts
war. Es ist also durchaus nichts Neues, daß
Begriffe im Laufe der Zeit eine andere Bedeu-
tung erlangen. So ist es auf studentischem Ge-
biet nunmehr mit dem Ausdruck „Bursche" ge-
schehen. Diese Umwandlung gibt aber nicht
das Recht, nun von nationalsozialistisch ge-
tarnten Korporationen, die wieder errichtet
werden, zu träumen und in völliger Verken-
nung der Sachlage nach einem schmetternden
„silentium" einen erklecklichen Streifen auf
die wieder erstandene Romantik Alt-Heidelber-
ger Prägung zu trinken.
Wir dürfen nicht vergessen: Der weitaus
größte Teil des deutschen Studententums steht
an der Front. Er wird, wenn er zurückkommt,
derartigen lediglich aus Tradition beibehalte-
nen Formen keinerlei Verständnis entgegen-
bringen. Die Zeit ist zu ernst zu solchen Strei-
tereien. Was war, wird nimmer wiederkommen.
Und es wäre erstaunlich, wenn der deutsche
Student, nachdem er für die Erhaltung reiner
deutscher Art und Sitte sein Leben einsetzte,
sich zu ihrer Verkörperung noch fremder For-
men bedienen wollte und seien sie noch so
sehr traditionsgebunden.
Es scheint überhaupt die Frage nach dem
Wert der Tradition nicht einheitlich beantwor-
tet zu werden. Diejenigen, die am Gestrigen
hängen, überschätzen leicht den Wert der Tra-
dition, während auch in einer falsch verstan-
denen Bilderstürmerei gelegentlich ihr Wert
unterschätzt wird. In den nun verflossenen zehn
Jahren nach dem Umbruch ist aber ganz ein-
deutig zu erkennen, wann eine Tradition über-
nommen und wann sie abgebrochen wurde.
Die Antwort darauf dürfte lauten: Wenn der
in einer traditionellen Form ge-
bundene Inhalt dem Wesen des
Nationalsozialismus gerecht
wurde, so wurde die Tradition er-
halten. War sie es nicht, so trat, an
ihre Stelle eine neue Form, die im
Verlauf eines Jahrzehnts schon
zur neuen Tradition geworden ist.
Die Übernahme preußischen Gedankengutes,
die Anknüpfung an das Wollen und die Ziele
itnttuedet* » eder* / 'feh'b"*'cht?"ner' w'e *°" **wc" auj werden' wenn der s° vie| für
Zeichnung von Erik/Scherl
Friedrichs des Großen.zeigen den augenschein*
lichsten Fall der bewußten Weiterführung vor-i
handener Tradition. Auf der andereh Seite!
wurde die Repräsentation des Deutschem
Reichstags vollends umgewandelt. Desgleichen!
unterscheiden sich nationalsozialistische Kund*
gebungen und Feiern völlig von denen frühe*
rer Art. Wir dürfen nicht verkennen, daß dia
studentischen Verbindungen allein schon,
wegen ihrer Zersplitterung zur Verkörpe*
rung nationalsozialistischen S t u *
dententums nicht in der Lage waren«
Wenn gewisse Anschauungen den heutigen ge*
meinsam sind, so kann dies kein Grund sein,
auch die Formen zu übernehmen und als „Tra-:
dition" weiterzuführen. Vielmehr dürften wir
in der Lage sein, uns eine eigene Form heran*
zubilden, die dem Iahalt unseres Wesens ent-
spricht. Daß sie nicht sogleich eingeführt
wurde, ist ein Beweis, daß es uns wesentlicher,
ist, sie wachsen zu lassen, als sie zu konstru-
ieren. Wir haben Zeit, damit zu warten!
Versuche, auf Umwegen Veigangenes zu be*
leben, können niemals zum Ziele führen und
würden von dem zurückkehrenden Studenten*
tum, das im Feuer stahlhart geworden ist, bin*
nen kurzem ausgeschieden werden.
DASS ES SO WAS NOCH GIBT!
Eine Münchener Kameradschaft schickte
uns folgende Zeilen, die eigentlich keines
Kommentars bedürfen. Erfreulicherweise han-
delt es sich bei Herrn M. um einen Einzellall,
der jedoch ob seiner „Originalität" an den
Pranger gehört.
Man sollte es nicht glauben, aber wir er*
leben tatsächlich noch Wunder. Wer das für
unmöglich hält, der hätte nur gegenwärtig zu
sein brauchen, als wir uns rein zufällig eines
Abends im Münchener „Carlton" trafen. Als
Fremder sozusagen, wenn wir in unserer Käme*
radschaft eine Familie sehen, war Herr M.*
Student der Wirtschaftswissenschaften an der
TH. München, 6. Semester, dabei.
Wie das wohl vorkommen soll in solchem:
Kreise, debattierten wir mehr oder weniger
heftig auf fast wissenschaftlicher Basis nicht nur
über die derzeitige Struktur des deutschen Volkes, .
sondern auch überfeine allgemeine. Wirklich,
selbiger Herr M. entwickelte ein verblüffendes
Wissen in Werken unserer Ideenwelt, aber
nicht nur darin allein, sondern auch in solchen
fremder Völker, denn es blieb nicht aus, daß
wir eben diese Völker zu Vergleichen heran-
zogen. Herr M. machte es sehr geschickt, als
er zuerst vom Japanischen Volke sprach. Denn
von da aus den Ubergang zum Vergleich mit
dem englischen zu finden, war nicht mehr
schwer. Hier schien Herr M. in seinem Ele-
ment. Wir hätten ihn fast für einen der eng-
landfreundlichen Schweizer halten können, die
sich ja auch nicht genug tun können, mit ihrer
deutschen Zunge Lobeshymnen auf das hehre
englische Volk anzustimmen.
Zugegeben, es — wohlgemerkt das englische
Volk — hätte diese oder jene Vorzüge, so
fühlen wir doch in uns selbst die Stärke, zu-
mindest Gleiches leisten zu können, ja, unser
uneingeschränktes Selbstvertrauen sagt uns,
daß wir viel mehr vermögen — in jeglicher
Hinsicht! Wir sagten ihm, daß wir, noch im
Anfang einer Evolution stehend,' bereits un-
erhörte Leistungen auf - allen Gebieten des
Volkslebens zu verzeichnen hätten.
Wir haben eben keinen Cromwell in un*
serer Geschichte zu verzeichnen, dafür aber
einen Friedrich den Großen, einen Bismarck
und einen Hitler!
Aber von alledem wollte Herr M. absolut
nichts wissen. Er behauptete, die Fähigkeiten,
wie sie im englischen Volke von Haus aus
vorhanden seien lägen bei unserem Volke
eben nicht vor. Wenn er das auf englische
Secret-Service-Methoden bezieht, geben wir
ihm recht, aber er meint es ja anders. Da aber
konnten wir denn als alte Soldaten, die wir
nur „eben" auf Studienurlaub, zum Teil aus
Lazaretten heraus, hier sind, nicht mehr ganz
mit Herrn M. einiggehen. Wir können uns
solche Auffassungen allenfalls noch erklären,
wenn wir berücksichtigen, daß Herr M. trotz
seiner 22 oder 23 Jahre noch nie — die Gründe
kennen wir nicht — Soldat gewesen ist. Aber
verstehen und billigen können wir solche Auf-
fassungen unmöglich. Das Fanal Stalingrad
würde uns das Herz ausbrennen.
Das gaben wir denn Herrn M. in erstaunens-*
wert noch ruhiger, aber nicht mißzuverstehen-
der Weise zu erkennen. Er versuchte sich der
peinlichen Lage dadurch zu entwinden, daß
er das Problem auf die geistige, ja politische
Seite abwälzte. Er machte sogar Zugeständnisse,
indem er die Erziehung auf den Ordensburgen:
und den Adolf-Hitler-Schulen unter Umständen
als eine Möglichkeit zur Erreichung unserer
Ziele einräumte Aber dabei erklärte er fast
in einem Atemzuge, er sei ja kein National-
sozialist und werde wahrscheinlich nie einer
werden. Das glauben wir ihm nun gern.
Nun hätten uns diese Äußerungen an und für
sich genügen können. Wir waren uns so klar,
geworden, daß wir einen kapitalistisch-liberali-
stisch durch und durch geschulten Mann vor
uns hatten. Dennoch wollten wir den Versuch
nicht unterlassen, ihm zumindest unsere Auf*
fassungen verständlich zu machen. Aber, wiei
vorausgesehen, war unser Versuch ohne Er*
folg. Das Ende war die Erklärung Herrn M.'s:
„Es ist vielleicht besser, wenn wir diese«
Krieg verlieien, dann wird sicher bei uns eini*
ges anders."
Da mußten wir denn die Konsequenzen
ziehen.
Heute, wo wir wissen, daß Herr M. eilt
Schwätzer ist, nehmen w i r ihn nicht mehr für
voll. Trotzdem können wir nicht dulden, daß
Leute solcher Geistesrichtung als freie Studie-
rende an deutschen Hochschulen zu sehen sind«
Folge 4 / Die Bewegung / Seite I