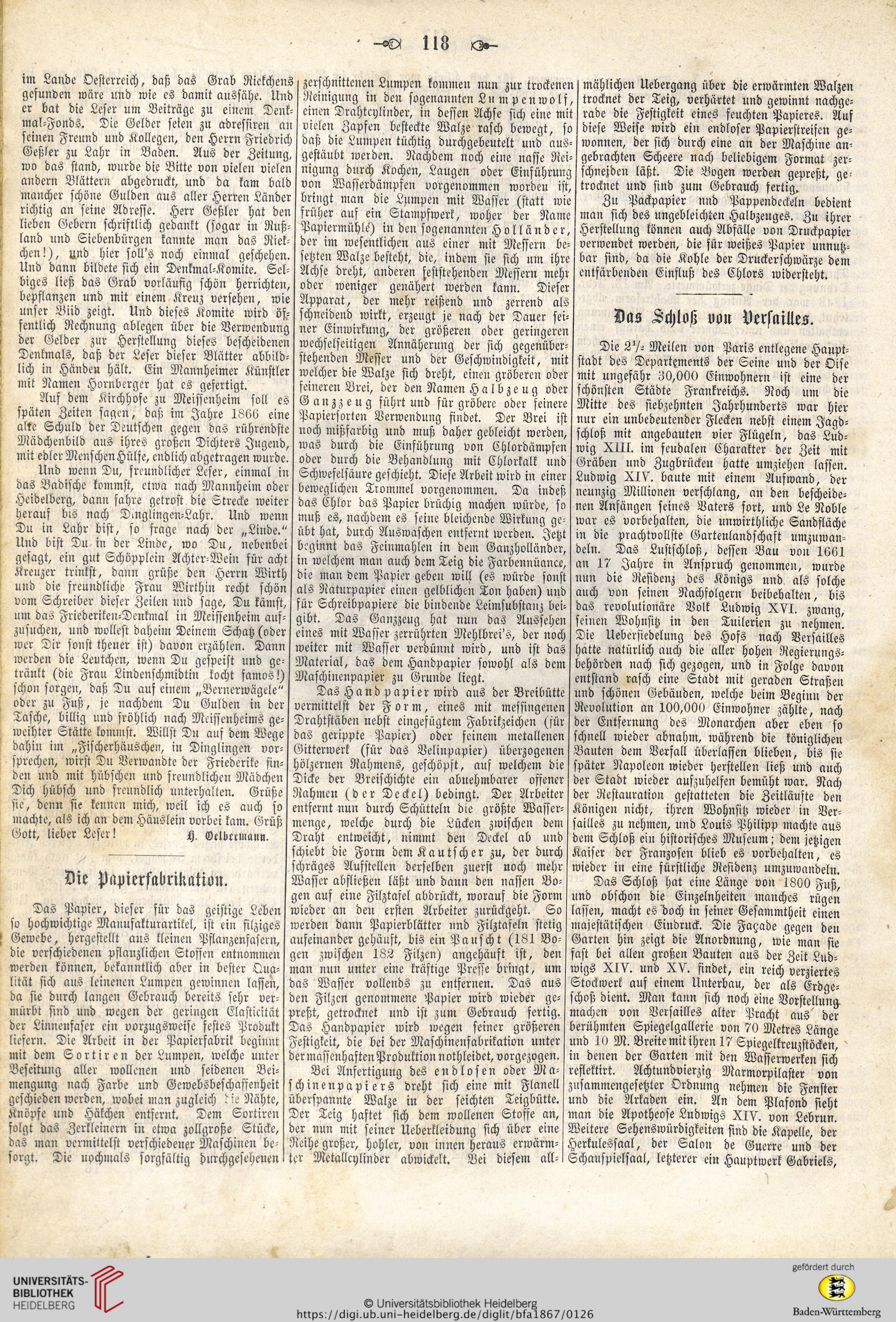' -sN 118 O-
im Lande Oesterreich, daß das Grab Riekchens
gefunden wäre und wie es damit aussähe. Und
er bat die Leser um Beiträge zu einem Denk-
mal-Fonds. Die Gelder seien zu adressireu an
seinen Freund und Kollegen, den Herrn Friedrich
Geßler zu Lahr in Baden. Aus der Zeitung,
wo das stand, wurde die Bitte von vielen vielen
andern Blättern abgedruckt, und da kam bald
mancher schöne Gulden aus aller Herren Länder
richtig an seine Adresse. Herr Geßler hat den
lieben Gebern schriftlich gedankt (sogar in Ruß-
land und Siebenbürgen kannte man das Niek-
chcn!), Md hier soll's noch einmal geschehen.
Und dann bildete sich ein Denkmal-Komite. Sel-
biges ließ das Grab vorläufig schön Herrichten,
bepflanzen und mit einem Kreuz versehen, wie
unser Biid zeigt. Und dieses Konnte wird öf-
fentlich Rechnung ablegen über die Verwendung
der Gelder zur Herstellung dieses bescheidenen
Denkmals, daß der Leser dieser Blätter abbild-
lich in Händen hält. Ein Mannheimer Künstler
mit Namen Hornberger hat cs gefertigt.
Auf dem Kirchhofe zu Meissenheim soll cs
späten Zeiten sagen, daß im Jahre 1860 eine
alte Schuld der Deutschen gegen das rührendste
Mädchenbild aus ihres großen Dichters Jugend,
mit edler MenschenHülse, endlich abgetragen wurde.
Und wenn Du, freundlicher Leser, einmal in
das Badische kommst, etwa nach Mannheim oder
Heidelberg, dann fahre getrost die Strecke weiter
herauf bis nach Dmglingen-Lahr. Und wenn
Du in Lahr bist, so frage nach der „Linde."
Und bist Du in der Linde, wo Du, nebenbei
gesagt, ein gut Schöpplein Achter-Wein für acht
Kreuzer trinkst, dann grüße den Herrn Wirth
und die freundliche Frau Wirthin recht schön
vom Schreiber dieser Zeilen und sage. Du kämst,
um das Friederiken-Denkmal in Meissenheim auf-
zusuchen, und wollest daheim Deinem Schatz (oder
wer Dir sonst theuer ist) davon erzählen. Dann
werden die Leutchen, wenn Du gespeist und ge-
tränkt (die Frau Lindenschmidtin kocht famos!)
schon sorgen, daß Du auf einem „Bernerwägele"
oder zu Fuß, je nachdem Du Gulden in der
Tasche, billig und fröhlich nach Meissenheims ge-
weihter Stätte kommst. Willst Du auf dem Wege
dahin im „Fischerhäuschen, in Dinglingen vor-
sprechen, wirst Du Verwandte der Friederike fin-
den und mit hübschen und freundlichen Mädchen
Dich hübsch und freundlich unterhalten. Grüße
sie, denn sie kennen mich, weil ich es auch so
machte, als ich an deni Häuslein vorbei kam. Grüß
Gott, lieber Leser! H. Velbrrnmnn.
Oie Papierfabrikation.
Das Papier, dieser für das geistige Leben
so hochwichtige Manufakturartikel, ist ein filziges
Gewebe, hergestellt aus kleinen Pflanzenfasern,
die verschiedenen pflanzlichen Stossen entnommen
werden können, bekanntlich aber in bester Qua-
lität sich aus leinenen Lumpen gewinnen lassen,
da sie durch langen Gebrauch bereits sehr ver-
mürbt sind und wegen der geringen Elasticität
der Linnenfaser ein vorzugsweise festes Produkt
liefern. Die Arbeit in der Papierfabrik beginnt
mit dem Sortiren der Lumpen, welche unter
Beseitung aller wollenen und seidenen Bei-
mengung nach Farbe und Gewebsbeschaffenheit
geschieden werden, wobei man zugleich Ne Nähte,
Knöpfe und Häkchen entfernt. Dem Sortiren
folgt das Zerkleinern in etwa zollgroße Stücke,
das man vermittelst verschiedener Maschinen be-
sorgt, Die nochmals sorgfältig durchgesehenen
zerschnittenen Lumpen kommen nun zur trockenen
Reinigung in den sogenannten Lu m p cnwo ls,
einen Drahtcylinder, in dessen Achse sich eine mit
vielen Zapfen besteckte Walze rasch bewegt, so
daß die Lumpen tüchtig durchgebeutelt und aus-
gestäubt werden. Nachdem noch eine nasse Rei-
nigung durch Kochen, Laugen oder Einführung
von Wasserdämpfen vorgenommen worden ist,
bringt man die Lpmpen mit Wasser (statt wie
früher auf ein Stampfwerk, woher der Name
Papiermühle) in den sogenannten Holländer,
der im wesentlichen aus einer mit Messern be-
setzten Walze besteht, die, indem sie sich um ihre
Achse dreht, anderen feststehenden Messern mehr
oder weniger genähert werden kann. Dieser
Apparat, der mehr reißend und zerrend als
schneidend wirkt, erzeugt je nach der Dauer sei-
ner Einwirkung, der größeren oder geringeren
wechselseitigen Annäherung der sich gegenüber-
stehenden Messer und der Geschwindigkeit, mit
welcher die Walze sich dreht, einen gröberen oder
feineren Brei, der den Namen Halbzeug oder
Ganzzeug führt und für gröbere oder feinere
Papiersorten Verwendung findet. Der Brei ist
noch mißfarbig und muß daher gebleicht werden,
was durch die Einführung von Chlordämpfen
oder durch die Behandlung mit Chlorkalk und
Schwefelsäure geschieht. Diese Arbeit wird in einer
beweglichen Trommel vorgenommen. Da indes;
das Chlor das Papier brüchig machen würde, so
muß es, nachdem es seine bleichende Wirkung ge-
übt hat, durch Auswaschen entfernt werden. Jetzt
beginnt das Feinmahlen in dem Gauzholländer,
in welchem man auch dem Teig die Farbennüance,
die man dem Papier geben will (es würde sonst
als Naturpapier einen gelblichen Ton haben) und
für Schreibpapiere die bindende Leimsubstauz bei-
gibt. Das Ganzzeug hat nun das Aussehen
eines mit Wasser zerrührten Mehlbrei's, der noch
weiter mit Wasser verdünnt wird, und ist das
Material, das dem Handpapier sowohl als dem
Maschinenpapier zu Grunde liegt.
Das Hand papier wird aus der Brcibütte
vermittelst der Form, eines mit messingenen
Drahtstäben nebst eingefügtcm Fabrikzeichen (für
das gerippte Papier) oder feinem metallenen
Gitterwerk (für das Velinpapier) überzogenen
hölzernen Rahmens, geschöpft, auf welchem die
Dicke der Breischichte ein abnehmbarer offener
Rahmen (der Deckel) bedingt. Der Arbeiter
entfernt nun durch Schütteln die größte Wasser-
menge, welche durch die Lücken zwischen dem
Draht entweicht, nimmt den Deckel ab und
schiebt die Form dcmKautscher zu, der durch
schräges Ausstellen derselben zuerst noch mehr
Wasser abfließen läßt und dann den nassen Bo-
gen auf eine Filztafel abdrückt, worauf die Form
wieder an den ersten Arbeiter zurückgeht. So
werden dann Papierblätter und Kilztafeln stetig
aufeinander gehäuft, bis ein Pauscht (181 Bo-
gen zwischen 182 Filzen) angehäuft ist, den
man nun unter eine kräftige Presse bringt, um
das Wasser vollends zu entfernen. Das aus
den Filzen genommene Papier wird wieder ge-
preßt, getrocknet und ist zum Gebrauch fertig.
Das Handpapier wird wegen seiner größeren
Festigkeit, die bei der Maschinenfabrikation unter
dermassenhaftenProduktionnothleidet, vorgezogen.
Bei Anfertigung des endlosen oder Ma-
schinenpapiers dreht sich eine mit Flanell
überspannte Walze in der seichten Teigbütte.
Der Teig haftet sich dem wollenen Stoffe an,
der nun mit seiner Ueberkleidung sich über eine
Reihe großer, hohler, von innen heraus erwärm-
ter Metallcylinder abwickclt. Bei diesem all-
mählichen Uebergang über die erwärmten Walzen
trocknet der Teig, verhärtet und gewinnt nachge-
rade die Festigkeit eines feuchten Papiere«. Auf
diese Weise wird ein endloser Papierstreiscn ge-
wonnen, der sich durch eine an der Maschine an-
gebrachten Scheere nach beliebigem Format zer-
schneiden läßt. Die Bogen werden gepreßt, ge-
trocknet und sind zum Gebrauch fertig.
Zu Packpapier und Pappendeckeln bedient
man sich des ungebleichten Halbzeuges. Zu ihrer
Herstellung können auch Abfälle von Druckpapier
verwendet werden, die für weißes Papier unnutz-
bar sind, da die Kohle der Druckerschwärze dem
entfärbenden Einfluß des Chlors widersteht.
Das Schloß von Versailles.
Die 2V-- Meilen von Paris entlegene Haupt-
stadt des Departements der Seine und der Oise
mit ungefähr 30,000 Einwohnern ist eine der
schönsten Städte Frankreichs. Noch um die
Mitte des siebzehnten Jahrhunderts war hier
nur ein unbedeutender Flecken nebst einem Jagd-
schloß mit angebauten vier Flügeln, das Lud-
wig XIII. im feudalen Charakter der Zeit mit
Gräben und Zugbrücken hatte umziehen lassen.
Ludwig XIV. baute mit einem Aufwand, der
neunzig Millionen verschlang, au den bescheide-
nen Anfängen seines Vaters fort, und Le Noble
war es vorbehalten, die unwirthliche Sandflüche
in die prachtvollste Gartenlandschaft umzuwan-
deln. Das Lustschloß, dessen Bau von 1661
an 17 Jahre in Anspruch genommen, wurde
nun die Residenz des Königs und als solche
auch von seinen Nachfolgern beibehalten, bis
das revolutionäre Volk Ludwig XVI. zwang,
seinen Wohnsitz in den Tuilerien zu nehmen.
Die Uebersiedelung des Hofs nach Versailles
hatte natürlich auch die aller hohen Regierungs-
behörden nach sich gezogen, und in Folge davon
entstand rasch eine Stadt mit geraden Straßen
und schönen Gebäuden, welche beim Beginn der
Revolution an 100,000 Einwohner zählte, nach
der Entfernung des Monarchen aber eben so
schnell wieder abnahm, während die königlichen
Bauten dem Verfall überlassen blieben, bis sie
später Napoleon wieder Herstellen ließ und auch
der Stadt wieder aufzuhelfen bemüht war. Nach
der Restauration gestatteten die Zeitläufte den
Königen nicht, ihren Wohnsitz wieder in Ver-
sailles zu nehmen, und Louis Philipp machte aus
dem Schloß eiu historisches Museum; dem jetzigen
Kaiser der Franzosen blieb es Vorbehalten, cs
wieder in eine fürstliche Residenz umzuwandeln.
Das Schloß hat eine Länge von 1800 Fuß,
und obschon die Einzelnheiten manches rügen
lassen, macht es doch in seiner Gesammtheit einen
majestätischen Eindruck. Die Fa^ade gegen den
Garten hin zeigt die Anordnung, wie man sie
fast bei allen großen Bauten aus der Zeit Lud-
wigs XIV. und XV. findet, ein reich verziertes
Stockwerk auf einem Unterbau, der als Erdge-
schoß dient. Man kann sich noch eine Vorstellung
machen von Versailles alter Pracht aus" der
berühmten Spiegelgallerie von 70 Metres Länge
und 10 M. Breite mit ihren 17 Spiegelkreuzstöcken,
in denen der Garten mit den Wasserwerken sich
reflektirt. Achtundvierzig Marmorpilaster von
zusammengesetzter Ordnung nehmen die Fenster
und die Arkaden ein. An dem Plafond sieht
man die Apotheose Ludwigs XIV. von Lebrun.
Weitere Sehenswürdigkeiten sind die Kapelle, der
Herkulessaal, der Salon de Guerrc und der
Schauspielsaal, letzterer ein Hauptwerk Gabriels,
im Lande Oesterreich, daß das Grab Riekchens
gefunden wäre und wie es damit aussähe. Und
er bat die Leser um Beiträge zu einem Denk-
mal-Fonds. Die Gelder seien zu adressireu an
seinen Freund und Kollegen, den Herrn Friedrich
Geßler zu Lahr in Baden. Aus der Zeitung,
wo das stand, wurde die Bitte von vielen vielen
andern Blättern abgedruckt, und da kam bald
mancher schöne Gulden aus aller Herren Länder
richtig an seine Adresse. Herr Geßler hat den
lieben Gebern schriftlich gedankt (sogar in Ruß-
land und Siebenbürgen kannte man das Niek-
chcn!), Md hier soll's noch einmal geschehen.
Und dann bildete sich ein Denkmal-Komite. Sel-
biges ließ das Grab vorläufig schön Herrichten,
bepflanzen und mit einem Kreuz versehen, wie
unser Biid zeigt. Und dieses Konnte wird öf-
fentlich Rechnung ablegen über die Verwendung
der Gelder zur Herstellung dieses bescheidenen
Denkmals, daß der Leser dieser Blätter abbild-
lich in Händen hält. Ein Mannheimer Künstler
mit Namen Hornberger hat cs gefertigt.
Auf dem Kirchhofe zu Meissenheim soll cs
späten Zeiten sagen, daß im Jahre 1860 eine
alte Schuld der Deutschen gegen das rührendste
Mädchenbild aus ihres großen Dichters Jugend,
mit edler MenschenHülse, endlich abgetragen wurde.
Und wenn Du, freundlicher Leser, einmal in
das Badische kommst, etwa nach Mannheim oder
Heidelberg, dann fahre getrost die Strecke weiter
herauf bis nach Dmglingen-Lahr. Und wenn
Du in Lahr bist, so frage nach der „Linde."
Und bist Du in der Linde, wo Du, nebenbei
gesagt, ein gut Schöpplein Achter-Wein für acht
Kreuzer trinkst, dann grüße den Herrn Wirth
und die freundliche Frau Wirthin recht schön
vom Schreiber dieser Zeilen und sage. Du kämst,
um das Friederiken-Denkmal in Meissenheim auf-
zusuchen, und wollest daheim Deinem Schatz (oder
wer Dir sonst theuer ist) davon erzählen. Dann
werden die Leutchen, wenn Du gespeist und ge-
tränkt (die Frau Lindenschmidtin kocht famos!)
schon sorgen, daß Du auf einem „Bernerwägele"
oder zu Fuß, je nachdem Du Gulden in der
Tasche, billig und fröhlich nach Meissenheims ge-
weihter Stätte kommst. Willst Du auf dem Wege
dahin im „Fischerhäuschen, in Dinglingen vor-
sprechen, wirst Du Verwandte der Friederike fin-
den und mit hübschen und freundlichen Mädchen
Dich hübsch und freundlich unterhalten. Grüße
sie, denn sie kennen mich, weil ich es auch so
machte, als ich an deni Häuslein vorbei kam. Grüß
Gott, lieber Leser! H. Velbrrnmnn.
Oie Papierfabrikation.
Das Papier, dieser für das geistige Leben
so hochwichtige Manufakturartikel, ist ein filziges
Gewebe, hergestellt aus kleinen Pflanzenfasern,
die verschiedenen pflanzlichen Stossen entnommen
werden können, bekanntlich aber in bester Qua-
lität sich aus leinenen Lumpen gewinnen lassen,
da sie durch langen Gebrauch bereits sehr ver-
mürbt sind und wegen der geringen Elasticität
der Linnenfaser ein vorzugsweise festes Produkt
liefern. Die Arbeit in der Papierfabrik beginnt
mit dem Sortiren der Lumpen, welche unter
Beseitung aller wollenen und seidenen Bei-
mengung nach Farbe und Gewebsbeschaffenheit
geschieden werden, wobei man zugleich Ne Nähte,
Knöpfe und Häkchen entfernt. Dem Sortiren
folgt das Zerkleinern in etwa zollgroße Stücke,
das man vermittelst verschiedener Maschinen be-
sorgt, Die nochmals sorgfältig durchgesehenen
zerschnittenen Lumpen kommen nun zur trockenen
Reinigung in den sogenannten Lu m p cnwo ls,
einen Drahtcylinder, in dessen Achse sich eine mit
vielen Zapfen besteckte Walze rasch bewegt, so
daß die Lumpen tüchtig durchgebeutelt und aus-
gestäubt werden. Nachdem noch eine nasse Rei-
nigung durch Kochen, Laugen oder Einführung
von Wasserdämpfen vorgenommen worden ist,
bringt man die Lpmpen mit Wasser (statt wie
früher auf ein Stampfwerk, woher der Name
Papiermühle) in den sogenannten Holländer,
der im wesentlichen aus einer mit Messern be-
setzten Walze besteht, die, indem sie sich um ihre
Achse dreht, anderen feststehenden Messern mehr
oder weniger genähert werden kann. Dieser
Apparat, der mehr reißend und zerrend als
schneidend wirkt, erzeugt je nach der Dauer sei-
ner Einwirkung, der größeren oder geringeren
wechselseitigen Annäherung der sich gegenüber-
stehenden Messer und der Geschwindigkeit, mit
welcher die Walze sich dreht, einen gröberen oder
feineren Brei, der den Namen Halbzeug oder
Ganzzeug führt und für gröbere oder feinere
Papiersorten Verwendung findet. Der Brei ist
noch mißfarbig und muß daher gebleicht werden,
was durch die Einführung von Chlordämpfen
oder durch die Behandlung mit Chlorkalk und
Schwefelsäure geschieht. Diese Arbeit wird in einer
beweglichen Trommel vorgenommen. Da indes;
das Chlor das Papier brüchig machen würde, so
muß es, nachdem es seine bleichende Wirkung ge-
übt hat, durch Auswaschen entfernt werden. Jetzt
beginnt das Feinmahlen in dem Gauzholländer,
in welchem man auch dem Teig die Farbennüance,
die man dem Papier geben will (es würde sonst
als Naturpapier einen gelblichen Ton haben) und
für Schreibpapiere die bindende Leimsubstauz bei-
gibt. Das Ganzzeug hat nun das Aussehen
eines mit Wasser zerrührten Mehlbrei's, der noch
weiter mit Wasser verdünnt wird, und ist das
Material, das dem Handpapier sowohl als dem
Maschinenpapier zu Grunde liegt.
Das Hand papier wird aus der Brcibütte
vermittelst der Form, eines mit messingenen
Drahtstäben nebst eingefügtcm Fabrikzeichen (für
das gerippte Papier) oder feinem metallenen
Gitterwerk (für das Velinpapier) überzogenen
hölzernen Rahmens, geschöpft, auf welchem die
Dicke der Breischichte ein abnehmbarer offener
Rahmen (der Deckel) bedingt. Der Arbeiter
entfernt nun durch Schütteln die größte Wasser-
menge, welche durch die Lücken zwischen dem
Draht entweicht, nimmt den Deckel ab und
schiebt die Form dcmKautscher zu, der durch
schräges Ausstellen derselben zuerst noch mehr
Wasser abfließen läßt und dann den nassen Bo-
gen auf eine Filztafel abdrückt, worauf die Form
wieder an den ersten Arbeiter zurückgeht. So
werden dann Papierblätter und Kilztafeln stetig
aufeinander gehäuft, bis ein Pauscht (181 Bo-
gen zwischen 182 Filzen) angehäuft ist, den
man nun unter eine kräftige Presse bringt, um
das Wasser vollends zu entfernen. Das aus
den Filzen genommene Papier wird wieder ge-
preßt, getrocknet und ist zum Gebrauch fertig.
Das Handpapier wird wegen seiner größeren
Festigkeit, die bei der Maschinenfabrikation unter
dermassenhaftenProduktionnothleidet, vorgezogen.
Bei Anfertigung des endlosen oder Ma-
schinenpapiers dreht sich eine mit Flanell
überspannte Walze in der seichten Teigbütte.
Der Teig haftet sich dem wollenen Stoffe an,
der nun mit seiner Ueberkleidung sich über eine
Reihe großer, hohler, von innen heraus erwärm-
ter Metallcylinder abwickclt. Bei diesem all-
mählichen Uebergang über die erwärmten Walzen
trocknet der Teig, verhärtet und gewinnt nachge-
rade die Festigkeit eines feuchten Papiere«. Auf
diese Weise wird ein endloser Papierstreiscn ge-
wonnen, der sich durch eine an der Maschine an-
gebrachten Scheere nach beliebigem Format zer-
schneiden läßt. Die Bogen werden gepreßt, ge-
trocknet und sind zum Gebrauch fertig.
Zu Packpapier und Pappendeckeln bedient
man sich des ungebleichten Halbzeuges. Zu ihrer
Herstellung können auch Abfälle von Druckpapier
verwendet werden, die für weißes Papier unnutz-
bar sind, da die Kohle der Druckerschwärze dem
entfärbenden Einfluß des Chlors widersteht.
Das Schloß von Versailles.
Die 2V-- Meilen von Paris entlegene Haupt-
stadt des Departements der Seine und der Oise
mit ungefähr 30,000 Einwohnern ist eine der
schönsten Städte Frankreichs. Noch um die
Mitte des siebzehnten Jahrhunderts war hier
nur ein unbedeutender Flecken nebst einem Jagd-
schloß mit angebauten vier Flügeln, das Lud-
wig XIII. im feudalen Charakter der Zeit mit
Gräben und Zugbrücken hatte umziehen lassen.
Ludwig XIV. baute mit einem Aufwand, der
neunzig Millionen verschlang, au den bescheide-
nen Anfängen seines Vaters fort, und Le Noble
war es vorbehalten, die unwirthliche Sandflüche
in die prachtvollste Gartenlandschaft umzuwan-
deln. Das Lustschloß, dessen Bau von 1661
an 17 Jahre in Anspruch genommen, wurde
nun die Residenz des Königs und als solche
auch von seinen Nachfolgern beibehalten, bis
das revolutionäre Volk Ludwig XVI. zwang,
seinen Wohnsitz in den Tuilerien zu nehmen.
Die Uebersiedelung des Hofs nach Versailles
hatte natürlich auch die aller hohen Regierungs-
behörden nach sich gezogen, und in Folge davon
entstand rasch eine Stadt mit geraden Straßen
und schönen Gebäuden, welche beim Beginn der
Revolution an 100,000 Einwohner zählte, nach
der Entfernung des Monarchen aber eben so
schnell wieder abnahm, während die königlichen
Bauten dem Verfall überlassen blieben, bis sie
später Napoleon wieder Herstellen ließ und auch
der Stadt wieder aufzuhelfen bemüht war. Nach
der Restauration gestatteten die Zeitläufte den
Königen nicht, ihren Wohnsitz wieder in Ver-
sailles zu nehmen, und Louis Philipp machte aus
dem Schloß eiu historisches Museum; dem jetzigen
Kaiser der Franzosen blieb es Vorbehalten, cs
wieder in eine fürstliche Residenz umzuwandeln.
Das Schloß hat eine Länge von 1800 Fuß,
und obschon die Einzelnheiten manches rügen
lassen, macht es doch in seiner Gesammtheit einen
majestätischen Eindruck. Die Fa^ade gegen den
Garten hin zeigt die Anordnung, wie man sie
fast bei allen großen Bauten aus der Zeit Lud-
wigs XIV. und XV. findet, ein reich verziertes
Stockwerk auf einem Unterbau, der als Erdge-
schoß dient. Man kann sich noch eine Vorstellung
machen von Versailles alter Pracht aus" der
berühmten Spiegelgallerie von 70 Metres Länge
und 10 M. Breite mit ihren 17 Spiegelkreuzstöcken,
in denen der Garten mit den Wasserwerken sich
reflektirt. Achtundvierzig Marmorpilaster von
zusammengesetzter Ordnung nehmen die Fenster
und die Arkaden ein. An dem Plafond sieht
man die Apotheose Ludwigs XIV. von Lebrun.
Weitere Sehenswürdigkeiten sind die Kapelle, der
Herkulessaal, der Salon de Guerrc und der
Schauspielsaal, letzterer ein Hauptwerk Gabriels,